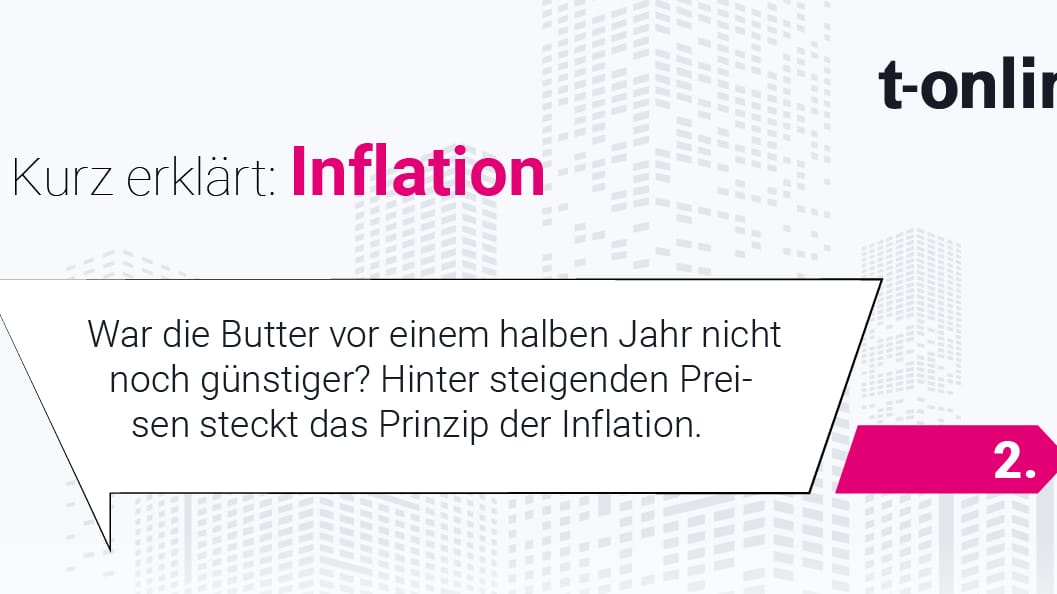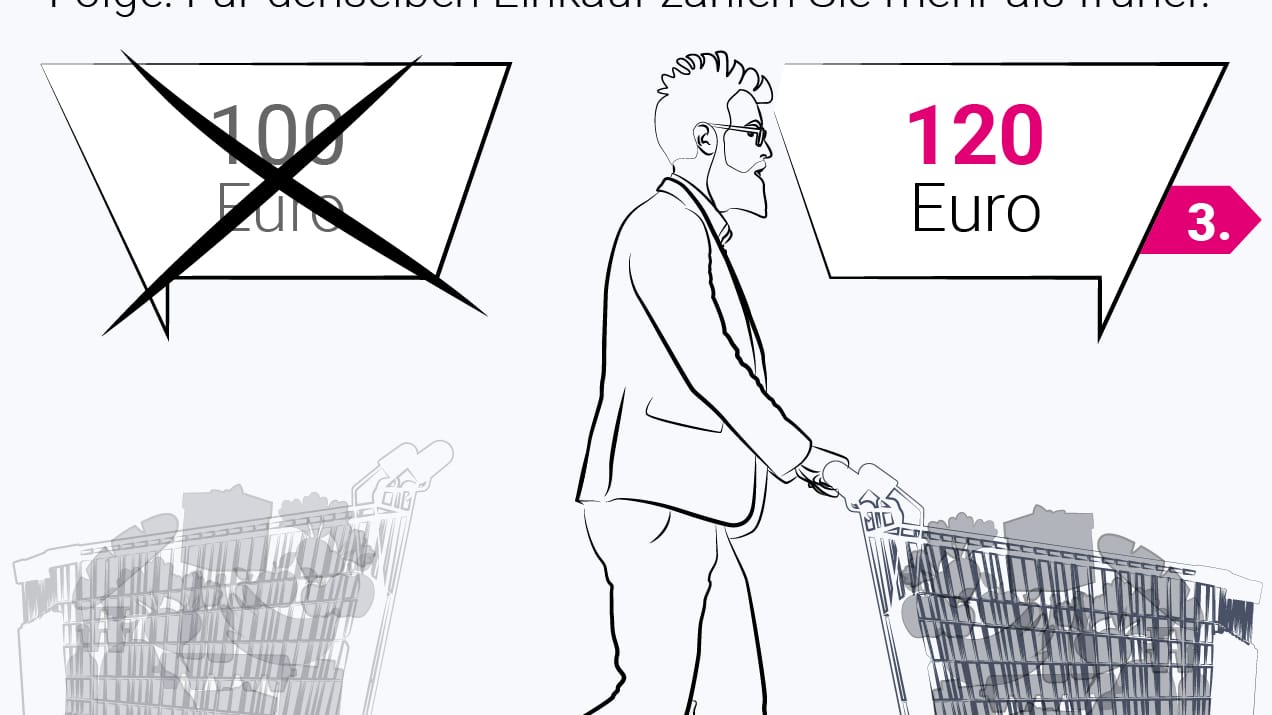Mehr als 150 Journalistinnen und Journalisten berichten rund um die Uhr für Sie über das Geschehen in Deutschland und der Welt.
Zum journalistischen Leitbild von t-online.Milliardenschulden Das bedeutet das Mega-Finanzpaket für Ihr Geld


Mit einem Finanzpaket historischen Ausmaßes wollen Union und SPD die Konjunktur anschieben und die Verteidigung stärken. Welche Folgen die Milliardenschulden für Sparer, Rentner und künftige Generationen haben.
Noch bevor die neue Bundesregierung die Arbeit aufnimmt, haben sich die potenziellen Koalitionspartner Union und SPD auf ein Finanzpaket geeinigt, das Investitionen von einer Billion Euro und mehr möglich machen soll. t-online erklärt, was das für die deutsche Wirtschaft bedeutet, welche Folgen die neuen Schulden für Sparer und Rentner haben – und ob sich Deutschland das überhaupt leisten kann.
Was genau wurde beschlossen?
Die Einigung besteht aus zwei Teilen: Zum einen sollen Kredite für alle Verteidigungsausgaben oberhalb von einem Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) bei der Berechnung der Schuldenbremse ausgenommen werden. Legt man das BIP für 2024 zugrunde, beträfe das alle Ausgaben, die die Marke von etwa 43 Milliarden Euro übersteigen. Zum anderen soll ein neues Sondervermögen von 500 Milliarden Euro geschaffen werden, um die Infrastruktur zu modernisieren, etwa marode Brücken oder Bahnschienen. Es soll eine Laufzeit von zehn Jahren haben.
Die Reform der Schuldenbremse sollte noch vom alten Bundestag beschlossen werden, um zu verhindern, dass sie im künftigen Parlament von AfD und Linken blockiert werden kann. Da Union und SPD allein nicht auf die für Grundgesetzänderungen nötige Zweidrittelmehrheit kommen, waren sie im noch bestehenden Bundestag auf die Stimmen der Grünen angewiesen. Die FDP lehnte ein Lockern der Schuldenbremse bis zuletzt ab – daran war die Ampelkoalition letztlich zerbrochen. Lesen Sie hier, wie die Schuldenbremse funktioniert. Am Freitag muss noch der Bundesrat mit Zweidrittelmehrheit zustimmen.
Was bedeutet das Finanzpaket für Wirtschaft und Verteidigungsfähigkeit?
Tritt das Finanzpaket so in Kraft, kann Deutschland faktisch ohne Limit aufrüsten: Egal, wie viel Geld die Bundeswehr braucht, der Staat könnte ohne rechtliche Probleme neue Schulden dafür aufnehmen. Die jährlich 50 Milliarden Euro, die der Bund für zehn Jahre in die Infrastruktur stecken will, dürften derweil auch die Wirtschaft beleben und die Auftragsbücher vieler Unternehmen füllen.
Die meisten Ökonomen sahen die Pläne mit Blick auf die Konjunktur im Vorfeld positiv. "Ein wuchtiges und gutes Paket", sagte etwa Jens Südekum, Professor für International Economics an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Indem man Verteidigungsausgaben von der Schuldenbremse freistelle, könne man dauerhaft militärische Fähigkeiten aufbauen. Dies erscheint angesichts der schwindenden Unterstützung der USA als drängender denn je.
Sebastian Dullien, wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK), hofft auf einen Konjunkturschub: "Dann dürfte die Stagnation der deutschen Wirtschaft jetzt schnell überwunden sein", sagte er. "Deutschland ist wieder wirtschaftlich und militärisch handlungsfähig."
Damit das gelingt, sei es laut Südekum jedoch wichtig, das viele Geld in die richtigen Projekte zu stecken und Investitionen mit weiteren Maßnahmen zu flankieren – etwa schnelleren Genehmigungsverfahren bei der Infrastruktur. Es müsse glaubwürdig kommuniziert werden, "dass der Staat jetzt Ernst macht mit der Investitionsoffensive. Nur dann werden Bau- und Handwerksbetriebe ihre Kapazitäten aufstocken", so der Wissenschaftler. Im Verteidigungsbereich dürfte das Geld nicht für veraltete Ausrüstung ausgegeben, sondern in neueste Technik investiert werden.
Was bedeutet das Paket für Sparer?
Wer deutsche Aktien hält, kann sich über deutlich gestiegene Kurse freuen. Noch vor der Entscheidung des Bundestags am Nachmittag erreichte der Dax ein Rekordhoch von 23.476 Punkten und schloss mit einem Plus von 0,98 Prozent bei 23.380,70 Zählern. Seit Jahresbeginn liegt der Zuwachs bei über 17 Prozent.
Die Erwartung steigender Staatsausgaben stärkt das Vertrauen der Anleger. Der ZEW-Index, der die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten misst, legte im März deutlich zu. Trotz Unsicherheiten aufgrund der US-Zollpolitik überwiegt laut Experten der positive Effekt des schuldenfinanzierten Konjunkturprogramms.
Das vom Bundestag beschlossene Finanzpaket schaffe Verlässlichkeit, so auch Thomas Gitzel von der VP Bank: "Unternehmen können nun in Maschinen und Kapazitätserweiterungen investieren." So profitierten auch Unternehmen aus der zweiten und dritten Börsenreihe. MDax und SDax legten im einstelligen Bereich zu.
Aber auch bei den Rüstungswerten ging es weiter nach oben. Schon zu Beginn der ersten Märzwoche gingen die Kurse im Rüstungssektor durch die Decke, Tendenz weiter steigend. Lohnt es sich nun also, Aktien von Rüstungsfirmen zu kaufen? Die Aussichten für die Branchen sind jedenfalls gut, denn um Aufträge werden sich die Unternehmen in den nächsten Jahren nicht sorgen müssen.
Andererseits sind die Kurse bereits stark gestiegen – diesen Sprung haben Neueinsteiger verpasst. Hinzu kommt die moralische Komponente: Ein Investment in Rüstungsaktien muss man auch mit seinem Gewissen vereinbaren können.
- Rheinmetall: Rekordaufträge und saftige Dividende
- Lesen Sie auch: Gute Schulden, schlechte Schulden und was die Börse davon hält
Grundsätzlich raten Anlageexperten dazu, Geld breit zu streuen – also nicht ausschließlich auf eine bestimmte Branche oder gar Einzelaktien zu setzen. Wer jedoch davon ausgeht, dass Kriegsgefahr und Bedrohungen anhalten und es vor sich selbst vertreten kann, davon zu profitieren, kann zumindest einen kleinen Teil seines Vermögens in diese Branche investieren.
Das geht zum Beispiel mit dem Future of Defence ETF von HANetf (ISIN: IE000J5TQP4) oder dem VanEck Defence ETF (ISIN: IE000YYE6WK5). Der erste ETF bildet den EQM Nato+ Future of Defence Index ab, der sich ausschließlich aus Unternehmen zusammensetzt, die Mitglieder des Verteidigungsbündnisses Nato ausrüsten. Der VanEck-ETF bildet den Market Vector Global Defense Industry Index ab.
Können wir uns das leisten?
Das wohl bekannteste Argument gegen die Aufnahme hoher Schulden lautet: Künftige Generationen müssten dafür die Zeche zahlen und würden zu stark belastet. Dem entgegen steht die Auffassung, dass auch ausbleibende Investitionen eine Belastung darstellen, wenn etwa die Infrastruktur immer weiter an Wert verliert oder gar unbrauchbar wird.
Fest steht aber: Die Schuldenquote Deutschlands wird kräftig steigen. Sie gibt an, in welchem Verhältnis der Schuldenstand zum BIP steht. Grundsätzlich gilt dabei: Eine niedrige Schuldenquote signalisiert, dass ein Land wirtschaftlich stabil ist. Liegt die Quote über 100 Prozent, bedeutet das, dass ein Land in Summe mehr Verbindlichkeiten hat, als die heimische Wirtschaft in einem Jahr produziert.
Commerzbank-Analyst Krämer prognostiziert einen Anstieg der deutschen Schuldenquote von aktuell 63,6 Prozent zum BIP auf 90 Prozent in den kommenden zehn Jahren. Allerdings hänge die Entwicklung auch von der Inflation ab, die Einschätzung sei daher mit Unsicherheiten behaftet.
Eine ähnliche Größenordnung erwartet Wolf Heinrich Reuter, ehemaliger Haushaltsstaatssekretär im Bundesfinanzministerium unter Christian Lindner (FDP). Auf X schrieb er, Deutschland könne über zehn Jahre zusätzliche Schulden in der Größenordnung von mindestens 1.800 Milliarden Euro beziehungsweise 165 bis 200 Milliarden pro Jahr machen. Das entspräche einem Anstieg der Schuldenquote von circa 33 Prozentpunkten.
Problematisch wird es, wenn Staatsschulden dauerhaft schneller wachsen als die Wirtschaftsleistung. Schließlich muss der Staat auf seine Schulden Zinsen zahlen. Da zumindest die Ausgaben für Infrastruktur wie Bahntrassen und Schulen auch öffentliche Vermögenswerte aufbauen und die Wirtschaft ankurbeln sollen, könnte Deutschland auf Dauer wieder aus seinen Schulden herauswachsen – so zumindest die Theorie.
Laufende Ausgaben wie etwa Sozialleistungen oder Personalkosten des Staates hingegen sollten nicht durch Schulden finanziert werden, sondern durch laufende Steuereinnahmen.
Was bedeutet das für die Inflation?
In der Theorie steigen die Preise schneller, wenn der Staat seine Ausgaben erhöht. Grund dafür: Wenn mehr Geld im Umlauf ist, verringert sich der Wert des einzelnen Euro, wodurch die Preise für Waren und Dienstleistungen steigen.
Wie sehr ein solcher Effekt in der Praxis aber tatsächlich droht, lässt sich derzeit nur schwer abschätzen. Das liegt zum einen daran, dass noch offen ist, wie hoch die tatsächlichen Ausgaben für die Aufrüstung ausfallen und ob Deutschland sämtliche Rüstungsgüter überhaupt hierzulande wird produzieren können. Landet ein großer Teil des faktisch unbegrenzten Wehretats etwa in den USA, wäre der Teuerungseffekt in Deutschland geringer.
Zum anderen gilt auch mit Blick auf das milliardenschwere Infrastrukturpaket: Noch ist unklar, ob die Baufirmen kurzfristig überhaupt die Kapazitäten haben, um mögliche Großaufträge der öffentlichen Hand schnell umzusetzen. Gelingt es ihnen nicht, kommt das Geld dadurch erst nach und nach in den Wirtschaftskreislauf, würde die Inflation langsamer steigen.
Was bedeutet das Finanzpaket für Rentner?
Sind Verteidigungsausgaben von der Schuldenbremse ausgenommen, wird Geld im normalen Haushalt frei. Einen großen Posten nehmen die jährlichen Ausgaben von mehr als 100 Milliarden Euro für die gesetzliche Rentenversicherung ein. Die Mittel aus dem Bundeshaushalt decken seit einigen Jahren gut 30 Prozent der Ausgaben der Rentenversicherung.
Sie dienen in erster Linie dazu, gesamtgesellschaftliche Leistungen wie die Anerkennung von Kindererziehungszeiten zu übernehmen. Sie gewährleisten aber auch, dass die Rentenversicherung angesichts des demografischen Wandels funktions- und leistungsfähig bleibt. Gäbe es sie nicht, müssten Arbeitnehmer deutlich höhere Beiträge zahlen.
Eine Entlastung des Bundeshaushalts durch eine Lockerung der Schuldenbremse führt dazu, dass die Bundesregierung die Zuschüsse zur Rentenversicherung leichter bereitstellen und der Beitragssatz stabil gehalten werden kann. Das ist umso wichtiger vor dem Hintergrund des Vorhabens, das Rentenniveau über 2025 hinaus bei 48 Prozent festzuschreiben. Denn das würde mit einer stärkeren Belastung der Beitragszahler einhergehen (mehr dazu hier).
- wdr.de: "Rüstungsaktien: Lohnt sich die Investition – und ist das moralisch vertretbar?"
- bpb.de: "Wieviel Staatsschulden können wir uns leisten?"
- x.com: Beitrag von @wolf_reuter
- finanztip.de: "Staatsanleihen: Wie sicher sind sie wirklich?"
- rentenupdate.drv-bund.de: "Bundesmittel für die Rentenversicherung"
- spiegel.de: "Union und SPD einigen sich auf Finanzpaket in Milliardenhöhe"
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa und Reuters
Quellen anzeigen