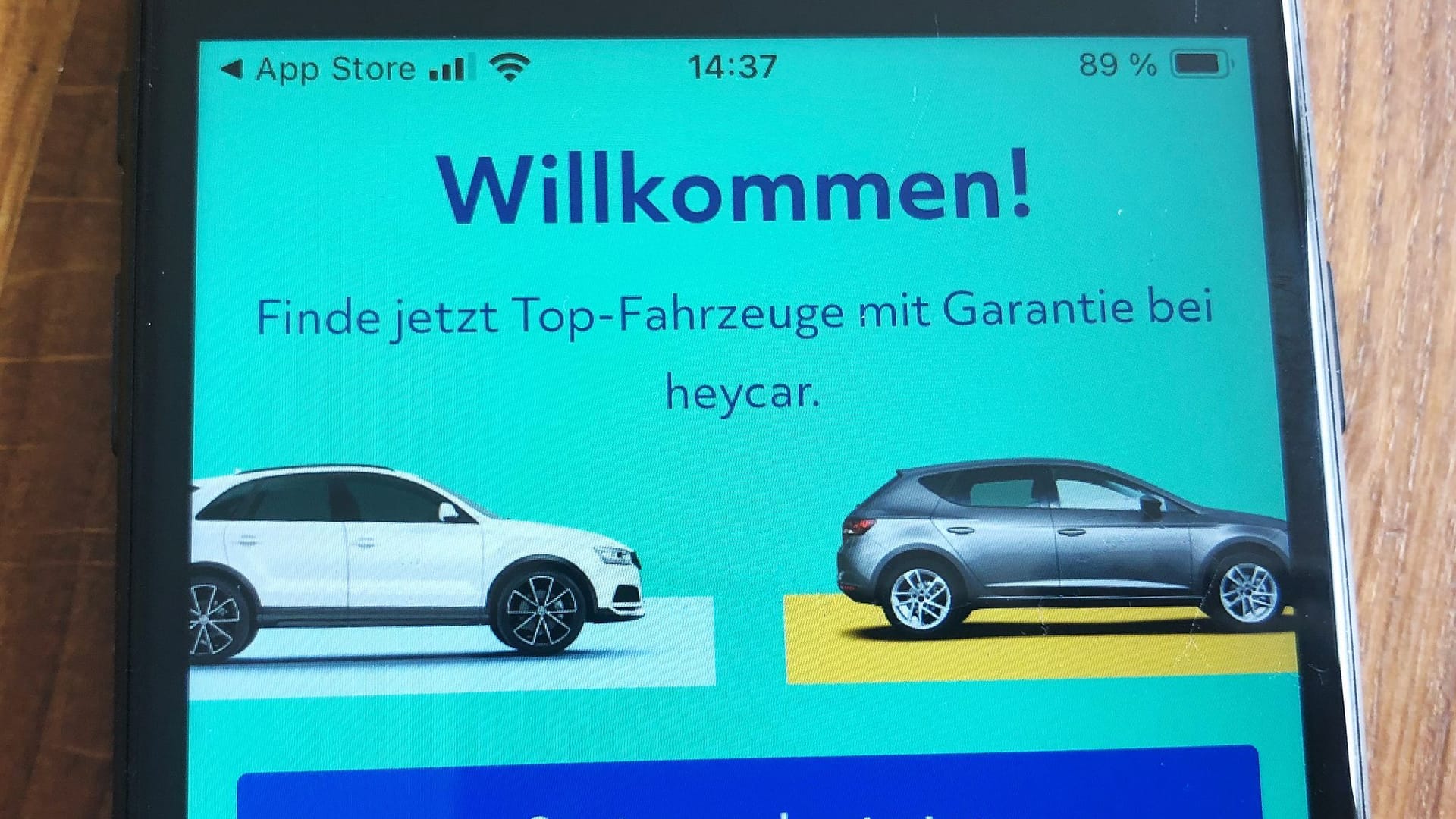Der Gesprächspartner muss auf jede unserer Fragen antworten. Anschließend bekommt er seine Antworten vorgelegt und kann sie autorisieren.
Zum journalistischen Leitbild von t-online.Skateboard-Pionier Titus Dittmann "Skateboarden kann Kinder davon abbringen, zum Gewehr zu greifen"


Als Skateboard-Pionier wurde Titus Dittmann bundesweit bekannt. Auch mit fast 70 steht er immer noch auf dem Board – unter anderem in Syrien und Afghanistan, wo Dittmann Kindern durch Skateparks neue Perspektiven eröffnen möchte. Dabei hat er einen ungewöhnlichen Ansatz.
Er brachte Skateboarden nach Deutschland, wurde zum europäischen Marktführer für Skateboards und Streetwear und veranstaltete Weltmeisterschaften: Titus Dittmann ist die zentrale Figur der deutschen Skateboarder-Szene.
- Lilly Stoephasius: Diese 11-Jährige ist Deutschlands beste Skateboarderin
Obwohl er am 8. Dezember seinen 70. Geburtstag feiert, steigt er noch regelmäßig aufs Board. "Allerdings nur sonntags zum Brötchen holen", wie Dittmann verrät. Zum Gespräch mit t-online.de bittet er in seinen Garten in Münster-Handorf – und kommt wie immer lässig wie ein 20-Jähriger daher: mit Jeans, T-Shirt und natürlich der obligatorischen Beanie-Mütze.
t-online.de: Herr Dittmann, Sie haben vor Kurzem in einem Interview verraten, dass Sie noch immer amtierender deutscher Meister im Skateboard-Hochsprung sind. Wie hoch sind Sie damals gekommen?
Titus Dittmann: Ich weiß gar nicht mehr, ob das wirklich Hochsprung war (lacht). Könnte auch Slalom gewesen sein. Das ist so lange her – irgendwann Ende der 1970er-Jahre. Aber das ist auch egal, denn es ist nur ein Gag, weil es danach keine offiziellen Meisterschaften mehr gegeben hat. Und: Damals gab es noch nicht so viele Skateboarder – wenn man da einigermaßen geradeaus fahren konnte, war man schon im Finale (lacht).
Und wie hoch sind Sie nun gesprungen?
Etwa 1,1 oder 1,2 Meter. Irgendwo in dem Bereich. Das war gar nicht so schlecht und lag wohl auch daran, dass ich damals Sport studiert habe.
Wie sind Sie denn überhaupt zum Skateboarden gekommen?
1977 am Aasee in Münster habe ich die ersten Jugendlichen auf Boards gesehen und war sofort begeistert. Als Lehramtsstudent habe ich sofort die soziologischen, pädagogischen Antennen gehabt und gemerkt, dass Skateboarden kein normaler "Sport" ist, sondern eher eine bewegungsorientierte Jugendkultur, die mit den Kids etwas Besonderes anstellt.
Was meinen Sie damit?
Ich habe die Begeisterung in ihren Augen gesehen und die Leistungsbereitschaft, die intrinsische Motivation, dass jemand von sich aus Bock auf etwas hat. Darüber hinaus hat mich fasziniert, dass keine Lehrer und Erwachsenen dabei waren. Vielleicht auch, weil ich mich immer noch ein bisschen als Pubertierender fühle (lacht). Sonst wäre ich ja nicht so empfänglich dafür: An den Normen zu kratzen, alles ein bisschen anders zu machen, Opposition zu sein… dieses Bedürfnis, sich selber zu finden. Das geht beim Skateboarden wunderbar, weil man die Leistung nicht für jemand anderen bringt. Es findet wirklich selbstbestimmtes Lernen statt.
Können Sie das genauer erklären?
Es gibt selbst- und fremdbestimmte Sportarten. Der Fußball z. B. ist größtenteils fremdbestimmt – zumindest im Verein. Ein Trainer entscheidet, was trainiert wird und wer wo spielt. Skateboarden ist im Gegenteil dazu selbstbestimmt. Es gibt keinen Trainer. Man lernt durch Ausprobieren, guckt sich Sachen bei den anderen ab. Das hat eine enorme pädagogische Kraft und einen viel größeren Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung.
1977 überlegte die Bundesregierung trotzdem, Skateboarden zu verbieten. Aufgrund der angeblich hohen Verletzungsgefahr, hieß es damals. Als Referendar boten Sie an der Schule dennoch eine Skateboard-AG an. Wie haben Ihre Lehrer-Kollegen darauf reagiert?
Die haben mich, wie alle Erwachsenen, für nicht ganz zurechnungsfähig erklärt (lacht). Zumal ich in der Schülergruppe voll integriert war, obwohl ich fast 30 Jahre alt war und alle anderen 14 oder 15.
Dann hat sich die Sache entwickelt und Sie haben eine Firma für Skateboards und -zubehör gegründet…
… wobei das gar nicht bewusst geplant war. Die ersten Sachen haben wir bei uns zu Hause in der Küche verkauft und da ich damals als Beamter keinen Gewerbeschein beantragen durfte, hat das meine Frau 1978 gemacht. Ich bin kein Planer, auch heute noch nicht.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Facebook-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren Facebook-Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
In der Anfangszeit mussten Sie viel improvisieren, haben Boards teilweise in Ihrer Reisetasche aus den USA mit nach Deutschland genommen.
Es gab in ganz Deutschland kein vernünftiges Material und da bin ich einfach in die USA geflogen. Auf dem Rückweg habe ich die Boards zwischen meiner dreckigen Wäsche reingeschmuggelt – ohne Zoll, ohne Mehrwertsteuer. Damit es nicht zu teuer wurde, denn ich habe sie dann zum Originalpreis an meine Schüler weitergegeben. Die waren so begeistert vom Skateboarden und haben gesagt: "Titus, wir brauchen das und das, mach‘ mal." Und dann habe ich einfach gemacht.
Aber das war ja damals natürlich nicht so wie heute. Transatlantik-Flüge waren wesentlich teurer und als Referendar war Ihr finanzieller Spielraum sehr beschränkt, oder?
Ehrlich gesagt habe ich nicht groß nachgedacht, sondern mich einfach in den Flieger gesetzt (lacht). Natürlich war das damals teuer, aber ich habe die billigsten Stand-by-Flüge genommen, eine echte Schrottkarre gemietet, bei der ich durch die Beifahrertür oder durchs Fenster einsteigen musste und bin die Skateboardfirmen abgefahren – ohne Englisch zu können.
Letztlich entstand daraus der größte Skateboard-Handel Europas, durch den Sie viel Geld verdient haben, der Sie zwischenzeitlich aber auch fast in die Pleite getrieben hätte. Aber nochmal zurück zu Ihrer Zeit als Lehrer: Ist Skateboarden eigentlich als Schulsport geeignet?
Na klar, aber es sollte nicht als Pflichtfach eingeführt werden. So wie im Reck, Barren und Bodenturnen – das könnte alles genauso geil sein, wenn es nicht so eng reglementiert worden wäre. Wenn jeder turnen dürfte, wie er wollte, wäre das bestens geeignet, um die eigene Persönlichkeit zu entwickeln: Man könnte neue Bewegungen ausprobieren und sich dadurch ausdrücken. Natürlich droht auch Skateboardfahren, irgendwann ein ganz "normaler" Sport zu werden, wenn es zu sehr normiert wird. Ein Beispiel ist Skateboarden und Olympia: Das passt überhaupt nicht zusammen. Olympia wird Skateboarden nachhaltig verändern, die pädagogische, soziologische Kraft nehmen und es domestizieren.
Sie spielen darauf an, dass Skateboarden 2020 in Tokio erstmals olympisch sein wird.
Genau, aber hoffentlich ist Skateboarden so stark, dass es sich nicht zu sehr normieren und in die olympischen Strukturen pressen lässt. Vielleicht scheitert Olympia sogar daran. Das könnte passieren.
Was meinen Sie damit?
Erstmal ist das Ganze nur ein Test. Wer weiß, wie das überhaupt weitergeht? Die müssen ja bei den Spielen mit den Chaoten klarkommen (lacht). Ich selbst war ein Jahr lang "World Chairman" des Weltverbandes FIRS (Fédération Internationale de Roller Sports) und habe bei Vorbereitung auf die Olympischen Spiele mitgearbeitet. Die Offiziellen haben nämlich gemerkt, dass sie gar keine Ahnung davon haben. Skateboardern ist, wie bereits angedeutet, immens wichtig, dass sie nicht fremdbestimmt werden. Das Board ist nicht nur ein Sportgerät, mit dem man Wettkämpfe gewinnen will, sondern ein Ausdrucksmittel der eigenen Persönlichkeit. Meine Hoffnung war, dass das Internationale Olympische Komitee (IOC) versteht, dass Skateboarden deshalb nicht behandelt werden kann wie eine normale Sportart und so organisiert wird.
Konnte das IOC Ihre Bedenken nachvollziehen?
Nein, ganz und gar nicht. Irgendwann habe ich gemerkt, dass es gar nicht um Sport geht – und um die Grundgedanken von Olympia. Es ist einfach ein riesengroßes Business. Olympia braucht Skateboarden – zum Beispiel wegen den jungen Zuschauern. Deshalb sind BMX oder Snowboarden schon seit Jahren olympisch. Und 2020 kommt eben Skateboarden dazu. Aber Skateboarden braucht Olympia nicht. Mittlerweile gibt es bei Meisterschaften Dopingkontrollen. Da lachen wir uns alle kaputt…
Bei den Snowboardern gibt es immer mal wieder positive Tests, vor allem auf Cannabis. Wird das bei den Skateboardern ähnlich sein?
Bei Doping geht es prinzipiell um Leistungssteigerung. Aber Skateboarder nehmen ja meistens Sachen, die die Leistung nicht steigern, sondern eher schwächen. Nur weil die Einen kiffen und das illegal ist, sollen sie gesperrt werden? Das kann ich nicht nachvollziehen, zumal Alkohol legal ist. Also dürften die Jungs besoffen antreten, aber nicht eine Woche vorher gekifft haben (lacht und schüttelt den Kopf)…
… wobei diese Regeln der Welt-Anti-Doping-Agentur natürlich auch für alle anderen Olympioniken gelten. Davon abgesehen: Sind vor der Olympia-Premiere 2020 also mehrere Dopingfälle im Skateboarding zu erwarten?
Wir werden es sehen. Bei Olympia kommt jedenfalls ein unglaublicher kommerzieller Faktor mit rein, der nicht zu unterschätzen ist. Mir persönlich könnte jemand eine Million Euro bieten und ich würde trotzdem sagen: Ich will Skateboarden lieber nicht bei Olympia sehen. Aber es macht natürlich etwas aus, ob Jungs, die sich ihr ganzes Leben darauf konzentriert haben, auf einmal als Profis davon leben können. Aus deren Sicht verstehe ich es natürlich.
Apropos Profis: Gibt es Deutsche, die 2020 um Medaillen mitfahren könnten?
Nein. Nach wie vor sind Amerikaner, Japaner, auch Brasilianer dominierend. Früher war es noch so, dass jeder gute Europäer, der vom Skateboarden leben wollte, in die USA ausgewandert ist – und dann irgendwann als Amerikaner gestartet ist. Aber daran sieht man schon: Der Trend ist, dass Leute, die davon leben wollen, dahin gehen wo die Kohle ist.
Zu einem ganz anderen Thema: Seit 2012 bieten Sie den Workshop "Skaten statt Ritalin" für Kinder mit einer diagnostizierten Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) an. Worum geht es genau?
Zweimal in der Woche können Kinder mit ADHS, oft auch "Zappelphilipp-Syndrom" genannt – bei uns in Münster unter Anleitung kostenlos skaten. Im Endeffekt haben sie ja nur das, was jeder Mensch hat – aber in gewissen Bereichen etwas ausgeprägter. Und deshalb werden sie mit Ritalin behandelt. Teilweise bekommen aber auch gesunde Kinder Ritalin, weil sie sich aufgrund der eigentlich ganz normalen kindlichen Unruhe nicht "erwachsen" genug verhalten. Und dagegen kämpfe ich! Natürlich gibt es knüppelharte Fälle, wo das ADHS ganz extrem und Ritalin notwendig ist.
- ADHS-Medikament: Ist Ritalin ein Wundermittel oder Kokain für Kinder?
- Redefluss und Tagträume: ADHS bei Mädchen oft anders als bei Jungs
- ADHS: Das sind die Symptome von ADHS je nach Alter
Aber es gibt eben auch einen hohen Missbrauch des Medikamentes. Der Verbrauch von Ritalin ist von jährlich wenigen Kilogramm auf über 1,5 Tonnen gewachsen. Es werden täglich 200.000 Ritalin-Dosen an Kinder verabreicht. Täglich! Dabei reicht bei Kindern, die nur ganz kleine Ansätze von ADHS aufweisen, oft schon ein bisschen mehr Bewegung. Das Problem ist, dass es keine Ventile mehr gibt. Da darf man sich nicht wundern, dass die Depressions- und ADHS-Quoten bei Kindern die höchsten sind, die es je gab. Deshalb kam vor einigen Jahren ein auf ADHS spezialisierter Arzt auf mich zu und schlug vor, für die Kinder Skateboarden anzubieten. Und das machen wir jetzt seit sechs Jahren – mit teilweise tollen Ergebnissen. Da sagen Eltern: "Unfassbar, ich hätte das nicht für möglich gehalten. Mein Sohn macht nach dem Skaten plötzlich Hausaufgaben."
"Skaten statt Ritalin" ist ein Projekt Ihrer 2009 gegründeten Stiftung "skate-aid". Mit dieser engagieren Sie sich auch in Krisengebieten wie Afghanistan oder Syrien, bauen dort z. B. Skateparks – auf den ersten Blick ja eine sehr ungewöhnliche Idee. Wie sind Sie darauf gekommen?
Ich habe mich zwar schon immer gesellschaftlich engagiert, dachte aber lange, dass Skateboarden ein urbaner, westlicher Sport ist, der nur in westlichen Gesellschaftsformen und in Städten funktioniert. Bis ich 2008 im "Spiegel" einen Artikel über den Australier Travis Beard gelesen habe, der mit einem Kumpel im zerstörten Kabul eine Skateboard-Schule gegründet hat. Das hat mich wie ein Blitz getroffen. Da wusste ich: Skateboarden kann noch mehr, es kann Frieden stiften, Völker zusammenbringen – und Kinder davon abbringen, zum Gewehr zu greifen. Ich habe mit den Jungs gesprochen und bei ihnen mitgemacht. Ein Jahr war ich Teil dieser Gruppe und bin auch nach Afghanistan gereist.
Wie war es, als Sie das erste Mal rüber geflogen sind?
Das war ein komisches Gefühl. Gerade weil in den deutschen Medien so viel über die schwierige Sicherheitslage berichtet wurde. Dann habe ich Statistiken gewälzt und festgestellt, dass es teilweise gefährlicher ist, in Deutschland Rad zu fahren, weil dabei mehr Menschen sterben als durch Bombenanschläge in Afghanistan. Tja, so habe ich die Jungs in Kabul besucht und war begeistert davon, was Skateboarden mit den Kids dort macht – welches Leuchten sie dabei in den Augen hatten. Wenn die Kids nichts anderes kennen als Krieg und Anerkennung dafür bekommen, dass Sie zum Gewehr greifen, tun sie das natürlich. Wir versuchen, das Gewehr durch das Skateboard zu tauschen. Ein Werkzeug, mit dem sie sich abgrenzen, ihr eigenes Ding machen und Anerkennung bekommen. So kann das Skateboarden in dieser ganz wichtigen Orientierungsphase ihr Wertesystem positiv beeinflussen. Deshalb habe ich ein Jahr später die Stiftung gegründet. Seitdem haben wir weltweit etwa 30 Skateparks gebaut – etwa in Afghanistan, Ruanda oder im Westjordanland. Dabei arbeiten wir immer mit Partnern zusammen, z. B. den SOS-Kinderdörfern. Mit denen ist aktuell ein Skatepark in einem Vorort von Damaskus in Syrien geplant.
Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Youtube-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren Youtube-Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Syrien kannten Sie schon vorher, oder?
Stimmt, um mein Studium zu finanzieren, habe ich in den 1970er-Jahren einen LKW dorthin überführt. Da waren alte Mercedes Heckflossen drauf. Ich bin ohne zu schlafen rübergefahren – zwei Tage durch – und angehalten wurde nur zum Tanken. Im Libanon brach damals Krieg aus. Und weil uns die Pässe abgenommen wurden, saßen meine Frau und ich auf dem Marktplatz der syrischen Hafenstadt Latakia fest. Wir haben tagelang im LKW gepennt und unsere Toilette war zwischen der Hinterachse (lacht).
Und nun sind sie über 40 Jahre später zurückgekehrt nach Syrien, obwohl das Auswärtige Amt vor Reisen dorthin warnt…
Genau, aber ich bin natürlich auf Einladung der SOS-Kinderdörfer nach Damaskus gereist. Dort gibt es vier oder fünf Kinderdörfer, von denen die meisten eher Auffangstationen sind. Da sind Kinder, die ihre Eltern verloren haben und von der syrischen Armee gefunden wurden. Viele sind traumatisiert. Da habe ich wirklich schlimme Sachen gesehen. Aber ich hatte auch die Chancen, in ein Leben hineinzugucken, das in Deutschland kaum thematisiert wird. Nämlich die einigermaßen heile Welt in Damaskus, fernab der Front. Ich war überrascht, wie ruhig es dort war. Natürlich hat man überall noch Einschusslöcher und zerstörte Gebäude gesehen. Aber es war friedlich, mit unheimlich netten und gastfreundlichen Menschen – das hat mich an damals erinnert.
► Mehr Infos finden Sie auf der Website von "skate-aid".
► Crowdfunding-Kampagne für Skatepark in Syrien
- Deutschlandfunk Dittmann: "Schade, dass Skateboard olympisch wird" (Audio-Interview)
- Westfälische Nachrichten Skateboard-Pionier Titus Dittmann im Interview
- Spiegel Online Skate-Pionier Dittmann: Board to be wild (Video)
- Zeit Online Dittmann: "Skateboarden wirkt sinnstiftend"
- watson.de Mit diesem Run wurde eine 11-Jährige Deutschlands beste Skateboarderin
Quellen anzeigen