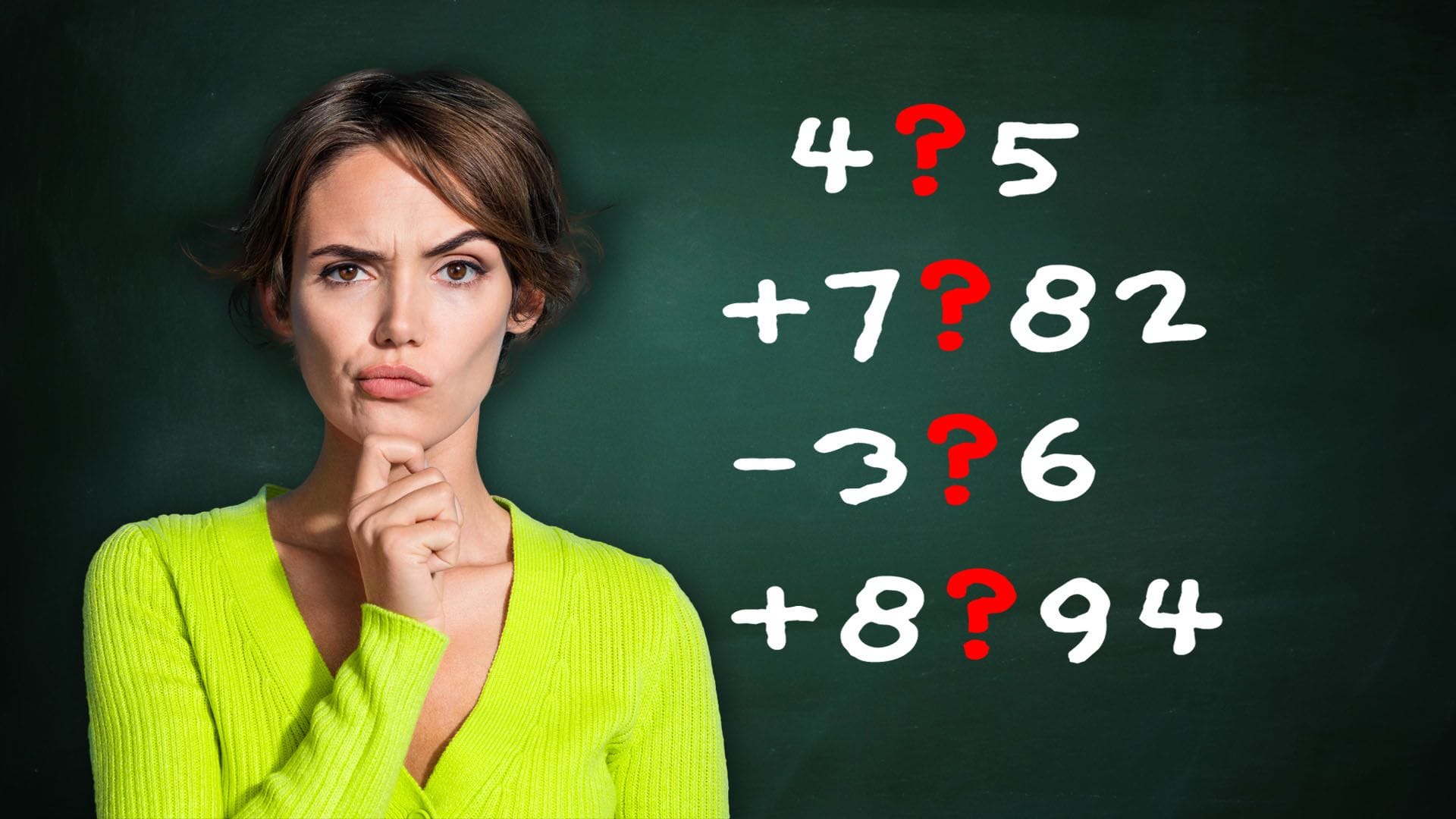Der Gesprächspartner muss auf jede unserer Fragen antworten. Anschließend bekommt er seine Antworten vorgelegt und kann sie autorisieren.
Zum journalistischen Leitbild von t-online.Streit um Krebsmedikamente "Täglich bekommen zehntausende Patienten abgelaufene Mittel"


Die Sicherheit von Krebsmedikamenten ist in Deutschland nicht immer gewährleistet. Das zeigten zuletzt mehrere Skandale.
Auf dem Milliardenmarkt der Krebsmedikamente gibt es zahlreiche Akteure, die Geschäfte zulasten der Patienten machen. Im jüngsten Fall in Brandenburg hatte das Unternehmen Lunapharm im Ausland gestohlene Krebsmedikamente hierzulande in Verkehr gebracht. Die Arzneimittel waren aber offenbar nicht korrekt gekühlt worden.
Einen vergleichbaren Fall gab es im nordrhein-westfälischen Bottrop. Anfang Juli wurde dort ein Apotheker vom Amtsgericht Essen zu zwölf Jahren Haft verurteilt, weil er zehntausende Krebsmittel bis zur Unwirksamkeit verdünnt hatte.
Dies seien keine Einzelfälle, sagt Enthüllungsjournalist Oliver Schröm. Er ist Chefredakteur des gemeinnützigen Recherchenetzwerks Correctiv. Über jahrelange Recherchen hat er zahlreiche Skandale rund um den Umgang mit Krebsmedikamenten aufgedeckt. Die Beteiligten sind Apotheker, Arzneimittelhersteller, Ärzte und Krankenkassen.
Chemotherapie:
Die Wirkstoffe dieser Behandlungsform nennen sich Zytostatika. Sie werden von Pharmafirmen an Apotheken oder sogenannte Herstellbetriebe geliefert. Dort werden sie individuell für den Patienten angemischt. Trägerstoff ist entweder eine Kochsalz- oder eine Glukoselösung. Der Wirkstoff wird damit verdünnt. Wie stark er verdünnt wird, hängt von Größe, Gewicht und Hautoberfläche des Patienten ab. Die Chemotherapie wird in der Regel in einen Infusionsbeutel gefüllt und damit Intravenös über eine Kanüle verabreicht.
Antikörpertherapie:
Diese neuere Krebstherapie basiert auf künstlich hergestellten Antikörpern, sogenannte monoklonale Antikörper. Das sind Eiweiße, die erkennen, wenn Zellen beispielsweise durch Krebs verändert sind. Die Antikörper können so die kranken Zellen gezielt bekämpfen. Diese Therapie wird auf gleiche Weise hergestellt, wie eine Chemotherapie. Die Infusionen mit den Antikörpern ist jedoch meist deutlich kürzer haltbar.
t-online.de: Herr Schröm, Sie haben herausgefunden, dass in der Krebsmedizin Medikamente verabreicht werden, die eigentlich nicht verabreicht werden dürfen. Was genau läuft hier schief?
Oliver Schröm: Täglich bekommen zehntausende Krebspatienten in Deutschland die Unsicherheit gespritzt. Denn sie erhalten Medikamente, die den Herstellerangaben zufolge abgelaufen sind – aber die Betroffenen wissen es nicht. Und ob die Mittel über die Haltbarkeitsangabe der Hersteller hinaus überhaupt noch wirken, ist unklar. Da wird kriminell hantiert. Die Haltbarkeiten sind dabei nur eine Facette. Ich bin seit 35 Jahren Journalist. Ich habe im Bereich der Krebsmedizin Methoden erlebt, wie betrogen, gelogen und korrumpiert wird. Es gibt Nummernkonten und Briefkastenfirmen und es fließen Millionen Bestechungsgelder. Das sind Vorgehensweisen und Verhaltensweisen, die kannte ich bisher nur aus dem Mafiamilieu, bei Drogenhändlern und Waffenschiebern.
Was ist das Problem mit den abgelaufenen Krebsmitteln – wie kann es dazu kommen?
Kaum ein Apotheker hält sich an die Haltbarkeitsvorgaben der Herstellerfirmen. Krebsmedikamente werden auch nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums massenhaft verabreicht – teilweise auf Druck von Krankenkassen. Insbesondere die AOK, die größte Krankenkasse, verfolgt Apotheker gerichtlich, wenn sie sich weigern, auch abgelaufene Arzneien zu verarbeiten.
Aber es gibt doch ein Arzneimittelgesetz, das solche Vorgehensweisen verbietet.
Richtig! Aber es gibt Streit darüber, ob die Haltbarkeiten, die der Hersteller festgelegt hat, nicht zu gering sind. Denn Pharmafirmen wie Bayer, Novartis, Roche und Co. haben natürlich ein Interesse daran, möglichst viele ihrer Arzneimittel zu verkaufen. Und wenn die Haltbarkeit der Wirkstoffe nur kurz währt, verkaufen sie mehr. Die andere Seite, also Apotheken und Krankenkassen, argumentieren hier oft gegenläufig und sagen, die Mittel halten wahrscheinlich viel länger, ähnlich wie beim Joghurt. Sie verweisen dazu auf fragwürdige Studien.
Warum sind Krebsmittel häufig nur so kurz haltbar?
Grob erklärt gibt es zwei Arten von Krebstherapien: Auf der einen Seite die klassische Chemotherapie. Und auf der anderen Seite gibt es seit einigen Jahren die Behandlung mit monoklonalen Antikörpern. Da sind etliche "Blockbuster" auf den Markt gekommen, etwa Avastin und Herceptin – Wunderwaffen gegen Brustkrebs. Das sind Proteinprodukte. Und wie es nun mal mit Proteinprodukten ist, sind die sehr kurz haltbar und kippen dann irgendwann und sind schlicht nicht mehr zu gebrauchen. Und deshalb haben diese Mittel teilweise sehr kurze Haltbarkeiten. Wie lange die Wirkstoffe im Beutel nun wirklich stabil und der Inhalt hygienisch unbedenklich ist, ist ungeklärt. Es kann sein, dass sie noch wirken. Aber es kann auch sein, dass nicht.
Wie kommen die Herstellerfirmen zu ihren Haltbarkeitsvorgaben?
Wenn Pharmaunternehmen Krebsmedikamente entwickeln, müssen sie eine Medikamentenstudie durchführen und eine Zulassung bei der europäischen Arzneimittelbehörde beantragen. Die Pharmafirmen haben in ihrer Studie das Medikament geprüft, haben Stresstests durchgeführt: Wie lange ist es haltbar? Wie reagiert es auf Transporte? Welche Kühlketten müssen eingehalten werden? Die Details der Studie kennt nur der Hersteller und die Zulassungsbehörde.
Für eine bestimmte Zeit gewährleisten diese Firmen dann die Haltbarkeit ihrer Mittel. Darüber hinaus aber nicht. Deshalb kann man sich nicht einfach darüber hinwegsetzen, weil dann nicht mehr garantiert ist, dass die Mittel noch wirken. Apotheker und Krankenkassen verweisen jedoch auf sogenannte Alternativstudien, die genau das belegen sollen. Die waren aber nicht Grundlage für die Zulassung auf dem europäischen Arzneimittelmarkt.
Es gelten aber die Angaben der Hersteller.
Ja, eigentlich sollten die bindend sein. Die Haltbarkeit steht dann in den sogenannten Fachinformationen der Krebsmittel – das ist sozusagen der Beipackzettel. Und der gilt. Wenn das Zeug abgelaufen ist, muss es weggeschmissen werden. Weil es aber wahnsinnig teuer ist, landen auf diese Weise schnell Hunderttausende Euro im Müll. So hoch können die Kosten für eine Krebstherapie sein.
Warum setzt sich ausgerechnet eine gesetzliche Krankenkasse über diese Vorgaben hinweg?
Aus Kostengründen will man die abgelaufenen Medikamente nicht wegwerfen. Jedenfalls ist es gängige Praxis in Deutschland, dass Krebspatienten die offiziell abgelaufenen Mittel trotzdem bekommen. Und ob die Krebsmedikamente nach Ablauf der Haltbarkeit noch Wirkstoff enthalten, ist das eine. Ein weiteres Problem ist die Belastung der Medikamente mit Keimen. Unsere Recherchen haben gezeigt, dass die Infusionslösungen keineswegs immer steril sind. Je länger die Medikamente auf ihren Einsatz warten, desto stärker haben sich mögliche Erreger vermehrt. Schlimmstenfalls können Patienten so einen septischen Schock, also eine Blutvergiftung, erleiden und sterben.
Warum werden die Mittel nicht einfach dann verabreicht, wenn sie noch offiziell haltbar sind?
Die Wirkstoffe der Chemo- und Antikörpertherapie werden mit Kochsalzlösung oder Glukose in einem Infusionbeutel angerichtet, kurz bevor sie der Patient bekommt. Danach lässt sich bei manchen Medikamenten noch acht Stunden Haltbarkeit garantieren, bei anderen 24 oder 48 Stunden. In einer idealen Welt sollten die Mittel immer sofort verabreicht werden. Apotheker, die weit entfernte Praxen mit diesen Medikamenten versorgen, müssen also fast schon an diesen Haltbarkeiten schrauben – sie dehnen deshalb das rechtlich Mögliche aus und gehen auch darüber hinaus, um sich mehr Marktanteile zu sichern.
Wie müsste die tägliche Praxis aussehen, wenn es korrekt liefe?
Im Idealfall bestellt der Onkologe die kurz haltbaren Krebsmedikamente beim Apotheker erst dann, wenn er weiß, dass sein Patient gesundheitlich in der Lage ist, die Therapie zu verkraften. Er macht deshalb ein Blutbild von dem Krebskranken. Wenn die Werte okay sind, faxt er das Rezept an die nächstgelegene Apotheke. Die mischt dann die Infusion just-in-time an und liefert das Medikament in die Praxis. Der Patient bekommt dann innerhalb von zwei Stunden seine Therapie. In Wirklichkeit sieht es aber eben oft anders aus.
Warum, wie läuft es tatsächlich?
Wenn etwa ein Patient an einem Montagmorgen beim Arzt eine Antikörpertherapie bekommen soll und es sich um einen Wirkstoff handelt, der laut Hersteller nur acht Stunden haltbar ist, dann haben die Apotheken ein Problem. Denn sonntags wird nicht gearbeitet. Es ist daher üblich, das Mittel schon am Freitag vorzuproduzieren und trotzdem am Montag zu verabreichen.
Das entspricht dann aber nicht mehr den Vorgaben des Herstellers?
Genau. Apotheker und Ärzte bewegen sich deshalb im rechtsfreien Raum. Hinzu kommt: wenn vorproduziert wurde und der Patient nicht in der Lage ist, die Therapie zu machen, muss das Medikament vernichtet werden. Denn die Mittel werden ganz gezielt für den jeweiligen Patienten dosiert – und zwar unter anderem nach Größe und Gewicht. Bekommt der Patient zu wenig, wirkt das Mittel nicht, bekommt er zu viel, stirbt er womöglich daran.
Sind solche Fälle die einzigen Gründe, weshalb die Haltbarkeitsvorgaben nicht beachtet werden?
Nein. Der Markt für Krebsmedikamente wurde dezentralisiert. Das erschwert die Situation zusätzlich. Früher gab es genügend Zytostatika-Apotheken, die meist nah genug an den onkologischen Praxen gelegen waren, um die Mittel kurzfristig herzustellen und auch rechtzeitig innerhalb der Haltbarkeitsspanne zu liefern. Diese Apotheken wurden aber weitgehend vom Markt verdrängt. Inzwischen gibt es sogenannte Herstellbetriebe. Das sind Firmen, die riesige Mengen solcher Infusionsbeutel in halbindustrieller Fertigung produzieren. Den Wirkstoff erhalten sie von den Pharmafirmen. Es handelt sich sozusagen um Superapotheken.
Und wo sitzen diese Superapotheken?
Einer der Marktführer sitzt zum Beispiel in Hamburg. Er liefert aber bundesweit – bis nach Südbayern. Dieser Herstellbetrieb kann natürlich bei einem Medikament, dass nach Anreicherung nur acht Stunden hält, nicht bewerkstelligen, es rechtzeitig zu liefern. Also hat er ein Interesse daran, dass die Haltbarkeiten überzogen werden dürfen.
Wirtschaftliche Interessen und die Bedürfnisse der Schwerkranken stehen also in einem massiven Widerspruch.
Ja. Und es gibt noch einen weiteren Grund, warum Apotheker sich über die Haltbarkeitsvorgaben hinwegsetzen: Die Packungsgrößen. Die Pharmafirmen bieten meist Größen für mehr als einen Patienten an, etwa für zweieinhalb. Sobald die Packung jedoch angebrochen ist, müsste der Apotheker das Medikament schnell in Verkehr bringen. Kommt aber keine Bestellung vom Onkologen, bleibt der Apotheker drauf sitzen und muss es vernichten. Viele Apotheker scheuen sich davor, so viel Geld in den Sand zu setzen. Auch deshalb verabreichen sie es lange nach der Frist.
Welche Folgen hat es denn für den Apotheker, wenn er die Medikamente nicht verkauft?
Sobald ein Mittel verschrieben und vom Arzt bestellt wurde, müssen die Krankenkassen dem Apotheker die Kosten erstatten und er muss ein frisches Medikament anbieten. Das macht er aber häufig nicht. Die Apotheken sagen, der Wirkstoffhersteller setzt nicht nur die Haltbarkeitsfristen bewusst niedrig an, sondern fertigt zudem absichtlich große Packungen, damit immer ein Überschuss da ist. So rechtfertigen viele Apotheker, dass sie sich über die Haltbarkeitsvorgaben hinwegzusetzen. Sie definieren stattdessen selber eigene Haltbarkeiten, oft unter Berufung auf fragwürdige Alternativstudien. Das ist aber reine Willkür.
In welchen Größenordnungen bewegt sich der finanzielle Verlust?
Im Jahr 2016 mussten in deutschen Apotheken Krebsmedikamente im Wert von 65 Millionen Euro weggeworfen werden, weil die Haltbarkeit überschritten war. Auf den Kosten bleiben die Krankenkassen sitzen.
Aber wie ist es möglich, dass so etwas in Deutschland passiert, mit einem der modernsten Gesundheitssysteme überhaupt?
Genau das ist für mich der größte Skandal, der mir in den letzten Jahren im Gesundheitsbereich begegnet ist. Eigentlich weiß es die Gesundheitsbranche, aber niemand fasst dieses heiße Eisen an, weil es um wahnsinnig viel Geld geht. Hinterher, wenn den Betroffenen nicht geholfen wurde, weil das Mittel nicht mehr wirksam war, heißt es: Klar, der hatte ja Krebs und an Krebs kann man halt sterben. Da kommt niemand auf die Idee, zu fragen, ob es vielleicht am Medikament lag, weil es abgelaufen war. Im Nachhinein kann man es nicht mehr nachweisen, weil sich die Medikamente im Körper längst abgebaut haben. Das ist sowas von perfide. Ich beschäftige mich jetzt seit drei Jahren mit diesem Thema, aber wenn ich darüber rede, kriege ich jedes Mal die blanke Wut!
Oliver Schröm ist Chefredakteur des unabhängigen gemeinnützigen Recherchezentrums Correctiv, das Missstände in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft aufdeckt. Correctiv wird unter anderem von der Bundeszentrale für politische Bildung unterstützt. Das Recherchezentrum hat zuletzt bundesweit Aufsehen erregt mit seinen Enthüllungen über den Bottroper Skandalapotheker. Schröm ist Autor von mehreren Enthüllungsbüchern und wurde mehrfach für seine investigativen Recherchen ausgezeichnet.
Und die Patienten selbst sind machtlos?
Ja, denn der Krebspatient hat in Deutschland praktisch keine Lobby. Zum Glück gibt es immerhin wenige Ausnahmen. In Hessen beispielsweise. Dort sitzt eine Onkologin, die sich in ihrer Praxis rührend um ihre Patienten kümmert. Sie ist rund um die Uhr erreichbar. Diese Ärztin stellte plötzlich durch Zufall fest, dass die Medikamenten-Infusionen, die sie verabreicht, abgelaufen sind. Da gibt es eine Antikörpertherapie mit dem Namen Velcade, die Infusionslösung ist nach der Zubereitung nur acht Stunden haltbar.
Die Onkologin hat jedenfalls festgestellt, dass das auf der Spritze angegebene Haltbarkeitsdatum falsch sein muss, denn sie glich es mit dem Herstellungsdatum ab. Beides muss draufstehen: Das Herstelldatum und die Dauer der Haltbarkeit. Und sie stellte fest, dass das Medikament viele Tage alt war. Also war es wertlos.
Was hat die Apothekerin dann gemacht?
Sie hat sich beschwert, sowohl beim Hersteller als auch bei der AOK, weil der Patient dort versichert war. Aber die AOK hat von der Ärztin verlangt, dass sie die Medikamente weiter verabreicht, obwohl sie abgelaufen waren. Die Krankenkasse hat dabei auf eine Alternativstudie aus dem Ausland verwiesen, die ergeben haben soll, dass solche Medikamente möglicherweise auch länger halten. Und das mag ja sogar sein – unter Laborbedingungen. Aber die Ärztin widersprach und berief sich wiederum auf die Herstellerangaben, die seien gesetzlich bindend.
Wie hat die Versicherung darauf reagiert?
Die AOK schrieb in ihren E-Mails an die Ärztin, die mir vorliegen: Wenn Sie das jetzt nicht verabreichen, ist das unterlassene Hilfeleistung. Und wenn Sie andere Medikamente woanders herholen, dann müssen Sie die selber bezahlen. Im Grunde hat die AOK diese Ärztin gezwungen, ihren Patienten abgelaufene Medikamente zu verabreichen.
Welche Rolle spielen hier die Apotheker, die die Mittel herausgeben und teilweise selbst herstellen?
Es sind ja nicht alle Apotheker böse – im Gegenteil. Es gibt viele Apotheker, die gesagt haben, nein, wir schütten das weg, weil es abgelaufen ist und die Kassen müssen das zahlen. Die AOK hat die Erstattung der bereits verschriebenen Medikamente aber einfach verweigert oder sogar hinterher wieder Geld abgezogen, als sie gemerkt hat, dass Apotheker die Mittel entsorgt haben. Etliche Apotheker haben geklagt, laufen aber gegen juristische Wände. So lange läuft alles einfach so weiter. Es fehlt an richterlichen Entscheidungen in der letzten Instanz.
Wenn aber doch im Arzneimittelgesetz steht, dass Hersteller die Dauer der Haltbarkeit auf die Medikamente schreiben müssen, dann müssen diese doch auch rechtlich bindend sein, oder nicht?
Das ist das Problem: Es gibt keine klaren Vorgaben des Gesetzgebers. Es gibt niemanden im Bundestag oder im Gesundheitsministerium, der aufsteht und sagt: Das geht nicht!
Juristisch ist das eine Grauzone – eine Arbeitsgruppe aller 72 zuständigen Aufsichtsbehörden auf Länderebene hat sogar erlaubt, externe Stabilitätsdaten hinzuziehen, um die Haltbarkeit zu verlängern. Sie bleibt aber erstens vage, welche Laborstudien auch auf die Realität übertragbar sind, und sie ist auch kein gesetzgebendes Gremium. Für viele Apotheker ist dies dennoch ein Freifahrtschein, sich über die Haltbarkeitsdaten der Pharmakonzerne hinwegzusetzen. Die Haftung bleibt jedoch voll beim Apotheker. Und wenn er die externen Daten nicht heranzieht, riskiert er, von den Kassen in Regress genommen zu werden.
Kann man die Verantwortlichen nicht gerichtlich zur Rechenschaft ziehen?
Genau das ist das Problem: Es ist wie Mord ohne Leiche. Es muss ja ein nachweisbarer Schaden entstanden sein. Stellen Sie sich vor, sie haben Krebs und ihr Tumormarker geht nicht zurück, die Metastasen streuen. Jetzt müssen Sie aber den Beweis führen, dass das Medikament nicht gewirkt hat, weil es abgelaufen war. Niemand kann das beweisen. Es ist das perfekte Verbrechen: Apotheker, die abgelaufene Mittel trotzdem verkaufen, können nicht haftbar gemacht werden, weil niemand sie angreift. Und niemand greift sie an, weil man den Beweis nicht führen kann, dass der Krebs schlimmer geworden ist, weil das Medikament nicht gewirkt hat und dass das Medikament nicht gewirkt hat, weil es abgelaufen war.
Handelt es sich bei den Apothekern oder Ärzten, die hier kriminell handeln, um einzelne schwarze Schafe?
Das Geschäft mit Krebsmedikamenten ist ein Milliardenmarkt. Vier Milliarden Euro werden jährlich damit umgesetzt. In Deutschland gibt es 20.000 Apotheken, aber nur 200 davon dürfen Krebsmedikamente verarbeiten – sogenannte Zytostatika. Und diesen Milliardenmarkt teilen sich die rund 200 Zytostatika-Apotheken, zirka ein Dutzend Herstellerfirmen, rund 1.500 niedergelassene Ärzte und zirka 100 Pharmahändler. Da geht’s um wahnsinnig viel Geld. Zytostatika-Apotheker verkaufen nicht nur Hustensaft. Das sind überwiegend Multimillionäre. Und ich kenne nur wenige, die sauber arbeiten.
Gibt es keine unabhängigen Kontrollen, bei denen überprüft wird, ob die Haltbarkeitsvorgaben eingehalten werden?
Ich muss ehrlich sagen, ich war zu Beginn meiner Recherchen vor einigen Jahren naiv. Ich konnte mir so etwas nicht vorstellen. In Deutschland wird jede Pommesbude besser kontrolliert als sogenannte Zytostatika-Apotheken. Die werden nur alle drei bis vier Jahre überprüft und zwar nach Vorankündigung. Und da wird dann auch nicht kontrolliert, ob die Medikamente Wirkstoff enthalten, sondern da wird nur das Labor angeschaut, ob das hygienisch ist, oder ob da Hundehaare drin liegen.
Haben Patienten überhaupt irgendeine Handhabe gegen diese Missstände?
Ich habe in den vergangenen drei Jahren viele Krebspatienten kennengelernt und auch sehr viele sterben sehen. Durch meine Recherchen haben sich viele Kontakte entwickelt und Beziehungen aufgebaut. Da möchte man sich mal wieder für ein Interview treffen und dann kommt der Anruf, es geht nicht, weil er oder sie gestorben ist.
Krebspatienten haben Angst um ihr Leben. Wenn Sie die Diagnose Krebs haben – schlimmer geht’s eigentlich nicht. Sie sind psychisch gar nicht in der Lage, das alles kritisch zu hinterfragen: Woher kommt das Medikament, wo werden die Wirkstoffe vom Apotheker bestellt, halten die sich an die Vorgaben?
Der Patient ist also völlig allein gelassen?
Man kann nur hoffen, dass Angehörige kritisch werden. Denn ich bin sicher, sehr viele Apotheker kommen sofort ins Schwimmen, wenn die Frage käme: "Übrigens, ich hab gehört, dass es viele nicht so genau nehmen mit den Haltbarkeiten. Wie ist denn das bei Ihnen? Halten Sie sich an die Fachinformationen der Pharmahersteller?" Wenn Sie ein Auto kaufen, fragen Sie den Autohändler schließlich auch: "Wie viele Kilometer hat denn der schon drauf und stimmt der Tacho und wie hoch ist der Verbrauch?" Und das macht halt der Krebspatient nicht, weil er überhaupt nicht auf die Idee kommt, dass die Infusionen aus der Apotheke nicht mehr in Ordnung sein könnten. Aber auf die Ärzte und Apotheker können sich Krebspatienten nicht verlassen.
Was muss aus Ihrer Sicht jetzt passieren?
Die Politik muss verdammt nochmal aufwachen! Die Gesundheitsexperten kennen die Probleme und könnten klare gesetzliche Regelungen einführen, die Krankenkassen zwingen, dass diese bei den Abrechnungen überwachen, dass die Haltbarkeitsvorgaben eingehalten werden. Statt dass diese die Ärzte zwingen, abgelaufenes Zeug zu verwenden, weil sie Kosten sparen wollen. Oder, wenn tatsächlich belastbare wissenschaftliche Daten vorliegen, die eine längere Haltbarkeit in der Praxis garantieren, dann muss die Politik die Pharmakonzerne zwingen, ihre Fachinformationen der Realität anzupassen. Die Unsicherheit einfach so fortbestehen zu lassen, ist ein absolutes Unding! Es ist eigentlich so einfach, diese kriminellen Strukturen aufzulösen.
Und warum geschieht das nicht?
Die Anreize, sich an den lukrativen Verschreibungen zu bereichern, sind vor allem bei Krebsmedikamenten viel zu hoch. Wenn man wirksam verhindern will, dass immer wieder Ärzte, Apotheker und Händler diesen Versuchungen erliegen, dann muss die Politik endlich ihre Macht nutzen, die Preise für Krebsmedikamente wirksam zu verringern. Erst so wird sich dieser Sumpf trockenlegen lassen – nicht mit ein paar Kontrollen im Nachgang, das kommt alles nur einem Feigenblatt gleich.
Wir haben in Deutschland 1,5 Millionen Krebskranke und es werden immer mehr. Zynisch ausgedrückt, handelt es sich hier um eine Wachstumsbranche.
Oliver Schröm, ich danke Ihnen für das Gespräch.
- www.corretiv.org Recherchen zur Alten Apotheke
- eigene Recherche
- Die Informationen ersetzen keine ärztliche Beratung und dürfen daher nicht zur Selbsttherapie verwendet werden.
Quellen anzeigen