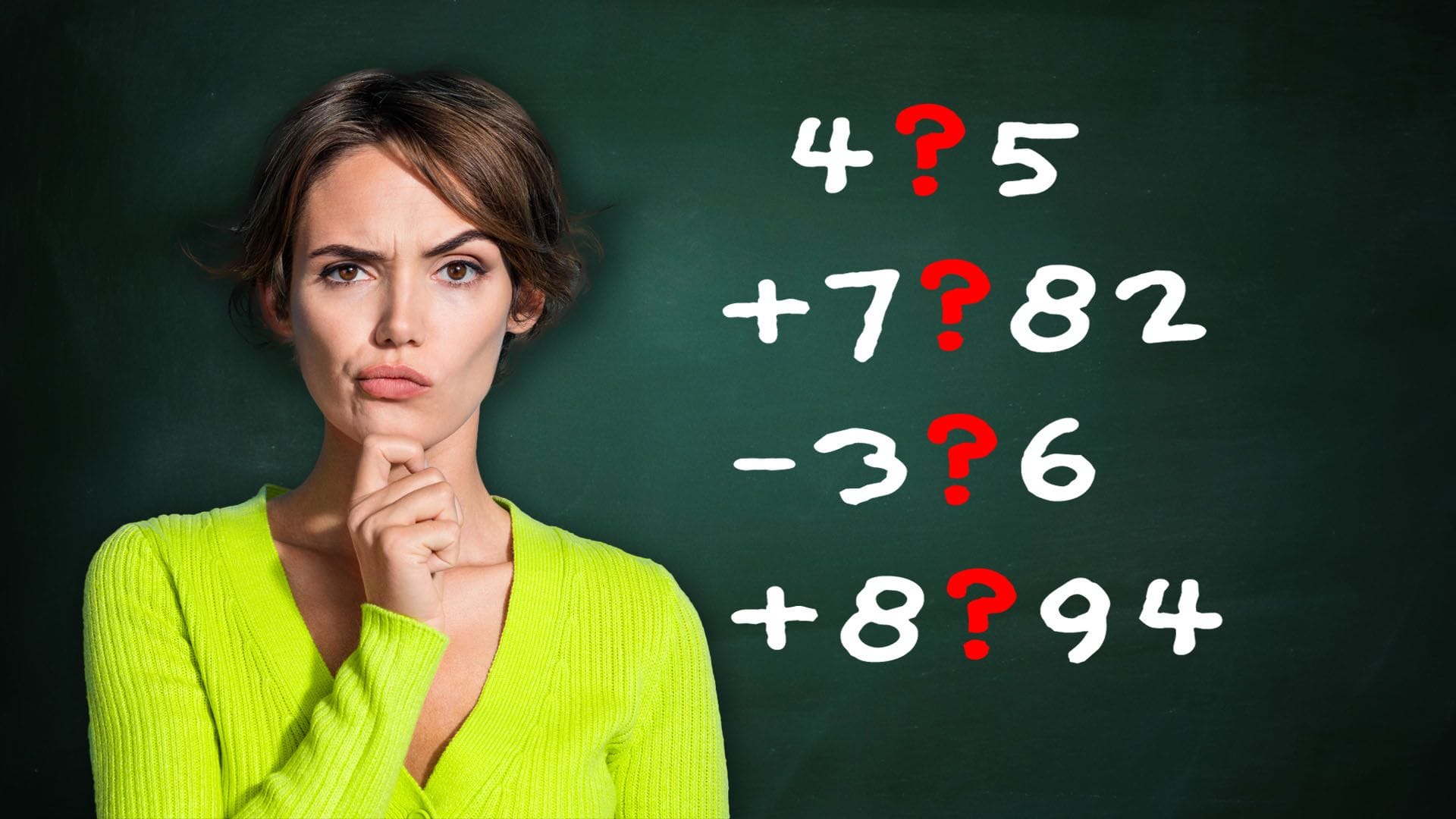Der Gesprächspartner muss auf jede unserer Fragen antworten. Anschließend bekommt er seine Antworten vorgelegt und kann sie autorisieren.
Zum journalistischen Leitbild von t-online.Psychologe über Todesangst "Ich hatte abends Angst, dass ich morgens nicht aufwache"


Manche Menschen entwickeln in ihrem Leben plötzlich und unbegründet eine Angst zu sterben. Was steckt dahinter? Wie kann man mit dieser Angst umgehen? Wofür kann diese Angst nützlich sein? Psychiater Jan Kalbitzer, den das Gefühl selbst vor einigen Jahren überkam, erklärt es im Interview.
Jan Kalbitzer traf es unerwartet in einem Hotelzimmer in München. In einem Moment, in dem eigentlich alles perfekt hätte sein müssen – es lief gut auf der Arbeit und mit dem ersten Kind und er hatte gerade einen Buchvertrag unterzeichnet – überkam ihn plötzlich eine Angst vor dem Tod. Er hatte das Gefühl, außerhalb seiner selbst zu stehen. "Oh Gott, hoffentlich ist das keine Krankheit", schoss es ihm durch den Kopf. Also machte sich Kalbitzer, der selbst als Psychiater arbeitet, auf die Suche, was hinter der Angst zu sterben steckt. Im Interview erzählt er von diesem Weg, verrät, wie ihm ein Sambakurs geholfen hat und was er aus der Erfahrung gelernt hat.
t-online.de: Wie hat sich Ihre Angst vor dem Tod nach dem Erlebnis im Hotelzimmer manifestiert?
Jan Kalbitzer: Es gibt viele verschiedene psychosomatische Wege, wie sich Angst ausdrückt. Manche Menschen haben Kopfschmerzen, andere haben Verspannungen im Nacken. Es kann auch den Magen-Darm-Trakt betreffen, sodass man Sodbrennen bekommt, Magengrimmen, Durchfall. Bei mir war es hauptsächlich Herzstolpern. Ich habe mich in die Symptomatik reingesteigert und bin zum Kardiologen gegangen. In der Zeit, in der ich diese Herzdiagnostik durchlaufen habe, hat sich meine Angst noch einmal vergrößert – ich hatte wahnsinnige Angst, dass da irgendetwas am Herzen sein könnte. Ich hatte abends Angst, dass ich morgens nicht wieder aufwache.
Hatten Sie Angst davor, dass Ihr Herz plötzlich nicht mehr schlägt oder vor großen Schmerzen oder um was für eine Art von Todesangst handelte es sich bei Ihnen?
Bei mir war es wirklich eine Angst davor, nicht mehr zu existieren, also nicht mehr da zu sein. Das ist diagnostisch ganz interessant, weil die Angst zu sterben, streng genommen, etwas anderes ist. Das ist die Angst vor dem Sterbeprozess an sich, davor, dass man Schmerzen hat. Viele ältere Menschen haben durchaus Angst vor einem unangenehmen Sterbeprozess. Sie haben aber, wenn sie sehr alt sind, gar nicht mehr so viel Angst vor dem Tod an sich und vor dem Nichtexistieren. Bei mir war aber die Angst vor dem Nicht-mehr-Existieren sehr stark. Das hat, wie der Psychiater Irvin Yalom mir erklärt hat, viel zu tun mit einem ungelebten Leben.
Können Sie das konkretisieren?
Man hat Angst davor, dass man aufhört zu existieren, bevor man Dinge gelebt hat, für die man sich bis dahin noch keine Zeit genommen hat, die aber noch wichtig sind, gelebt zu werden. Man hat Bedenken, dass man Teile des eigenen Potenzials noch nicht ausgeschöpft hat. Oder man will noch Zeit mit wichtigen Menschen verbringen, die man im Alltag immer wieder nach hinten schiebt.
Jan Kalbitzer, Jahrgang 1978, ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Er arbeitet als Psychotherapeut in seiner eigenen Praxis in Berlin.
Hat sich Ihre Angst nur auf Sie selbst bezogen oder auch auf die Menschen in Ihrem Umfeld?
Ich hatte auch immer mal wieder Angst um meine Kinder, wenn sie krank waren zum Beispiel. Aber das war keine Angst, dass sie sterben könnten. Diese Angst der Nichtexistenz hat nur mich betroffen. Da ging es wirklich um mein Leben und darum, ob ich meinem Leben gerecht werde.
Aber Sie haben sich auch damit auseinandergesetzt, welche Auswirkungen Ihre Nichtexistenz auf Ihre Familie hätte.
Ja, ich habe zum Beispiel die Rentenansprüche meiner Frau durchgerechnet. Wie viel hat sie und wie klappt es mit ihrem Einkommen, wenn ich nicht mehr da bin? Kann das alles finanziert werden? Oder müsste ich jetzt so schnell wie möglich noch etwas in die Rentenkasse einzahlen? Mit solchen Sachen habe ich mich ganz viel beschäftigt. Es ging bei meiner Sorge natürlich auch darum, was aus denen wird, die dann zurückbleiben.
Ihre Frau ist auch Psychotherapeutin. Was hat sie zu Ihrer Angst gesagt?
Sie hat mich darauf hingewiesen, dass in manchen Fällen hinter einer solchen irrationalen Angst auch ein Todeswunsch stecken kann. Das war bei mir der Fall – nicht so, dass ich unbedingt tot sein wollte. Aber ich war einfach überfordert mit einer Existenz, die unter so viel Druck steht und an die so viele Erwartungen herangetragen werden. Ich habe mich sehr eingeengt gefühlt und mir gewünscht, dass das alles irgendwie aufhört und ich befreit werde von diesen Zwängen. Das war eine wichtige Einsicht, weil ich mir so bewusst machen konnte: Ich kann diese Angst reduzieren, indem ich die Anforderungen an mich und an mein Dasein ein bisschen runterschraube.
Wie ist Ihnen das gelungen?
Ich habe mir klar gemacht: Erstens bin ich gar nicht so wichtig. Und zweitens: Für die Menschen, für die ich wirklich wichtig bin – das sind ja gar nicht viele –, möchte ich so viel wie möglich da sein.
Vor dieser Erkenntnis haben Sie sich viel mit Ihrer Angst auseinandergesetzt. Sie haben dabei ganz viel ausprobiert: mit einem Pastor gesprochen, sich in Therapie begeben, einen Sambakurs besucht. Was hat Ihnen am meisten geholfen?
Ich dachte natürlich, dass mir Psychotherapie am meisten helfen würde. Die hat mir auch geholfen. Aber am meisten geholfen hat mir überraschenderweise der Besuch bei einer Osteopathin – und das, obwohl ich Wissenschaftler bin und nur sehr bedingt an Osteopathie glaube. Sie hat irgendwie einen Herzpunkt von mir berührt und dadurch habe ich geweint, wie ich noch nie in irgendeiner Psychotherapie geweint habe. Mir hat aber ebenso ein Glas Wasser mit einer Scheibe Zitrone geholfen, das mir die Krankenschwester in der Herzpraxis, in der ich untersucht wurde, gebracht hat. Diese kleine Aufmerksamkeit hat wahnsinnig viel für mich bedeutet.
Warum? Was steckte dahinter?
Ich glaube, es war der Prozess, Hilfe annehmen zu können und nicht mehr das Gefühl zu haben, alles selbst lösen zu müssen. Zu wissen, dass da Menschen sind, die mir auf eine Art und Weise helfen, die ich nie erwartet hätte. Gerade in der Lebensmitte geht es oft auch darum, dass man den Kontrollverlust akzeptiert. Es kommt so viel zusammen: die Familie, die Karriere, die Eltern, die möglicherweise pflegebedürftig werden. All das erzeugt einen wahnsinnigen Druck. Man lernt in einer solchen Zeit, dass man die Kontrolle eigentlich nie hatte, dass man nur eine Illusion davon hatte, sein Leben irgendwie planen oder kontrollieren zu können. Aber eigentlich ist das gar nicht der Fall.
Sie haben sich auf Ihrer Suche auch in einen Sambakurs begeben. Wie kommt man denn darauf, dass einem bei Todesangst ein solcher Kurs helfen könnte?
Ich habe auch mit Freunden und Kollegen über meine Angst gesprochen. Viele von ihnen meinten, ich hätte eine Midlifecrisis. Daraufhin habe ich angefangen, die Sachen zu machen, die man in einer Midlifecrisis eben so macht: Ich habe mir eine teure Uhr gekauft und teure Schuhe. Und ich wollte irgendwas Verrücktes machen, also habe ich den Sambakurs gebucht. Und das war eine der besten Entscheidungen, die ich treffen konnte! Die Uhr war übrigens eine eher dumme Entscheidung. Viel besser als jeder Sportwagen ist in einer solchen Zeit ein persönlicher Fitnesscoach, der einen antreibt, sich zu bewegen. Oder ein Yogalehrer. Oder eben ein Sambalehrer. Körperliche Bewegung, bei der man sich ein bisschen von seinem Geist und dem Gefühl der intellektuellen Kontrolle lösen kann, ist hilfreich.
In welchem Alter oder in welchen Phasen tritt Todesangst am häufigsten auf?
Es gibt sehr unterschiedliche Phasen. Ein typischer Zeitpunkt ist die Kindheit. Wenn Umbrüche stattfinden, wenn eine wichtige Bezugsperson stirbt wie etwa ein Großelternteil und man gerade empfindlich ist, zum Beispiel weil es in der Schule schwierig ist, dann können in der Kindheit solche Ängste zu sterben auftreten. In der Lebensmitte ist ein weiterer typischer Zeitpunkt, zu dem diese Angst oft auftritt, so wie es bei mir der Fall war. Und natürlich im Alter, wenn man merkt, dass die Fähigkeiten immer stärker nachlassen, wenn man vergesslich wird und die Menschen um einen herum sterben.
Trifft diese Angst vor dem Tod jeden Menschen einmal?
Es trifft nur einen Teil der Menschen. Wie viele das prozentual sind, kann ich nicht genau sagen. In meinem Umfeld waren es ungefähr 70 Prozent – wenn ich so die Therapeuten um mich herum, die Kita- und Schuleltern und wer mir so zwischen die Finger kam, gefragt habe. Aber Studien gibt es dazu meines Wissens nicht, weil es auch ein schambesetztes Thema ist, über das nicht so viel gesprochen wird.
Würden Sie jedem, der Todesangst bekommt, raten, sich professionelle Hilfe zu holen?
Da bin ich hin- und hergerissen. Einerseits denke ich, dass wir Psychiater viel mehr in die Präventivmedizin gehen sollten. Viele Menschen haben ganz lange Stress und bekommen dann irgendwann eine Depression und Stoffwechselstörungen und Bluthochdruck. Wenn sie fünf Jahre eher zum Psychiater gegangen wären, dann hätte er ihnen sehr gut helfen und das verhindern können. Präventive Psychiatrie fehlt uns total.
Und andererseits?
Andererseits sind Psychiater und Psychotherapeuten sehr überlaufen in unserer Gesellschaft. Wir erklären mittlerweile sehr viele Lebensumstände für psychisch krank, und das können wir nicht alles abfangen. Man kann über die Angst vor dem Tod auch gut mit guten Freunden oder der Familie sprechen oder mit einem Pfarrer oder mit jemandem, dem man vertraut. Es ist nur wichtig, nicht irgendwelchen Gurus hinterherzulaufen, die es möglicherweise ausnutzen und dadurch Geld verdienen. Zum Psychiater sollte man aber gehen, wenn man über einen längeren Zeitraum eine sehr niedergeschlagene Stimmung hat, sehr wenig Antrieb. Wenn man nicht mehr dazu kommt, die Dinge im Alltag zu tun, die man tun möchte oder tun müsste. Oder wenn man keine Freude mehr empfinden kann. Denn das sind die Hauptsymptome einer Depression.
Es ist jetzt schon ein paar Mal angeklungen: Wie kann man die Angst vor dem Tod für sich selbst nutzen?
Man kann anfangen, sie als Kompass zu nutzen. Man kann darauf achten, wann sie besonders stark auftritt. Was sind das für Situationen? Was will mir die Angst in solchen Momenten sagen? Mir ist wichtig, dass man das, wenn man damit unerfahren ist, nicht allein macht. Man sollte sich Unterstützung holen, weil man weiter reinrutschen und Depressionen entwickeln kann. Bei mir war es zum Beispiel oft eine klassische Situation: Morgens auf dem Weg zur Arbeit, wenn ich die Kinder noch anziehen und sie irgendwo abliefern musste und ich ungeduldig geworden bin, ist bei mir plötzlich das Herz gestolpert. Das hatte einfach damit zu tun, dass ich keinem meiner Ansprüche gerecht werden konnte. Ich wollte pünktlich bei der Arbeit sein. Ich wollte erfolgreich sein. Ich wollte die Kollegen nicht enttäuschen. Gleichzeitig wollte ich ein liebevoller Vater sein – und das ging nicht alles auf einmal. Die Symptome haben mir gezeigt: Das ist eine wichtige Situation, die ich mir ganz gezielt angucken und ändern muss.
Sie haben über Ihre Erfahrungen das Buch "Das Geschenk der Sterblichkeit" geschrieben. Es trägt den Untertitel: "Wie die Angst vor dem Tod zum Sinn des Lebens führen kann". Haben Sie den Sinn für sich entdeckt?
Ein erfülltes Leben entwickelt sich für mich in dem Kontakt mit wichtigen Menschen. Ich muss gar nicht sagen: Das oder das ist mein Lebenssinn. Sondern der Sinn entsteht von allein, wenn ich mit den Menschen um mich herum Zeit verbringe. Oder wenn ich die Schönheit meiner Umwelt bewusst wahrnehme. Eine Technik dafür ist das Zu-Fuß-gehen. Dadurch entschleunigt sich das ganze Leben. Man muss sich viel bewusster entscheiden, wo man hingeht. Man begegnet viel bewusster anderen Menschen. Und man ist auch nicht so gestresst, als wenn man Auto fährt.
Tritt die Angst bei Ihnen heute noch auf?
Ja, ich habe sie noch manchmal. Aber sie ist viel, viel schwächer geworden. Wenn sie kommt, frage ich mich: Was willst du mir sagen, Angst? Wo muss ich gerade wieder hingucken in meinem Leben? Manchmal muss ich die Dinge auch einfach aushalten und akzeptieren, dass ich sie gerade nicht ändern kann.
Zu Ihrer Angst vor dem Tod haben Ihnen viele verschiedene Menschen viele verschiedene Erklärungsansätze geliefert. Wie erklären Sie sich die Angst im Rückblick selbst?
Ich glaube, dass ich mich verrannt hatte in meinem Leben. Zum einen habe ich mich zu wichtig genommen. Ich hatte die Vorstellung, dass Dinge nur dann funktionieren, wenn ich mich um sie kümmere. Dass ich gebraucht werde, um sie zu lösen. Ich glaube, das ist ein Phänomen unserer Gesellschaft. Wir laden alles mit einer wahnsinnigen Bedeutung auf, weil wir sonst den ganzen Stress ja auch nicht mitmachen würden. Und so habe ich an mir vorbeigelebt. Ich wollte zu dem Zeitpunkt akademische Karriere machen und ganz viele Dinge erreichen und gleichzeitig für meine Kinder ganz viel da sein. Das geht aber nicht alles gleichzeitig. Ich musste mich da entscheiden – und das habe ich getan.
Wie lautet Ihre Entscheidung?
Meine Entscheidung ist, dass ich, solange die Kinder klein sind, keine Karriere mache. Keine Ahnung, was ich danach mache. Aber man muss auch nicht alles sofort entscheiden. Und man muss auch nicht alles in einem Leben erledigen. Man kann zum Beispiel an die Reinkarnationen glauben und sagen, einen Teil mache ich im nächsten Leben. Oder man kann das Leben als eine Art Staffellauf betrachten: die Generation vor mir hat einiges erreicht. Ich lege einen Teil der Strecke zurück. Und die Generation nach mir wird einen anderen Teil der Strecke zurücklegen.
- Immer weniger Särge: Stirbt der klassische Friedhof bald aus?
- Vormund benennen: Wie Eltern für ihren Tod vorsorgen können
- Richtige Worte finden: So können Sie Ihrem Kind den Tod erklären
- Wenn Kinder sterben: "Manchmal ist es eine Art Befreiung"
Sie haben ganz am Anfang gesagt, dass diese Angst auch ein bisschen darauf aufmerksam machen wollte, welche Dinge sie noch leben oder erleben wollen. Was ist das denn in Ihrem Fall?
Es gibt ja Leute, die haben so Checklisten, was sie in ihrem Leben so alles machen wollen. Das habe ich nicht. Ich möchte einfach so viele Tage wie möglich liebevoll verbringen mit den Menschen, die mir wichtig sind. Das macht für mich letztendlich ein erfülltes Leben aus. Was ich gerne noch erleben würde, ist zudem das Großelterndasein. Das ist vermutlich der glücklichste Zustand des Lebens: kleine Kinder, denen man zugucken kann, wie sie spielen und aufwachsen, ohne sich jede Nacht um sie kümmern zu müssen, wenn sie aufwachen oder Fieber haben.
Vielen Dank für das Gespräch, Herr Kalbitzer.