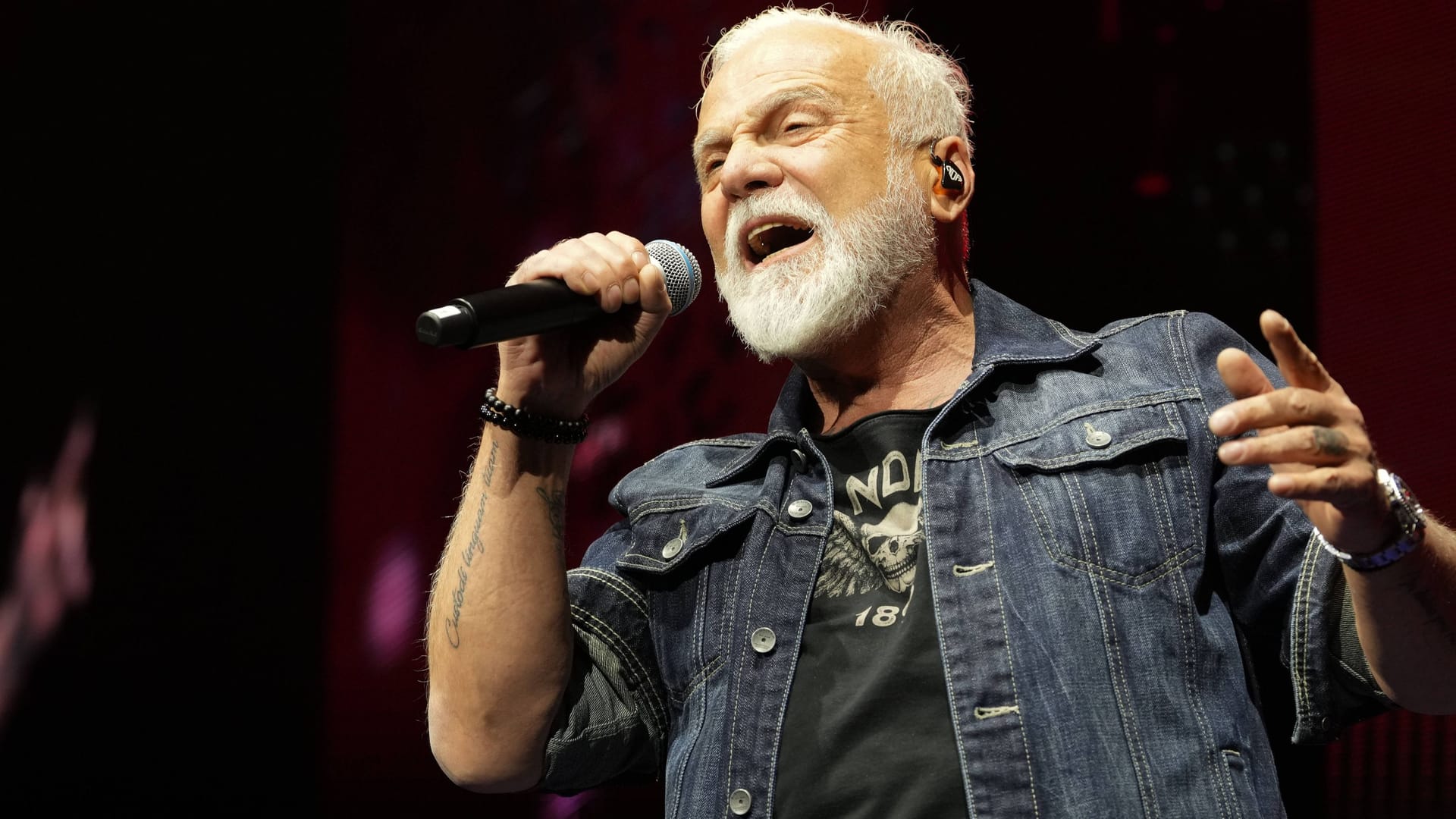Mehr als 150 Journalistinnen und Journalisten berichten rund um die Uhr für Sie über das Geschehen in Deutschland und der Welt.
Zum journalistischen Leitbild von t-online.America First, Deutschland zuletzt? Wird Trump jetzt triumphieren?


Trump will am Mittwoch neue Zölle verkünden – Deutschland droht ein Wirtschaftsschock mit Jobverlusten und Exporteinbußen in Milliardenhöhe. Wie die EU reagieren könnte und welche Branchen besonders betroffen sein werden.
Inhaltsverzeichnis
- Was will Trump beschließen?
- Wie ist Deutschland davon betroffen?
- Welche Branche spüren die Auswirkungen am stärksten?
- Was können deutsche Unternehmen und die Politik nun tun?
- Welche Optionen liegen auf dem Tisch?
- Welche Risiken bestehen dabei?
- Warum wollen die USA die Zölle erhöhen?
- Was steht für die USA auf dem Spiel?
US-Präsident Donald Trump spricht von einem Tag der Befreiung, doch weltweit blicken Politiker und Wirtschaftsvertreter am Mittwoch mit Sorge nach Washington. Dann nämlich will Trump seine angedrohten Zölle in Kraft setzen.
Die Vorstellung der Zölle ist für 16 Uhr in Washington angesetzt (22 Uhr deutscher Zeit) und somit nach Handelsschluss an der New Yorker Börse. Nach Angaben von Trumps Sprecherin sollen die Zölle dann auch unmittelbar gelten.
t-online gibt einen Überblick über die wichtigsten Fragen.
Was will Trump beschließen?
Das ist auch wenige Stunden vor der Vorstellung nicht komplett bekannt. Am Dienstagabend gestand das Präsidentenbüro, dass noch an den Details gefeilt werde. Bislang blieb Trump vage.
Mehrfach hat er allerdings betont, dass sogenannte reziproke Zölle eingeführt werden sollen, um zu verhindern, dass Handelspartner die USA "abzocken". Gemeint ist damit, dass die USA ein importiertes Produkt mit ebenso hohen Aufschlägen belasten werden wie ein gleiches US-Produkt bei Lieferung in dieses Land. Diese Ankündigung galt "allen Ländern".
Einzelne Länder könnten die USA aber auch mit höheren Zöllen belegen. Gegenüber Mexiko und Kanada hat Trump die Regeln bereits in Teilen verschärft. Auch China hat er bereits mit Sonderzöllen belegt. Im März folgten Zollaufschläge auf Stahl- und Aluminiumprodukte, von denen auch die EU und Deutschland betroffen sind.
Vergangene Woche kündigte Trump dann Zölle von zusätzlichen 25 Prozent auf EU-Autoimporte an. Diese sollen ab Donnerstag gelten. Bisher erheben die USA 2,5 Prozent auf Pkw aus der EU, aber bereits 25 Prozent auf Pick-ups und besonders schwere Autos. Im Gegenzug schlägt die EU bisher schon 10 Prozent Zoll auf Autoimporte aus den USA auf.
Wie ist Deutschland davon betroffen?
Das kommt stark auf die Ausgestaltung an. Sollten es tatsächlich nur reziproke Zölle werden, wäre Deutschland nicht allzu stark betroffen. Eine Berechnung des ifo Instituts geht davon aus, dass die deutschen Exporte um 2,4 Prozent sinken würden, sollten die USA wechselseitige Zölle erheben und die EU keine Gegenmaßnahme einläuten.
"Die Auswirkung von wechselseitigen Zöllen wäre für Deutschland jedoch wesentlich geringer als bei pauschalen US-Zöllen von 20 Prozent", sagt Handelsexpertin Lisandra Flach. Die Lücke der Zölle zwischen den USA und der EU sei relativ gering und läge über alle Produkte hinweg bei 0,5 Prozentpunkten. Nach Angaben der US-Regierung könnten bei der Kalkulation der Importaufschläge jedoch neben den in anderen Ländern geltenden Zöllen auch andere Faktoren wie Subventionen oder Regularien einbezogen werden.
Bei pauschalen Zöllen von 60 Prozent auf China und 20 Prozent auf den Rest der Welt hingegen sähe die Lage deutlich anders aus. Dann könnten die deutschen Exporte in die USA um 15 Prozent zurückgehen.
Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) hat berechnet, dass bei zusätzlichen Zöllen von 10 bis 20 Prozent bereits ein wirtschaftlicher Schaden in dreistelliger Milliardenhöhe droht. In einer Berechnung aus dem vergangenen Jahr kommt das Institut zudem zu dem Schluss, dass ein eskalierender Handelskrieg in Deutschland bis 2030 zu einem Verlust von bis zu 150.000 Jobs führen könnte, erläutert Ökonom Jürgen Matthes im Gespräch mit t-online. In dem Modell ging das IW dabei davon aus, dass Trump Zölle in Höhe von 60 Prozent gegen China und 20 Prozent gegen die EU verhängt und die EU mit Zöllen in Höhe von ebenfalls 20 Prozent darauf antwortet.
Deutschland befindet sich derzeit in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage, die Rezession hält bereits seit zwei Jahren an. Somit würden auch geringe Einbußen beim Bruttoinlandsprodukt Deutschland mitunter empfindlich treffen. Mehr dazu lesen Sie hier.
Welche Branche spüren die Auswirkungen am stärksten?
Sollte es zu reziproken Zöllen insgesamt und Sonderzöllen auf die Automobilindustrie kommen, wäre das vor allem für die großen deutschen Autobauer und ihre Zulieferer ein Problem.
Interessant: Offenbar fürchten US-amerikanische Kunden Preisaufschläge bei europäischen Produkten. Zumindest ist das eine Erklärung für einen erhöhten Umsatz deutscher Automobilhersteller im ersten Quartal.
Volkswagen steigerte die Verkäufe in den USA um 7,1 Prozent auf 87.915 Fahrzeuge, wie das Unternehmen in Reston mitteilte. Die Verkäufe des SUV-Modells Taos und der Limousine Jetta trieben das Wachstum der Marke an. Auch das Elektroauto ID.4 kam besser an. Vom neu aufgelegten Elektro-Bulli ID.Buzz verkaufte Volkswagen aus dem Stand rund 1.900 Fahrzeuge.
BMW konnte in den ersten drei Jahresmonaten in den USA ebenfalls Fahrt aufnehmen. Von der Hausmarke BMW lieferten die Bayern 87.615 Autos aus, das waren 3,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen in Woodcliff Lake (New Jersey) mitteilte.
Was können deutsche Unternehmen und die Politik nun tun?
Die EU hat bereits signalisiert, auf Verhandlungen mit Washington zu setzen. Auch andere Länder haben dies nach Trumps Ankündigungen bereits versucht. Vietnam und Taiwan hoffen etwa, Trump mit Zugeständnissen bei eigenen Zollsätzen oder Investitionen in den USA zu besänftigen. Auch Großbritannien setzt auf Verhandlungen über ein Abkommen. Israel hat unterdessen Zollbeschränkungen auf US-Produkte herabgesetzt.
Gleichzeitig hat die EU eine "starke" Antwort mit Gegenmaßnahmen in Aussicht gestellt. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) forderte die EU auf, "nicht impulsiv, sondern entschieden und mit Weitsicht (zu) reagieren". Wie genau diese Weitsicht aussehen kann, ist dabei aber umstritten.
Für deutsche Unternehmen heißt es nun entweder abwarten, bis die Zölle tatsächlich feststehen und dann auf eine entsprechende Reaktion der Politik hoffen oder selbst tätig werden. Große Konzerne wie Volkswagen haben bereits Produktionsstandorte in den USA. Sie könnten also ihre Fertigungsstätten vor Ort erweitern und ausbauen, sodass von ihnen gefertigte Autos für den amerikanischen Markt dort entstehen und damit nicht unter die Zölle fallen. Ein kostenintensiver und langfristiger Ausweg, der aber für kleinere deutsche Zulieferbetriebe nur schwer umzusetzen wäre.
Welche Optionen liegen auf dem Tisch?
Die EU könnte als Reaktion gezielte Gegenzölle auf amerikanische Produkte wie Soja und Whiskey, Harley-Davidson-Motorräder oder Jeans verhängen. Ähnlich war es bereits im Handelsstreit unter Trump 2018 der Fall. Diese Maßnahmen hätten aber vor allem symbolischen Charakter, weil das Handelsvolumen für diese Produkte gering ist.
Möglich wäre auch, Trump entgegenzukommen. Bestehende Zölle könnten herabgesetzt oder ganz abgeschafft werden. Würde auf diese Weise deeskaliert, träumen manche sogar von einem dann möglichen Freihandelsabkommen, bei dem die Zollgrenzen für bestimmte Wirtschaftssegmente auf beiden Seiten des Atlantiks schließlich fallen könnten.
Eskaliert der Streit allerdings weiter, würde die EU bei klassischen Zöllen wegen des großen Handelsüberschusses am kürzeren Hebel sitzen. Darum erwägen manche EU-Staaten eine Digitalsteuer, die vorwiegend große US-Technologiekonzerne wie Google, Apple, Facebook und Amazon treffen würde. Zudem könnte Europa Handelsabkommen mit anderen Partnern wie China oder Indien ausbauen, um die Abhängigkeit vom US-Markt zu verringern. Auch eine engere industriepolitische Zusammenarbeit innerhalb der EU, etwa durch verstärkte Subventionen für Schlüsselindustrien wie die Halbleiterbranche, steht zur Debatte.
Welche Risiken bestehen dabei?
Der Handelskonflikt verunsichert Unternehmen, die deshalb ihre Investitions- und Lieferkettenstrategien überdenken. Das könnte das Wachstum in Europa empfindlich bremsen. Gegenzölle auf US-Produkte können zwar als Druckmittel dienen, aber wiederum auch Gegenmaßnahmen der USA nach sich ziehen, die europäische Schlüsselindustrien wie die Automobilbranche oder die Chemieindustrie noch stärker treffen könnten.
Sollte die EU eine Digitalsteuer einführen, könnte Washington mit Sanktionen oder Restriktionen für europäische Unternehmen im US-Markt reagieren, etwa gegen Banken. Für Verbraucher könnten sich digitale und Finanzdienstleistungen extrem verteuern, weil es keine ernst zu nehmenden europäischen Alternativen gibt, auf die man umsteigen könnte.
Warum wollen die USA die Zölle erhöhen?
Trump will die Zölle aus zwei Hauptgründen drastisch erhöhen. Zum einen verfolgt er seine "America First"-Politik, die auf dem Versprechen basiert, amerikanische Arbeitsplätze zu schützen und die heimische Industrie zu stärken. Er betrachtet Handelsdefizite als Verlust für die USA und glaubt, dass höhere Zölle ausländische Unternehmen dazu bringen werden, entweder in den USA zu produzieren oder mehr amerikanische Produkte zu kaufen. Dies entspricht seiner transaktionalen Sicht auf internationale Beziehungen, in der er jeden Deal als Gewinn oder Verlust bewertet. Trumps Haltung steht dabei der gängigen Lehrmeinung entgegen, die den Abbau von Handelshindernissen hervorhebt.
Zum anderen nutzt Trump Zollandrohungen als Verhandlungstaktik, erzeugt damit ein "Umfeld von Angst". Er bedient damit seine Wählerbasis, der er versprochen hat, härter gegen vermeintlich unfaire Handelspraktiken anderer Länder vorzugehen.
Was steht für die USA auf dem Spiel?
Wirtschaftlich droht eine gefährliche Inflationsspirale: höhere Importpreise, die direkt an die Verbraucher weitergegeben werden und somit die Lebenshaltungskosten anheben. Dabei hatte Trump im Wahlkampf genau das Gegenteil versprochen.
Gleichzeitig würden viele US-Unternehmen unter steigenden Kosten für Vorprodukte und Rohstoffe leiden, was ihre Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigt. Besonders betroffen wären Branchen mit komplexen globalen Lieferketten wie die Automobilindustrie oder die Elektronikfertigung. Eine umfassende Rezession mit steigender Arbeitslosigkeit und sinkenden Staatseinnahmen könnte die Folge sein. Erste Anzeichen dafür sind bereits zu sehen.
Geopolitisch betrachtet riskieren die USA Isolation und weltweite Vergeltungsmaßnahmen. Handelspartner können mit eigenen Zöllen auf US-Produkte reagieren und gezielt politisch sensible Branchen und Regionen treffen. Langjährige Bündnisse und diplomatische Beziehungen würden belastet, was schließlich zu einem Verlust an globalem Einfluss führen könnte. China und andere aufstrebende Mächte wie Indien könnten diese Situation nutzen, um eigene Handelsblöcke zu bilden und das wirtschaftliche Vakuum zu füllen. Auch das ist bereits zu beobachten. China, Japan und Südkorea haben als eigentliche Rivalen angekündigt, sehr viel stärker zusammenarbeiten zu wollen.
- Eigene Recherche
- Pressemitteilung ifo Institut
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters und AFP
Quellen anzeigen