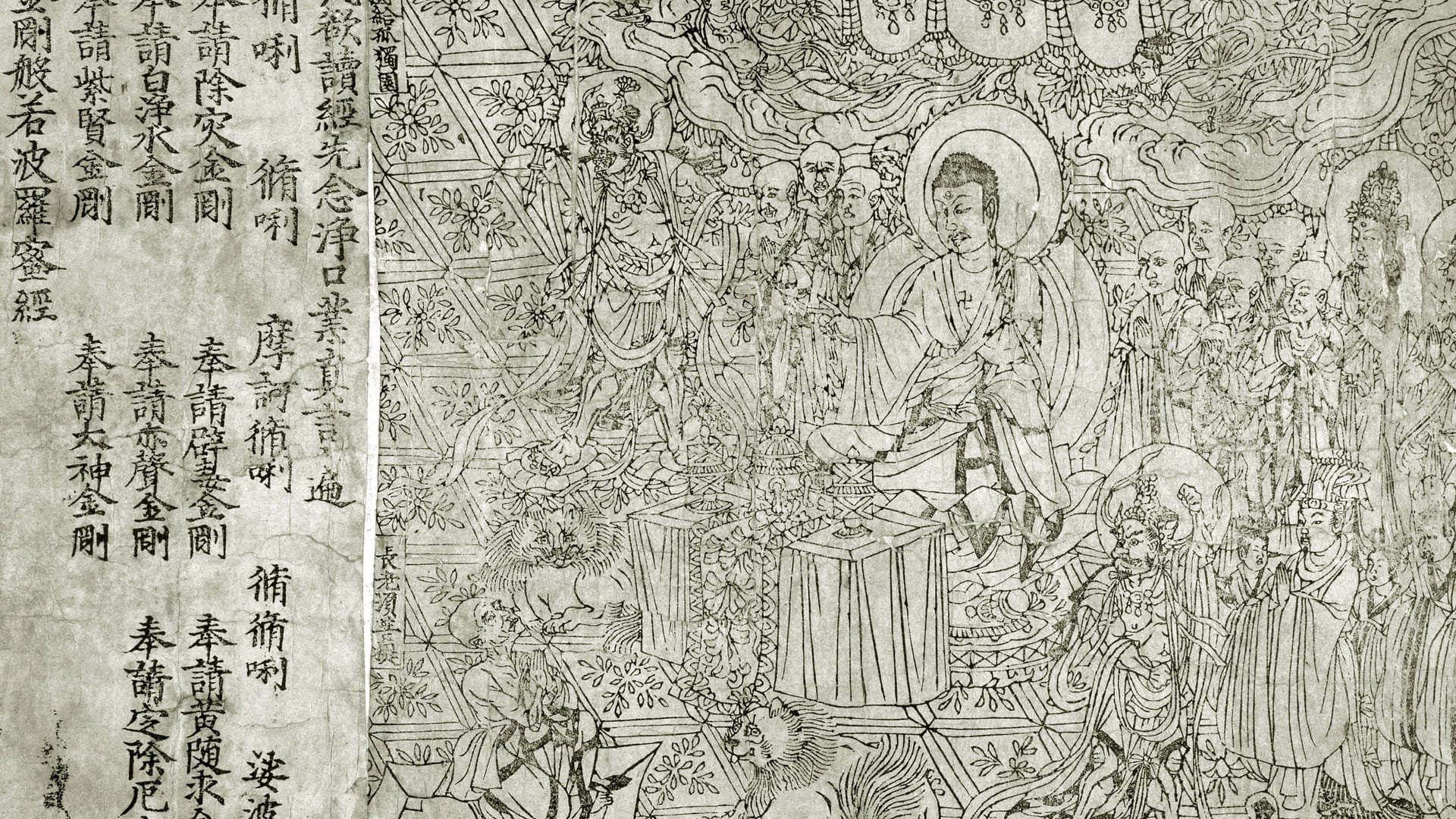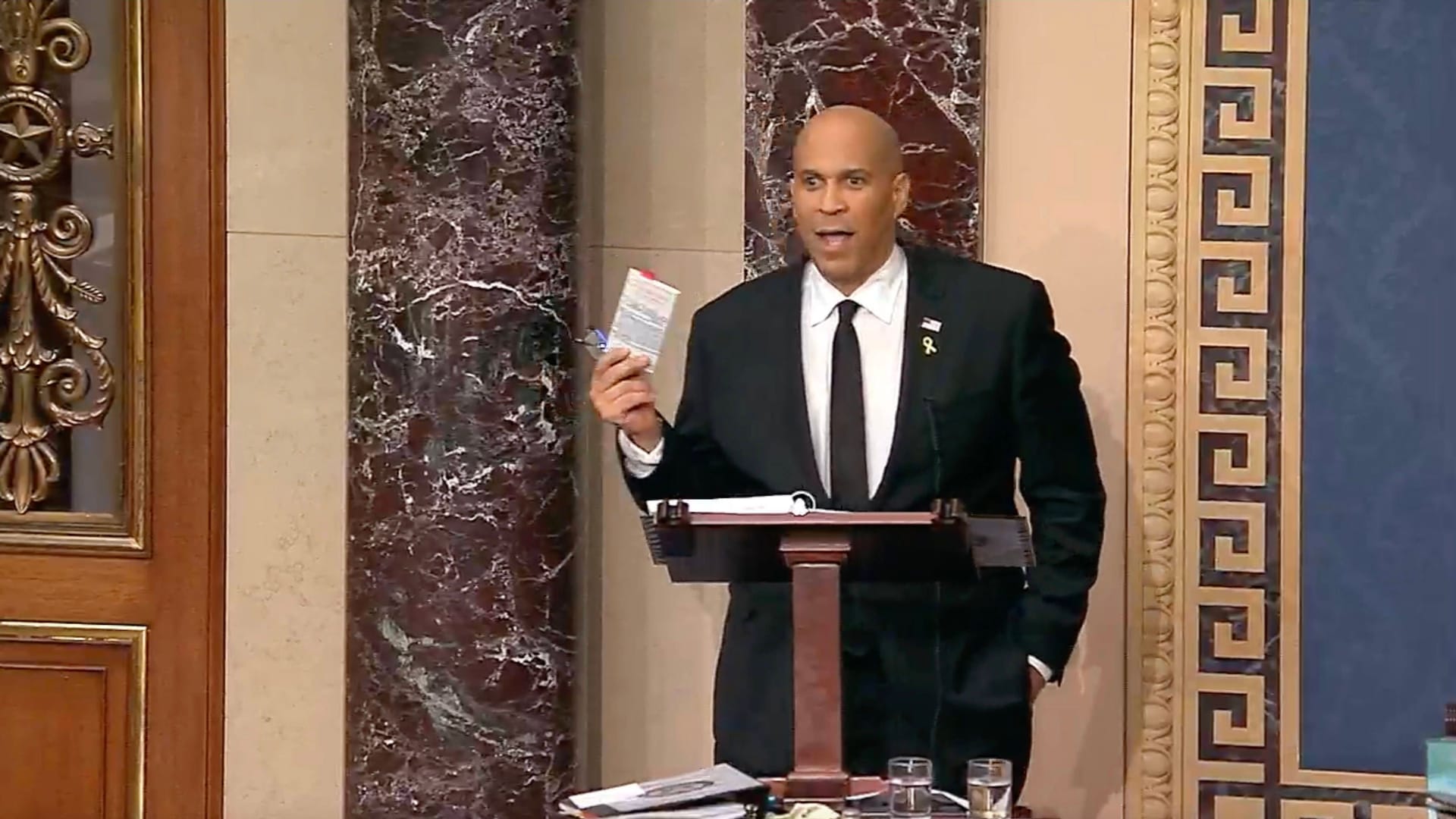Der Gesprächspartner muss auf jede unserer Fragen antworten. Anschließend bekommt er seine Antworten vorgelegt und kann sie autorisieren.
Zum journalistischen Leitbild von t-online.Deutschland in Gefahr "Es ist kaum zu fassen"


Von Russland bedroht und von Donald Trump brüskiert: Historiker Stig Förster erklärt, warum Deutschland dringend wieder über Krieg und Militär sprechen muss.
Russland brachte den Krieg zurück nach Europa, Deutschland ist darüber schockierter, als es hätte sein müssen: Aggressiv verhält sich das Regime von Wladimir Putin schließlich schon seit langer Zeit. Nun muss sich Deutschland einem Thema widmen, das es für überwunden hielt: Militär und Krieg. Denn nur eine glaubhafte militärische Abschreckung seitens Deutschlands und seiner europäischen Partner kann Russland im Zaum halten in Zeiten, in denen Donald Trump das transatlantische Bündnis erschüttert.
Was müsste nun dringend getan werden? Welche folgenreichen Fehler wurden seit 1990 begangen? Und was sind die wichtigsten Entwicklungen deutscher Militärgeschichte? Diese Fragen beantwortet Stig Förster, Historiker und Autor des Buches "Deutsche Militärgeschichte. Von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart" im Gespräch.
t-online: Professor Förster, Militärgeschichte gilt in Deutschland bestenfalls als Nischenthema, wenn sie nicht gar verpönt ist. Auf mehr als 1.000 Seiten haben Sie nun eine "Deutsche Militärgeschichte" veröffentlicht. Was ist Ihr Ziel?
Stig Förster: Der Krieg und das Militär sind geradezu Urkräfte in der menschlichen Geschichte. Niemand muss das gut finden, aber trotzdem sollte und kann man dieses Thema deswegen nicht ignorieren. Bei der Militärgeschichte geht es um Gewalt, die Organisation von Gewalt, sie handelt vom Krieg und der Vorbereitung auf Kriege. Manchen Leuten erscheint das unappetitlich. Aber es ist vollkommen absurd, diese Dinge auszuklammern. Mein Buch ist ein Angebot an Leser, die sich mit der deutschen Militärgeschichte der letzten 500 Jahre beschäftigen wollen.
Von Freunden umzingelt hat Deutschland seit der Wiedervereinigung 1990 die Friedensdividende eingestrichen, die Bundeswehr vernachlässigt und den Krieg als eine Art historisches Phänomen abstrahiert. Das erwies sich nicht erst seit der russischen Vollinvasion der Ukraine im Februar 2022 als kurzsichtig.
So ist es. Mittlerweile bleibt uns angesichts der brisanten Situation wenig übrig, als uns doch mit den Themen Krieg und Militär zu beschäftigen. Jedwede militärische Organisation hat den Zweck, Gewalt anzudrohen und diese Gewalt gegebenenfalls anzuwenden. Im Idealfall führt die Androhung von Gewalt gegen einen Aggressor dazu, dass dieser von seinen Plänen ablässt. Das ist dann eine effektive Abschreckung, daran mangelt es Deutschland gerade gewaltig.
Zur Person
Stig Förster, Jahrgang 1951, lehrte bis zu seiner Emeritierung Neueste Allgemeine Geschichte an der Universität Bern in der Schweiz. Förster ist Experte für Militär- und Kriegsgeschichte in globaler und gesellschaftlicher Perspektive. Gerade erschien sein Buch "Deutsche Militärgeschichte. Von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart" (Historische Bibliothek der Gerda Henkel Stiftung) im Verlag C.H. Beck.
Militärgeschichte wird oft als Kriegsgeschichte missverstanden. Worin bestehen die Unterschiede?
Dieser Irrtum ist geradezu historisch. Seit dem 19. Jahrhundert wurde "Kriegsgeschichte" aus dem Interesse heraus betrieben, für zukünftige Kriege Erkenntnisse zu gewinnen. Es ist verständlich, dass dieser Begriff nach dem Zweiten Weltkrieg verpönt war. Moderne Militärgeschichte setzt viel breiter an und nutzt das gesamte Instrumentarium der Geschichtswissenschaft: Politikgeschichte verbindet sich darin ebenso mit Gesellschafts-, Wirtschafts-, Finanz- und Rüstungsgeschichte wie zum Beispiel auch der Geschichte der Gewalt wie der Mentalitätsgeschichte. Ohne letztere ließen sich die Ausgänge des Ersten und Zweiten Weltkriegs überhaupt nicht hinreichend erklären. Militärgeschichte ist weit mehr als die Betrachtung und Analyse von Schlachten.
Rund fünf Jahrhunderte umfasst Ihr Buch, die Darstellung reicht von der Frühen Neuzeit bis in unsere Gegenwart. Die Grenzen Deutschlands oder dessen, was einmal Deutschland werden sollte, waren in diesem langen Zeitraum fließend. Wie sind Sie mit diesem Problem umgegangen?
Das war in der Tat ein Problem, das ich pragmatisch gelöst habe. "Deutsch" waren für mich die jeweiligen Gebiete, die zeitgenössisch als "deutsch" betrachtet worden sind. Zum "Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation", das bis Anfang des 19. Jahrhunderts bestand, gehörten selbstverständlich auch Länder und Regionen, in denen kein Deutsch gesprochen worden ist, wie es ebenso später im Fall des Deutschen Reichs auch gewesen ist. Das findet genauso Berücksichtigung wie internationale Entwicklungen des Militärs. Denn jedes Militär schaut intensiv auf die Entwicklungen bei den Armeen anderer Staaten, um nicht ins Hintertreffen zu geraten.
Haben Sie irgendeine Form von rotem Faden in diesem geografisch und zeitlich so ausgedehnten Raum ausgemacht?
Diese Frage wurde mir ab und an während meiner Arbeit am Buch gestellt. Aber die Antwort lautet tatsächlich: nein. 500 Jahre sind eine lange Zeit, in diesen Zeiträumen kam es immer wieder zu Brüchen, die bestehende Kontinuitäten auflösten oder veränderten.
Preußen galt als notorischer Militärstaat, der nach Gründung des Deutschen Reiches nahezu ganz Deutschland mit seinem Militarismus infiziert habe. Ist das zumindest eine zeitweilige Kontinuität?
Preußen war aus verschiedenen Gründen stark militarisiert, aber um etwas historische Gerechtigkeit walten zu lassen: Die DDR war militaristischer, als Preußen es jemals gewesen ist. Heute ist es vergessen oder verdrängt, aber nach einer Konsolidierungsphase avancierte die DDR schließlich zu einem der am stärksten militarisierten Staaten dieser Welt. Die DDR ist ein extremes Beispiel dafür, wie man eine ganze Gesellschaft auf das Militärische hin organisiert. Staat und Militär stehen immer in einer Wechselbeziehung zueinander.
Worauf spielen Sie an?
Ein Staat und sein Militär sind Spiegelbild des jeweils anderen. Streitkräfte einer Demokratie haben in der Regel eine andere Verfasstheit als die einer Diktatur. Die Existenz eines Militärs hat eine enorme Rückwirkung auf die Gesellschaft, denken wir beispielhaft an die vielen jungen Männer, die im Laufe der Zeit als Wehrpflichtige oder Freiwillige gedient haben. Tatsächlich sollten wir einmal über die Frühe Neuzeit sprechen, um die Bedeutung des Militärs für die Entwicklung der deutschen Staaten zu ermessen.
Bitte.
Ursprünglich waren die deutschen Staaten schwach, zu schwach, um Armeen administrativ selbst aufzustellen und zu unterhalten. Diese Lücke füllten Kriegsunternehmer, die auf Basis von Verträgen mit Fürsten, Städten und dem Kaiser eben Feldzüge organisierten und dafür Söldner anwarben.
Georg von Frundsberg im 16. Jahrhundert und Wallenstein im 17. Jahrhundert sind zwei der bekanntesten Kriegsunternehmer dieser Zeit.
Richtig. Die Kriegsunternehmer und ihre Auftraggeber waren aufeinander angewiesen, allerdings war diese Vorgehensweise ein Auslaufmodell. Nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges mit seinen Verheerungen begannen die Staaten verstärkt mit dem Aufbau stehender Heere. Dafür braucht es allerdings einen ganz anderen Zugriff des Staates auf die Gesellschaft.
Und es war reichlich Geld vonnöten?
Das verschlang Unsummen. Im Jahr 1691 gab die Regierung Frankreichs – unter "Sonnenkönig" Ludwig XIV. – 73 Prozent ihrer Einnahmen für Heer und Befestigungsanlagen aus. Weitere 16 Prozent verschlang die Kriegsflotte. Preußen unter König Friedrich Wilhelm I. ließ sich seine Armee 73 Prozent der Staatseinnahmen kosten.
Als "Soldatenkönig" wurde Friedrich Wilhelm I. bezeichnet, mit der von ihm aufgebauten Armee machte sein Sohn Friedrich II. Preußen dann zu einer europäischen Großmacht.
Neben der Armee bediente sich Friedrich II. vor allem der Rücksichtslosigkeit und des Zynismus. Aber damit stand er den anderen europäischen Herrschern in wenig nach. Sie brachen in ihrer Selbstherrlichkeit Kriege von Zaun, sie schacherten ohne jede Hemmung um Land und Menschen. Es war Machtpolitik pur, verbunden mit einer ungeheuren Brutalität. Dahin wollen wir ganz sicher nicht zurück.
In Frankreich endete König Ludwig XVI. 1793 im Zuge der Französischen Revolution unter der Guillotine. Im selben Jahr führte der Nationalkonvent mit der Levée en masse eine weitere Revolution in der Militärgeschichte aus: die Wehrpflicht.
Es war die Ausrufung des Volkskriegs, alle 18-jährigen bis 25-jährigen unverheirateten Männer sollten sich etwa zu den Waffen melden. Die Folgen dessen für die Militär-, Gesellschafts- und Politikgeschichte des 19. Jahrhunderts können gar nicht genug betont werden, auch der Beitrag zur Totalisierung der Kriegführung im 20. Jahrhundert ist immens. Im 18. Jahrhundert konnte der Staat noch nicht derart total mobilisieren, aber die Richtung war vorgegeben: Zum Zwecke der Kriegsführung wollte sich der Staat der Gesamtbevölkerung wie sämtlicher wirtschaftlicher Ressourcen bemächtigen.
Preußen griff in den Befreiungskriegen gegen den französischen Kaiser Napoleon Bonaparte 1813 ebenso zum Mittel der allgemeinen Wehrpflicht.
Und dann passierte es Bemerkenswertes. Während die anderen europäischen Staaten nach dem endgültigen Sieg über Napoleon wieder zu Berufsarmeen übergingen, behielt Preußen die allgemeine Wehrpflicht bei. Das trug dazu bei, dass die Gesellschaft in Preußen im Laufe der Zeit anders aufgestellt war als in anderen Ländern.
Lag es daran, dass Preußen nach dem Ende der Befreiungskriege ein verstreuter Flickenteppich war?
Einerseits sollten junge Männer aus dem preußisch gewordenen Rheinland und etwa West- und Ostpreußen diszipliniert werden, um später im möglichen Ernstfall für Preußen vereint in den Krieg zu ziehen. Es gab aber noch einen anderen Aspekt, warum Preußen die Wehrpflicht beibehielt: Die preußischen Reformer wollten den Volkskrieg gewissermaßen kanalisieren. In Spanien hatte sich davor ein unkontrollierter Guerillakrieg gegen die französischen Besatzer entwickelt, das sollte in Preußen nicht geschehen.
Preußen unter Otto von Bismarck schuf schließlich in den drei Deutschen Einigungskriegen zwischen 1864 und 1871 den deutschen Nationalstaat unter Ausschluss Österreichs.
Zugleich fand in dieser Zeit der Weg in den industriellen Volkskrieg verstärkt statt. Wir dürfen nicht vergessen, welche massiven Auswirkungen die Industrialisierung auf Militär und Rüstung hatte. Ebenso ist die sich entwickelnde Globalisierung nicht zu unterschätzen. Im Ersten Weltkrieg und der Totalisierung der Kriegsführung erkennen wir die Folgen beider Entwicklungen.
Wie genau?
Der Erste Weltkrieg war ein gigantischer industrialisierter Krieg von globalem Ausmaß. Aber interessant ist es doch, welche Mächte den Krieg am Ende verloren. Das waren alle, die durch den Kriegsverlauf vom Welthandeln ausgeschlossen waren: Deutschland, Österreich-Ungarn, das Osmanische Reich, aber auch schließlich Russland. Dann kam 1919 der Friedensvertrag von Versailles und es passierte etwas überaus Unglückliches.
Sie meinen den Artikel 231 des Versailler Vertrages?
Darin wird dem Deutschen Reich die alleinige Kriegsschuld zugeschrieben. Deutschland wurde aber gleich mehrfach gedemütigt: Die Armee wurde auf 100.000 Mann verkleinert, die Reichswehr durfte keine Panzer, keine Flugzeuge und keine schwere Artillerie haben, gleichzeitig wurde das ganze Land durch Reparationszahlungen, Meistbegünstigungsklauseln und andere Dinge ausgeplündert. Die Machtgrundlage haben die Sieger dem Deutschen Reich aber nicht entzogen, das sollte sich dann rächen.
Bleiben wir kurz bei der 100.000-Mann-Reichswehr der Weimarer Republik. Was charakterisierte diese Truppe?
Im damaligen Offizierskorps gab es fast nur Generalstabsoffiziere. Dort wurden das Wissen und das Können, das man im Ersten Weltkrieg erworben hatte, bewahrt und erweitert. Die erstaunlichen Leistungen der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg hängen damit intensiv zusammen. In den Rängen der einfachen Soldaten gab es vor allem Langgediente, diese Leute bildeten in der Wehrmacht dann das Unteroffizierkorps. Diese Reichswehr war also eine Kaderarmee, auf der die Wehrmacht im Nationalsozialismus aufbauen konnte.
Hitler wollte den Krieg. Wie standen die Offiziere der Wehrmacht diesen Plänen gegenüber?
Die Wehrmacht stand Hitlers Kriegsplänen skeptisch gegenüber. Denn die Wehrmachtsführung ging davon aus, dass sie diesen Krieg verlieren würde. Aufrüstung, neue Posten und Karrieren, ja, das begrüßten die Offiziere. Aber Krieg? Nein. Erst recht nicht mit einer halbfertigen Armee. Das Interesse der Wehrmachtsführung an einem Krieg war derart gering, dass es sogar Putschpläne gab, die aber nicht zur Ausführung kamen.
Sie haben gerade die Leistungen der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg erwähnt. Gleichwohl hat sich das Kriegsglück schnell gegen Deutschland gewendet. Was waren die tieferen Gründe?
Es gab einen fundamentalen Widerspruch zwischen der Strategie Hitlers und der NS-Führung auf der einen Seite und den operativen Fähigkeiten, Leistungen und Planungen des Heeres. Das führte zu massiven Konflikten. Nehmen wir Generalfeldmarschall Erich von Manstein, der ein wirklich brillanter Operateur gewesen ist. Was Manstein aber nicht verstand, war Hitlers Strategie. Hitler wollte die Ölfelder von Baku erobern, deswegen der Vorstoß der 6. Armee nach Stalingrad 1942. Strategisch war das vollkommen folgerichtig, denn ohne Erdöl lässt sich schlecht Krieg führen. Operativ war das aber völliger Irrsinn, die Wehrmacht musste angesichts ihrer Ressourcen an dieser Aufgabe scheitern. Geändert hat es wenig, da konnte Manstein Hitler noch so anschreien.
Von Manstein war militärisch anderer Meinung als Hitler, in seinen Befehlsbereichen exekutierte der Offizier den nationalsozialistischen Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion.
Die Wehrmacht hat sich zutiefst schuldig gemacht, so an der bestialischen Ermordung von Juden und Sinti und Roma. Aber auch ein anderes Verbrechen geht auf ihr Konto: Die Wehrmachtsführung hatte keinerlei Vorsorge für eine menschenwürdige Unterbringung von vielen Millionen sowjetischen Kriegsgefangenen nach dem deutschen Überall auf die Sowjetunion 1941 getroffen. Die Wehrmacht hat sie stattdessen elendig verhungern und krepieren lassen. Von den 5,7 Millionen Rotarmisten, die in deutsche Kriegsgefangenschaft gegangen waren, sind bis Kriegsende 3,3 Millionen umgekommen. So viel zu diesem Unsinn von der "sauberen" Wehrmacht, der noch so lange kursierte.
1945 haben die Alliierten Deutschland dann die Machtmittel genommen, die sie ihm 1918 gelassen hatten: Das Deutsche Reich und das deutsche Militär existierten nach der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht am 8. Mai nicht mehr.
Das war der größte Bruch in der gesamten deutschen Militärgeschichte überhaupt: Es gab schlicht kein deutsches Militär mehr. Es sollte nach 1945 dann auch rund zehn Jahre dauern, bis Deutsche wieder Soldatenuniform trugen, ausgelöst durch den Ost-West-Konflikt. Und selbst nach der Wiederbewaffnung sind keine deutsche Regierung und kein deutsches Militär mehr in der Lage gewesen, eigenständig Krieg zu führen. Deutsches Militär war fest in die jeweiligen Bündnissysteme integriert, die von den Supermächten dominiert wurden.
Das in Bundesrepublik und DDR geteilte Deutschland wurde dann zum am stärksten militarisierten Land der Welt.
Das galt zumindest für die DDR. Dabei war die NVA der DDR zunächst militärisch inkompetent. Sie war eine Hilfstruppe der sowjetischen Streitkräfte, dazu kursierte die absurde Idee, dass auch Generäle und Admiräle einen Monat im Jahr als einfache Arbeiter an der Werkbank stehen sollte. Der Professionalität tat das keinen Dienst. Später hat sich das geändert, aber darüber haben wir ja schon früher gesprochen. Beim Bezug von Waffensystemen waren DDR und NVA übrigens bis zum Ende von der Sowjetunion abhängig. Das ist ein Unterschied zu Westdeutschland.
Dort musste Konrad Adenauer Wiederbewaffnung und Westbindung gegen allerlei Widerstände durchsetzen.
Die Möglichkeit dazu eröffnete der Koreakrieg, der insbesondere die USA zu der Ansicht brachte, dass es ohne einen westdeutschen Verteidigungsbeitrag nicht ginge. Es bestand bei den konventionellen Streitkräften eine enorme Diskrepanz zwischen Ost und West. Angesichts dieser Erfordernisse bekam man von US-General Dwight D. Eisenhower sogar eine "Ehrenerklärung" für die Wehrmacht, obwohl Eisenhower sehr gut wusste, wie schuldig diese Leute gewesen sind.
Im Unterschied zur DDR entwickelte die Bundesrepublik dann erneut eine Rüstungsindustrie.
Ja. Zunächst erhielt die Bundeswehr nach ihrer Gründung amerikanische Waffen, später kamen eigene Entwicklungen dazu. Der erste Leopard aus den Sechzigerjahren ist ein Beispiel, der Leopard 2 ist heute durch den russischen Krieg gegen die Ukraine wieder sehr bekannt.
Als "wahrscheinlich beste Wehrpflichtarmee der Nato" erhielt die Bundeswehr 1976 Lob von einem britischen Militärattaché. Stimmt das?
In den ersten Jahren wurde die Bundeswehr durch Skandale und verfehlte Planungen geschwächt. Seit den 1970er-Jahren wurde die Truppe aber effizienter verwaltet, gut ausgerüstet und erheblich aufgerüstet. Ihr Beitrag zur Bündnisverteidigung war dann einer der Gründe, warum der Warschauer Pakt zusammenbrach, denn spätestens nach 1980 verlor das sowjetische geführte Bündnis seine konventionelle Überlegenheit. Gleichzeitig sank in der NVA allmählich die Moral von Offizieren und Soldaten.
Inwiefern?
Gerade die Offiziere wollten nicht mehr ihren Kopf hinhalten, das war ein Mitgrund für den Zusammenbruch der DDR. Eigentlich war die NVA hochideologisiert, aber Erich Honecker und die SED-Führung wollten den Offizieren die Bezüge zusammenstreichen und Entlassungen vornehmen. Manche Soldaten mussten auch zum Teil unter lebensgefährlichen Bedingungen in Bergwerken und dergleichen arbeiten, weil es in der DDR nicht genug Arbeitskräfte gab. Kurzum, die Loyalität zum Regime brach zusammen, deswegen konnte sich die DDR-Führung ihrer Armee auch nicht sicher sein, als die Demonstranten im Herbst 1989 auf der Straße standen.
Wladimir Putin erlebte eine solche Demonstration in der KGB-Villa in Dresden.
Das hat ihm sicher überhaupt nicht gefallen. Denn weder sowjetische Truppen noch DDR-Soldaten erschienen, sondern blieben in ihren Kasernen.
Nun wurde allerdings die Bundeswehr nach 1990 auch verkleinert und abgerüstet, langfristig wurde sie von der Politik vorrangig für Unterstützungs- und Auslandseinsätze vorgesehen.
Auch das geschah eher halbherzig. Die Friedensdividende ging auf Kosten der Entwicklung der Bundeswehr, die Wiedervereinigung war teuer und musste irgendwie finanziert werden. Wir dürfen auch die sogenannte Weizsäcker-Kommission nicht vergessen, die im Mai 2000 ihren Bericht über die Bundeswehr vorlegte. Feststellung war, dass die Bundeswehr zu groß, teilweise veraltet und obendrein falsch ausgerichtet sei. Eine der Folgen bestand darin, dass die Bundeswehr sich mehr an die Privatwirtschaft hängen sollte: Die Bundeswehr wartete ihre Fahrzeuge nicht mehr selbst, sondern Privatfirmen erledigten das. Das war ein großes Problem für die Bundeswehr, eine Armee, die ihre eigenen Fahrzeuge nicht mehr wartet und repariert. Und wenn das mal das einzige gewesen wäre …
Was kritisieren Sie noch?
Die Bürokratie ist außer Kontrolle geraten, auch für die Bundeswehr. Daran leidet sie bis heute. Nehmen wir Afghanistan, da wurde peinlich darauf geachtet, dass der Müll getrennt und die Straßenverkehrsordnung eingehalten wurde. Nichts gegen Umweltschutz, aber das ist doch völlig absurd. Da nimmt es kaum Wunder, dass die Bundeswehr auch solche Rekrutierungsprobleme nach der Aussetzung der Wehrpflicht hatte und hat.
Die Debatte über eine Reaktivierung der Wehrpflicht ist im Gange. Was denken Sie?
Wir haben für eine vollumfängliche Reaktivierung der Wehrpflicht gar nicht die Kapazitäten. Dafür braucht es Kasernen, die sind entweder dichtgemacht oder desolat. Neue Standorte müssten gebaut werden, das wird viele, viele Milliarden kosten. Eine Berufsarmee hat ebenso ihre Probleme: Wie will die Politik die Leute denn locken? Bislang habe ich da keine überzeugenden Argumente gehört.
Die Zeit drängt. Zahlreiche Experten sind sich einig, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis Russland unter Wladimir Putin den Zusammenhalt der Nato testen wird.
Die Gefahr ist riesengroß. Wer das nicht erkannt hat, dem ist nicht mehr zu helfen. Niemand hierzulande hat ein Interesse, dass sich dieser Krieg über die Grenzen der Ukraine hin ausweitet. Erst recht nicht in Zeiten, in denen Donald Trump die transatlantische Partnerschaft demontiert.
Nun ist die Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben gelockert worden. Gibt Ihnen das etwas Zuversicht?
Deutschland und Europa müssen ein Abschreckungspotenzial aufbauen. Das ist die einzige Sprache, die Putin versteht. Das ist auch das Einzige, was Trump beeindruckt. Wenn nun die USA als verlässlicher Bündnispartner ausfallen, bedeutet das im Endeffekt auch, dass man dort keine Waffen mehr kaufen kann und darf. Wir müssen unsere Waffen also selbst herstellen, die F-35 kann Trump dann behalten.
Glauben Sie, dass Deutschland und Europa nun die Kehrtwende schaffen und in Sachen Sicherheits- und Verteidigungspolitik glaubhaft selbstständig werden?
Das bleibt zu hoffen. Es gab so viele Warnschüsse von Putin, es ist kaum zu fassen. Als Russland 2014 mit seinen "Grünen Männchen" die Krim besetzte, sagte der britische Premier David Cameron den Besuch der Paralympics im russischen Sotschi ab, die Amerikaner entsandten eine einsame Fregatte ins Schwarze Meer und Angela Merkel verkündete, dass Russland kein verlässlicher Partner mehr sei. Da konnte sich Putin doch nur ermutigt fühlen.
Zumal bald das Pipelineprojekt Nord Stream 2 trotz allem angeblichen Misstrauen gegenüber Russland startete.
So ist es. Wir brauchen nun politischen Willen und wir brauchen eine Strategie. Was soll Putin denn noch machen, bis das kapiert wird? Eine Erhöhung der Mütterrente, eine gesenkte Umsatzsteuer für die Gastronomie sind ja schön und gut. Nur geht es inzwischen um alles.
Professor Förster, vielen Dank für das Gespräch.
- Persönliches Gespräch mit Stig Förster via Videokonferenz