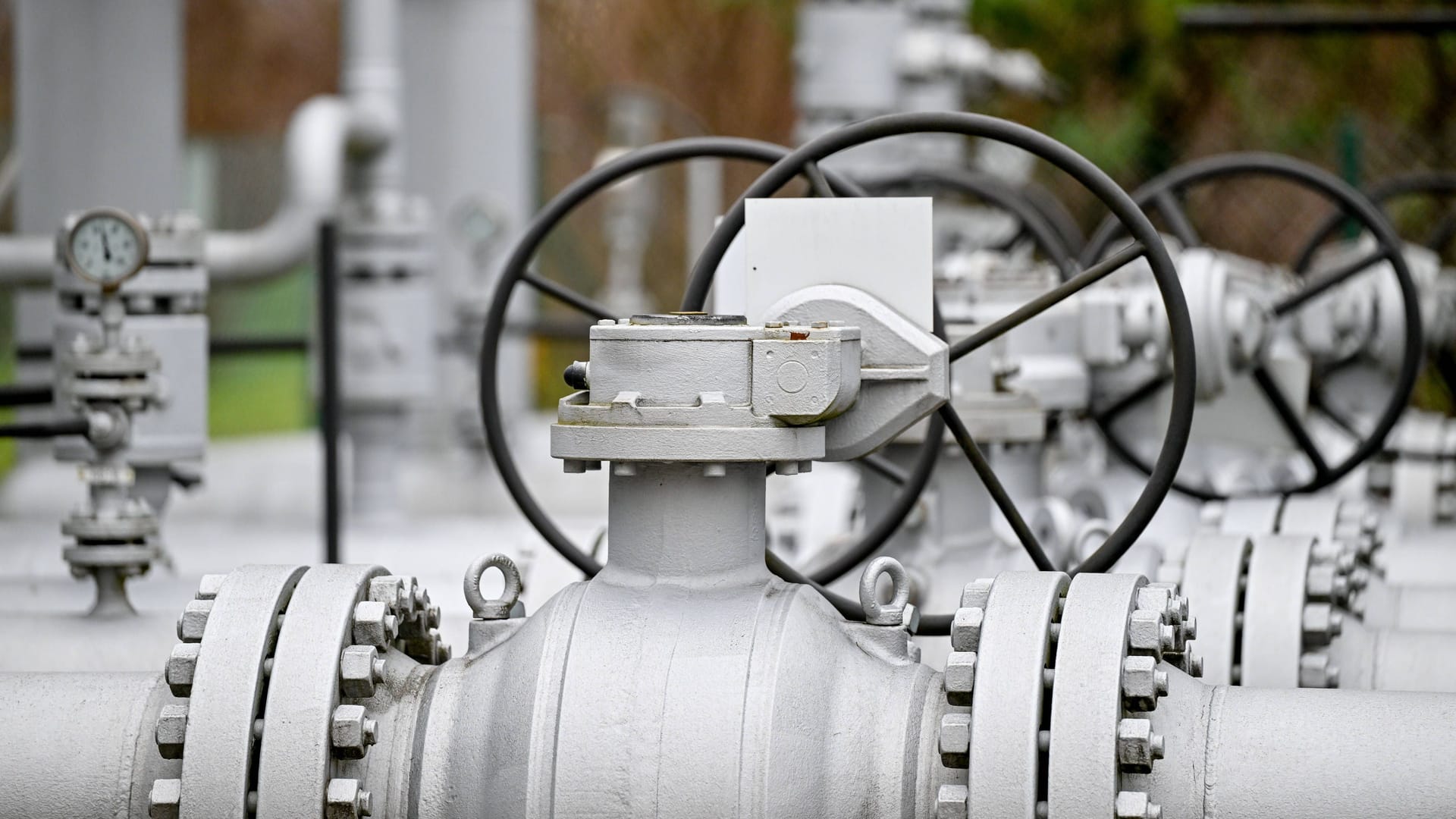Mehr als 150 Journalistinnen und Journalisten berichten rund um die Uhr für Sie über das Geschehen in Deutschland und der Welt.
Zum journalistischen Leitbild von t-online.Schwarz-Rot Was aus dem Heizungsgesetz wird, ist überraschend unklar


Schwarz-Rot will das "Heizungsgesetz abschaffen". So steht es im Koalitionsvertrag. Doch Union und SPD sind sich nicht einig, was das bedeutet.
Markus Söder braucht einige Minuten, bis er rhetorisch im Heizungskeller angekommen ist. "Übrigens", sagt der CSU-Chef am Mittwoch, als Schwarz-Rot den Koalitionsvertrag vorstellt: Das "Heizgesetz" werde "abgeschafft" und wie das Bürgergeld "durch wesentlich effizientere Systeme ersetzt". Dann aber ist der sonst so wortgewaltige Markus Söder, der das Gesetz mal als "echtes Desaster" bezeichnet hat, auch schon beim nächsten Thema.
Es ist erstaunlich, wie beiläufig das vermeintliche Ende des Heizungsgesetzes an diesem Tag daherkommt. Bald-Kanzler Friedrich Merz und SPD-Chef Lars Klingbeil, die beide vor Söder reden, erwähnen es nicht einmal. Ein Gesetz immerhin, das vor allem die Union mit freundlicher Unterstützung des Boulevards ("Habecks Heiz-Hammer") monatelang für Attacken gegen die Ampelregierung genutzt hatte.
Über kein anderes Vorhaben hat Deutschland in den vergangenen Jahren so erbittert gestritten. Und jetzt findet es ein so beiläufiges Ende? Die schwarz-rote Zurückhaltung – sie liegt vielleicht auch daran, dass nach wie vor nicht klar ist, was das eigentlich bedeuten soll: das Heizungsgesetz "abzuschaffen".
Die Tücken des Formelkompromisses
In den 144 Seiten des Koalitionsvertrags findet sich zum Heizungsgesetz, das eigentlich Gebäudeenergiegesetz heißt, kurz GEG, nur wenig mehr als das, was Markus Söder am Mittwoch referiert. "Wir werden das Heizungsgesetz abschaffen", heißt es dort auf Seite 24 unter anderem. Und: "Das neue GEG machen wir technologieoffener, flexibler und einfacher."
Es ist ein Formelkompromiss, der wie alle Formelkompromisse den Nachteil hat, dass jeder etwas anderes darunter verstehen kann. Den Eindruck gewinnt schnell, wer sich bei den Verhandlern von Union und SPD umhört. Viele wollen sich mit Details lieber nicht zitieren lassen, die Sache ist heikel, weil die Regierung noch nicht mal im Amt ist – und die Vorstellungen weit auseinandergehen.
Es fängt schon damit an, dass in der SPD längst nicht alle glücklich darüber sind, dass das mit dem "Abschaffen" nun überhaupt im Koalitionsvertrag steht. Manche haben die Sorge, dass solche vollmundigen Versprechen und erneut geänderte Regeln alles noch mal schlimmer machen könnten. Zumal sich die entstandene Verunsicherung durch das Gesetz natürlich nicht einfach so "abschaffen" lässt.
Alles beginnt mit einem Koordinationsproblem
Wer besser verstehen will, warum es gerade bei diesem Gesetz nicht mehr Klarheit gibt, muss ein paar Wochen zurückschauen. In die Zeit nämlich, als die 16 Facharbeitsgruppen von Union und SPD die Grundlagen für den Koalitionsvertrag erarbeitet und in den inzwischen allesamt öffentlichen Papieren festgehalten haben.
Alles beginnt mit einem Koordinationsproblem. Für das Heizungsgesetz fühlte sich damals nicht nur die AG "Klima und Energie" zuständig, sondern auch die AG "Verkehr und Infrastruktur, Bauen und Wohnen". Die Bau-AG wird schneller fertig als viele andere Arbeitsgruppen. Und ihr Ergebnispapier landet auf den Tischen der Klima-AG.
- Fragen und Antworten: Das steht aktuell im Heizungsgesetz
Das Papier enthält schon die Formulierung, die es am Ende in den Koalitionsvertrag schafft: "Wir werden das Heizungsgesetz abschaffen." In der Klima-AG sind die Vertreter der SPD gar nicht begeistert, so wird es kolportiert. Zum einen, weil sie sich für das Heizungsgesetz zuständig sehen. Aber vor allem, weil sie das mit dem "Abschaffen" anders als die Genossen in der Bau-AG gar nicht in den Text schreiben wollen.
Das Papier der Bau-AG, so berichten es Beteiligte, beendet die Verhandlungen über das Heizungsgesetz in der Klima-AG faktisch, bevor es eine Einigung gibt. Im Klima-Papier wird anschließend nur noch der Dissens festgeschrieben. Es gibt dort zwei Textblöcke zum Heizungsgesetz: einen in Blau mit der Unionsformulierung. Und einen in Rot mit dem Vorschlag der SPD.

Embed
Reformbedarf bei der Wärmeplanung
Dass im Koalitionsvertrag am Ende nun doch "abschaffen" steht, liegt dem Vernehmen nach auch daran, dass die SPD dafür im Gegenzug den Erhalt der Mietpreisbremse und des Deutschlandtickets durchgesetzt hat. Doch die Einigung auf einen Begriff allein bedeutet eben nicht, dass sich Union und SPD auch einig sind, was damit gemeint ist.
Auch die SPD sieht Reformbedarf beim Heizungsgesetz. Sie hält es etwa für ungerecht, dass für Kommunen, die schneller mit ihrer Wärmeplanung fertig sind, als sie es sein müssten, auch schneller die Pflichten des Gesetzes gelten. Die Vorbildlichen würden so "bestraft", lautet die Kritik, die auch bei der Einführung des Gesetzes schon aus einigen Bundesländern zu hören war.
Stattdessen sollte aus Sicht der SPD die Pflicht zur Neu-Heizung, die mit 65 Prozent erneuerbaren Energien betrieben wird, nur noch an zwei Stichtagen in Kraft treten: für Gemeinden über 100.000 Einwohnern ab Juli 2026 und für alle kleineren ab Juli 2028. Dann also, wenn spätestens die Wärmeplanungen abgeschlossen sein müssen. So hat es die SPD auch ins Klima-Papier geschrieben. Allerdings steht es im Koalitionsvertrag nun deutlich wolkiger: "Die Verzahnung von GEG und kommunaler Wärmeplanung vereinfachen wir."
Union will weniger Fristen und Quoten
Die SPD sieht auch darüber hinaus Punkte, in denen das GEG einfacher und "technologieoffener" werden kann. Nur versteht sie darunter meist etwas anderes als ihr Koalitionspartner. Bei der Union gibt es nicht nur unter den Hardlinern die Ansicht, dass es zu viele Fristen und Quoten im Gesetz gibt. Etwa für Gasheizungen.
Die dürfen zwar auch jetzt noch nach einer Beratung eingebaut werden, bis es eine Wärmeplanung am Wohnort gibt. Allerdings ist vorgeschrieben, dass sie irgendwann steigende Anteile Biomasse verbrennen müssen, also etwa Biomethan oder Wasserstoff. 15 Prozent ab 2029, 30 Prozent ab 2035 und 60 Prozent ab 2040.
Diese Fristen und Quoten halten sie in der Union für zu kompliziert – und überflüssig, um das Ziel der Klimaneutralität 2045 zu erreichen. Das Ziel ist im Koalitionsvertrag festgeschrieben, wie sie in der Union betonen. Bedeutet auch: Dann ist ohnehin Schluss mit fossilen Brennstoffen.
Auf dem Weg dahin will die Union den Menschen aber mehr Eigenverantwortung zugestehen. Es gebe ja ohnehin die CO2-Bepreisung, so das Argument. Die mache Gas und Öl mit den Jahren ohnehin teurer, was klimaneutrale Alternativen attraktiver werden lasse. Und die Einnahmen würden den Menschen und Unternehmen dann zurückgegeben. So steht es tatsächlich im Koalitionsvertrag, allerdings soll das nicht durch ein zusätzliches Klimageld geschehen, sondern eine "spürbare Entlastung beim Strompreis" und die "Förderung von Investitionen in die Klimaneutralität".
Die Sache mit der "Grüngasquote"
In der Union verweisen sie zudem auf ein weiteres Instrument, das im Koalitionsvertrag steht: die Grüngasquote. Sie soll Gasanbieter dazu verpflichten, steigende Quoten an Biomethan oder Wasserstoff in ihren Energiemix aufzunehmen. Die Verbraucher müssten also nichts tun, um über die Jahre mit immer klimaneutralerem Gas zu heizen.
Klingt praktisch. Der Haken ist, dass der Staat die Grüngasquote mit viel Fördergeld subventionieren müsste. Kritiker fürchten zudem, das alles diene eigentlich nur dazu, eine veraltete, aber für manche lukrative Technologie so lange wie möglich am Leben zu halten. Auch in der SPD gibt es diese Sorge. Vor allem, weil es schon andere Förderinstrumente für die Konzerne gebe.
Die Sozialdemokraten verstehen unter "mehr Technologieoffenheit" deshalb eher nicht das Abschaffen von Biogas-Fristen. Sie wollen kleinere Eingriffe am Gesetz vornehmen, also zum Beispiel komplizierte Effizienzvorschriften für Stromheizungen abschaffen.
Bleibt die Höhe der Förderung?
Selbst bei der Förderung klimaneutraler Heizungen sind sich Union und SPD nicht wirklich einig. Und das, obwohl im Koalitionsvertrag ein Satz steht, der eindeutig wirkt: "Die Sanierungs- und Heizungsförderung werden wir fortsetzen."
Doch als Markus Söder am Mittwoch bei der Vorstellung des Koalitionsvertrages das GEG anspricht, tut er das trotzdem ausgerechnet, als es um "milliardenschwere Einsparungen" geht. Schwarz-Rot wolle die beim Staat selbst, beim Bürgergeld "und auch beim Heizgesetz" erreichen, sagt Söder. Und dann sagt er leider nicht mehr viel anderes dazu.
Die Union hatte schon im Wahlkampf durchblicken lassen, dass sie das Heizungsgesetz nicht nur für zu kompliziert, sondern auch für zu teuer hält. In der Union wird nun zwar der "Vertrauensschutz" betont: Von heute auf morgen soll sich an der Höhe der Förderung nichts ändern, um das Vertrauen der Menschen nicht weiter zu erschüttern.
Es gibt in der Union aber durchaus Überlegungen, etwa die Fördersummen mit den Jahren sinken zu lassen. Damit sei es einerseits planbar für die Menschen und es gebe andererseits einen zusätzlichen Anreiz, früher auf klimaneutrale Heizungen umzusteigen. In der SPD wollen sie davon eher nichts wissen. "Förderung fortsetzen" bedeute "Förderung fortsetzen".
Wie man das alles zusammenbekommen will? Das müsse dann die Regierung klären, wenn sie im Amt sei, heißt es aus SPD und Union. Zumindest da sind sie sich einig.
- Eigene Recherchen
- spd.de: "Koalitionsvertrag: Verantwortung für Deutschland"
- fragdenstaat.de: "Die Papier der Arbeitsgruppen von CDU, CSU und SPD"
- gesetze-im-internet.de: "§ 71 GEG – Anforderungen an eine Heizungsanlage"
- energiewechsel.de: "Unter welchen Umständen darf ich im Bestand noch eine neue Gas- oder Ölheizung einbauen?"
Quellen anzeigen