
Der Gesprächspartner muss auf jede unserer Fragen antworten. Anschließend bekommt er seine Antworten vorgelegt und kann sie autorisieren.
Zum journalistischen Leitbild von t-online.Historiker Gerste "Darauf stützt sich die Macht der USA"
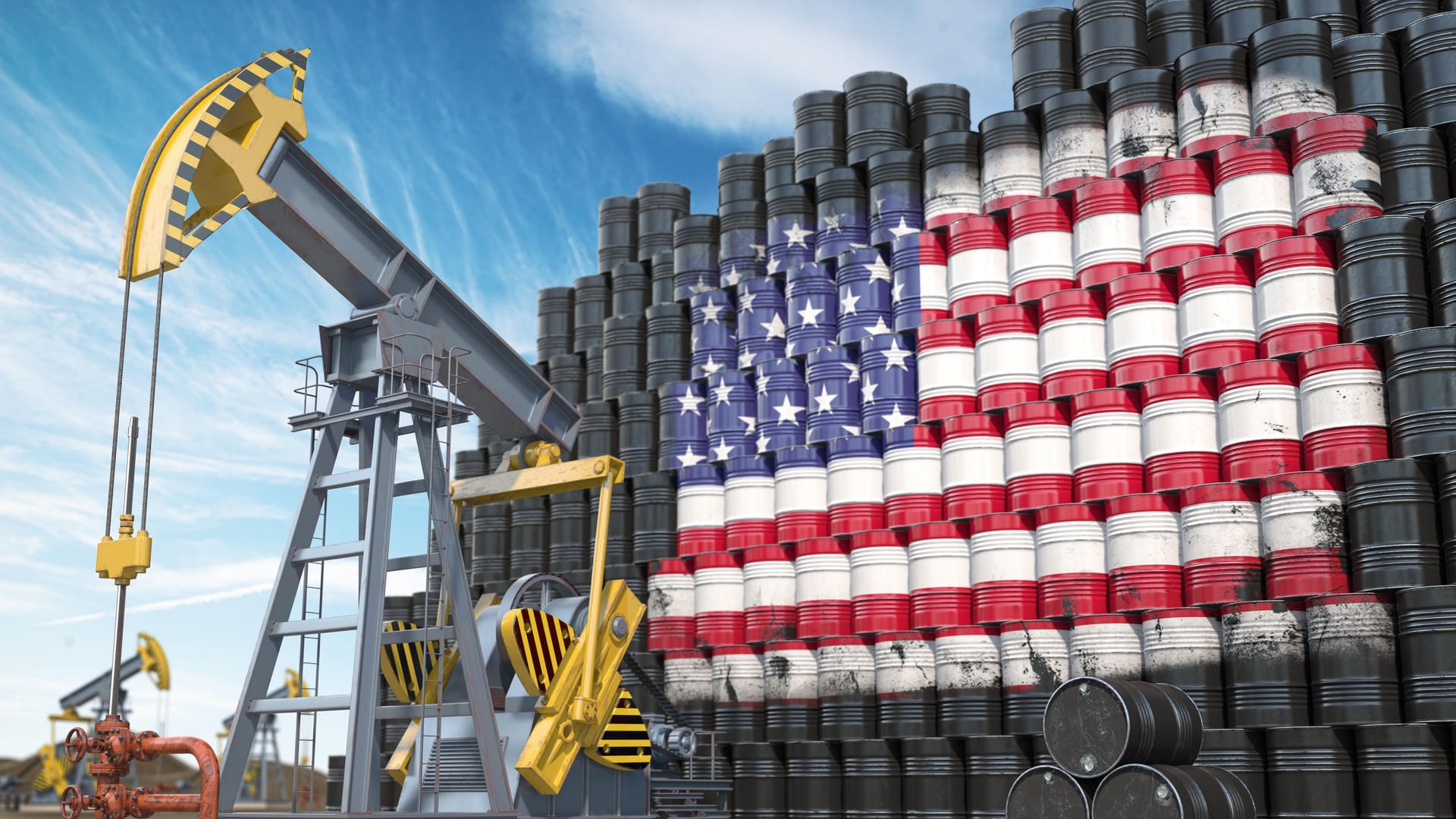

Ein Hollywoodstar entwickelte revolutionäre Technik gegen Nazi-Deutschland, Donald Trump profitierte von einer Erfindung, die schon John F. Kennedy ins Weiße Haus brachte: Historiker Ronald D. Gerste erklärt, wie Technik unsere Geschichte prägt.
Einen Oscar konnte Hedy Lamarr nicht einheimsen, doch erhielt der Hollywoodstar spät im Leben eine Würdigung auf anderem Gebiet: als Erfinderin, die ihrer Exilheimat USA zum Sieg im Zweiten Weltkrieg verhelfen wollte. Lise Meitner, eine der bedeutendsten Physikerinnen, versagte den USA hingegen ihre Mithilfe bei der Entwicklung der Atombombe.
Was bewegte beide Frauen zu ihren Entscheidungen? Warum wurde das Fernsehen für Donald Trump und die Geschichte der amerikanischen Präsidentschaftswahlen so wichtig? Und ohne welchen Bodenschatz wäre die Historie der USA ganz anders verlaufen? Diese Fragen beantwortet Ronald D. Gerste, Historiker und Autor des Buches "Wie Technik Geschichte macht. Von Gutenberg bis zum Smartphone", im Interview.
t-online: Herr Gerste, Hedy Lamarr war ein gefeierter Hollywoodstar, zugleich tüftelte die Schauspielerin 1940 an einer Funkfernsteuerung für Torpedos. Wie kam es dazu?
Ronald D. Gerste: Heute würden wir Hedy Lamarr als ein Multitalent bezeichnen. Sie war eine herausragende Schauspielerin, talentiert und attraktiv, zudem verfügte sie über ein beeindruckendes technisches Verständnis. Der Anlass für ihre technischen Tüfteleien war allerdings ein trauriger: 1940 versenkte ein deutsches U-Boot das britische Passagierschiff "City of Benares", unter den fast 250 Toten befanden sich 77 Kinder. Das empörte Hedy Lamarr, die ursprünglich Hedwig Kiesler hieß.
Lamarrs Karriere hatte in Europa begonnen, 1940 war sie längst in die Vereinigten Staaten übergesiedelt.
Zum Glück, denn sie war eigentlich Österreicherin jüdischer Herkunft. Neben den Karrieremöglichkeiten in Hollywood spielte der zunehmende Antisemitismus in ihrer Heimat bei ihrer Auswanderung sicherlich auch eine gewisse Rolle. 1933 hat Lamarr übrigens Filmgeschichte geschrieben, indem sie den ersten Orgasmus vor laufender Kamera gespielt hat: "Ekstase" hieß der Streifen, heute würde die Darstellung keinem Zuschauer auch nur ansatzweise den Puls hochtreiben. Damals galt es manchen als Skandal allerhöchster Kategorie.
Zur Person
Ronald D. Gerste, 1957 in Magdeburg geboren, ist promovierter Mediziner und Historiker. Er lebt in der Nähe der amerikanischen Hauptstadt Washington, D.C., und schreibt regelmäßig als Korrespondent für deutschsprachige Medien. Darüber hinaus ist Gerste Autor zahlreicher Bücher zur US-Geschichte, darunter "Amerikas Präsidentschaftswahlen. Von George Washington bis zu Donald Trump". Gerade erschien Gerstes neues Buch "Wie Technik Geschichte macht. Von Gutenberg bis zum Smartphone".
Wie kam Lamarr aber zu dem technischen Wissen, das für die Konstruktion einer Torpedosteuerung notwendig war?
Lamarrs erster Ehemann – dem noch fünf weitere folgen sollten – war Fritz Mandl. Mandl war nicht nur der drittreichste Mann Österreichs, sondern auch ein Waffenhändler. Bei seinen Soireen sollte die schöne Lamarr eigentlich nur als Beiwerk dienen, aber sie hörte aufmerksam zu, was die Leute, die etwas von Waffen verstanden, so von sich gaben.
Und begann 1940 mit der Arbeit an ihrer Torpedosteuerung?
Genau. Noch wichtiger nahm sie das Projekt, nachdem Japan die USA auf ihrem Flottenstützpunkt Pearl Harbor auf Hawaii angegriffen hatte. Unterstützt wurde Lamarr dabei vom Komponisten George Antheil. Im Prinzip ging es den beiden darum, Wellensignale – Funk- beziehungsweise Radiowellen – zu synchronisieren. Ständig wechselnde Frequenzen sollten die Torpedos weniger anfällig für Störungen machen. Lamarr nahm diese Aufgabe übrigens sehr, sehr ernst. Einigen Quellen zufolge soll sie dafür sogar die Hauptrolle in "Casablanca" abgelehnt haben.
Zum Einsatz kam Lamarrs Technologe im Zweiten Weltkrieg aber nicht?
Lamarr erhielt 1942 ein Patent, die "New York Times" bezeichnete die Technologie als "red hot", also "glühend heiß". Aber die US Navy verwendete die Technik nicht, weil sie für die damaligen Torpedos als zu groß betrachtet worden ist. Während der Kuba-Krise 1962 kam die modifizierte Technologie vom Lamarr dann aber sehr wohl zum Einsatz. Lamarr und Antheil haben übrigens keinen Cent an ihrer Erfindung verdient. 2014, Jahre nach ihrem Tod, wurde sie immerhin in die National Inventors Hall of Fame aufgenommen. Heute wird Lamarrs Technologie auch als ein Vorläufer von Bluetooth und Wi-Fi angesehen.
In ihrem neuen Buch "Wie Technik Geschichte macht" erzählen Sie Lamarrs Geschichte und die zahlreicher weiterer genialer Erfinder und Forscher. Viele davon haben Bezug zu den USA.
Das war in gewisser Weise unvermeidlich. Denn die Vereinigten Staaten avancierten in technologischer Hinsicht immer mehr zu einem Nabel der Welt. Dabei ahnte ursprünglich niemand, auf welchen Reichtum die USA später bauen konnten.
Sie spielen auf Erdöl an?
1767, noch vor der Gründung der USA, besuchte ein junger Missionar namens David Leisberger den indigenen Stamm der Seneca in der Gegend, die heute Pennsylvania ist. Dort am Alleghany River trat bisweilen eine übelriechende, zähe Flüssigkeit aus der Erde aus, die Seneca verarbeiteten sie zu Medizin weiter. "Brennt gut", erinnerte sich Leisberger an seinen Kontakt mit dem Erdöl. Da hatte er recht. Diese Energiequelle beherrscht die Welt, darauf stützt sich die Macht der USA. Wie schädlich sich das Erdölzeitalter für Umwelt und Klima erweisen sollte, ahnte im 18. Jahrhundert niemand.
Donald Trump hat die Losung "Drill, Baby, drill" ausgeben und will wohl das allerletzte Öl und Gas aus dem amerikanischen Boden pressen.
Selbst die großen Energieriesen sind in dieser Hinsicht zurückhaltend, denn sie wollen die Preise hochhalten. Aber oft wird tatsächlich unterschätzt, wie wichtig Erdöl nicht nur für Verkehr und Transport ist. Die chemische und pharmazeutische Industrie ist ohne Öl gar nicht denkbar.
In gewisser Weise profitierte Trump von den Errungenschaften eines anderen Forschers, den Sie porträtieren: Philo Taylor Farnsworth, der maßgeblich an der Entwicklung des Fernsehens beteiligt gewesen ist.
Ganz richtig. Farnsworth war nicht der Erfinder des Fernsehens, aber er war einer davon. Der Deutsche Manfred von Ardenne hat da etwa ebenfalls seine Verdienste, wie ich in meinem Buch ausführe. 1934 sorgte die Farnsworth zugeschriebene Erfindung in einem Museum in Philadelphia für Aufsehen, weil sich die Besucher mittels einer Kamera auf einem Bildschirm sehen konnten. Der schnellen Entwicklung des Fernsehens machte dann der Zweite Weltkrieg einen Strich durch die Rechnung, die Ressourcen wurden für den Krieg gebraucht. Nach dem Ende des Krieges begann allerdings der Siegeszug des Fernsehens, 1960 bewies es seine Macht.
Im ersten Fernsehduell in der Geschichte der US-Präsidentschaftswahlen deklassierte John F. Kennedy seinen Kontrahenten Richard Nixon?
In den Augen der Zuschauer im Fernsehen war Kennedy der eindeutige Sieger, die Hörer am Radio hatten da einen anderen Eindruck. Das Medium etablierte sich jedenfalls weiter. Donald Trump wurde den Amerikanern später noch bekannter durch seine TV-Show "The Apprentice", diesem Medium hat Trump ungeheuer viel zu verdanken. Im Juni 2024 triumphierte Trump dann im TV-Duell über den völlig überforderten Joe Biden, ein paar Monate später trat er gegen Kamala Harris an. Die schlug sich relativ gut, aber Trump spielte auf seinem ureigenen Feld, vor den Kameras.
Amerikas Macht basiert ebenso auf der Atombombe, die die USA seit 1945 besaßen und als einzige Nation jemals in einem Krieg eingesetzt haben. Ihr Porträt von Robert Oppenheimer, dem "Vater der Atombombe" lässt Zweifel an dessen geistiger Gesundheit aufkommen?
Bei Oppenheimer gingen Genie und Wahnsinn Hand in Hand. Ob er in jungen Jahren seinen Tutor tatsächlich mit einem vergifteten Apfel hat umbringen wollen, wie es bisweilen heißt, sei hier mal dahingestellt. Fest steht aber, dass er in seiner Zeit in London einen Psychiater konsultierte. Das sogenannte Manhattan-Projekt, wie die Anstrengungen der USA zum Bau der Atombombe genannt wurden, war eine gigantische Unternehmung, die auch dank Oppenheimer gelang. Denn er koordinierte die vielen, vielen am Projekt beschäftigten Wissenschaftler.
Eine Koryphäe der Wissenschaft war allerdings nicht darunter: Lise Meitner. Warum?
Lise Meitner war eine blitzgescheite Forscherin, 1906 hatte sie in Wien in Physik promoviert, als zweite Frau überhaupt erst, später wurde sie die erste Professorin für Physik in Deutschland. Spezialisiert hatte sie sich dabei auf Radioaktivität, eng arbeitete sie mit dem späteren Nobelpreisträger Otto Hahn zusammen. 1938 floh Meitner dann wegen ihrer jüdischen Herkunft aus Deutschland, sie ging nach Schweden. Als Albert Einstein dann den US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt vor der Möglichkeit einer deutschen Atombombe gewarnt hatte und das Manhattan-Projekt anlief, wurde Meitner in ihrem schwedischen Exil ebenfalls zur Mitarbeit aufgefordert.
Meitner lehnte allerdings ab.
Meitner war Pazifistin, sie wollte ihre Kenntnisse nicht zum Bau von Massenvernichtungswaffen verwenden. Als am 16. Juli 1945 in New Mexico die erste Atombombe der Geschichte detonierte, war Meitner entsprechend nicht involviert. Manche der Physiker, die die Explosion beobachtet hatten, waren geschockt, doch Oppenheimer sagte lediglich: "Es funktioniert". Sein Kollege Kenneth Bainbridge fand die vielleicht besseren Worte, wenn wir die Auslöschung von Hiroshima und Nagasaki im August 1945 betrachten: "Now we all are sons of bitches", vornehm auf Deutsch übersetzt: "Jetzt sind wir alle Hundesöhne".
Lise Meitner hasste es, nach dem Krieg als "Mutter der Atombombe" tituliert zu werden.
Oh, ja. Die meisten der beteiligten Physiker hatten ein schlechtes Gewissen angesichts dessen, was sie da geschaffen hatten. Robert Oppenheimer war später ja auch gegen die Entwicklung der Wasserstoffbombe.
Auf feindlicher Seite, nämlich der deutschen, hatte im Zweiten Weltkrieg ein anderer Spitzenforscher gearbeitet: Wernher von Braun, der als Pionier von Raketenwaffen und Raumfahrt gilt.
Von Braun war schon als Kind von Raketen begeistert, das wurde sein Lebensinhalt. Mit moralischen Erwägungen hat er sich im Dienst des Nazi-Regimes nicht aufgehalten: Allein eine der unter seiner Leitung in der Heeresversuchsanstalt Peenemünde entwickelten V2-Raketen tötete am 16. Dezember 1944 567 Menschen, als sie in ein vollbesetztes Kino im schon von den Alliierten befreiten Antwerpen einschlug. Ganz zu schweigen von den unzähligen KZ-Häftlingen, die für von Braun schufteten und starben, etwa im Konzentrationslager Mittelbau-Dora.
Bei Kriegsende waren die Amerikaner beglückt, dass sich von Braun ihnen stellte. Nicht um ihn für seine Taten zur Rechenschaft zu ziehen, sie waren stattdessen an seinen Kenntnissen interessiert.
Von Braun besaß dringend benötigtes Wissen, so konnte er ein zweites Leben in den USA beginnen. Unter seiner Führung entstanden die gewaltigen Raketen, die die Amerikaner ins All und schließlich auch zum Mond schossen. Während von Braun im Nationalsozialismus ohne Rücksicht auf Verluste seine Arbeit vorantrieb und ihn das Leid der KZ-Häftlinge und Zwangsarbeiter nicht scherte, avancierte er in Alabama, wo er arbeitete, zum Kritiker der Diskriminierung von Afroamerikanern.
Was ist Ihre Schlussfolgerung aus der Beschäftigung mit den zahlreichen in Ihrem Buch beschriebenen Erfindern und Forschern?
Bei jedweder Technologie kommt es darauf an, was wir Menschen aus ihr machen. Lise Meitner war keineswegs eine generelle Gegnerin der Nutzung der Atomkraft, aber sie wollte sie zivil zum Nutzen der Menschheit einsetzen – und eben nicht als Waffe. Dieses gewaltige Zerstörungspotenzial, das uns in Form der Atomwaffe bedroht, ist unsere Büchse der Pandora. Und wir haben sie bislang nicht zu schließen vemocht. Warten wir ab, was aus der Künstlichen Intelligenz werden wird.
Herr Gerste, vielen Dank für das Gespräch.
- Persönliches Gespräch mit Ronald D. Gerste via Videokonferenz



























