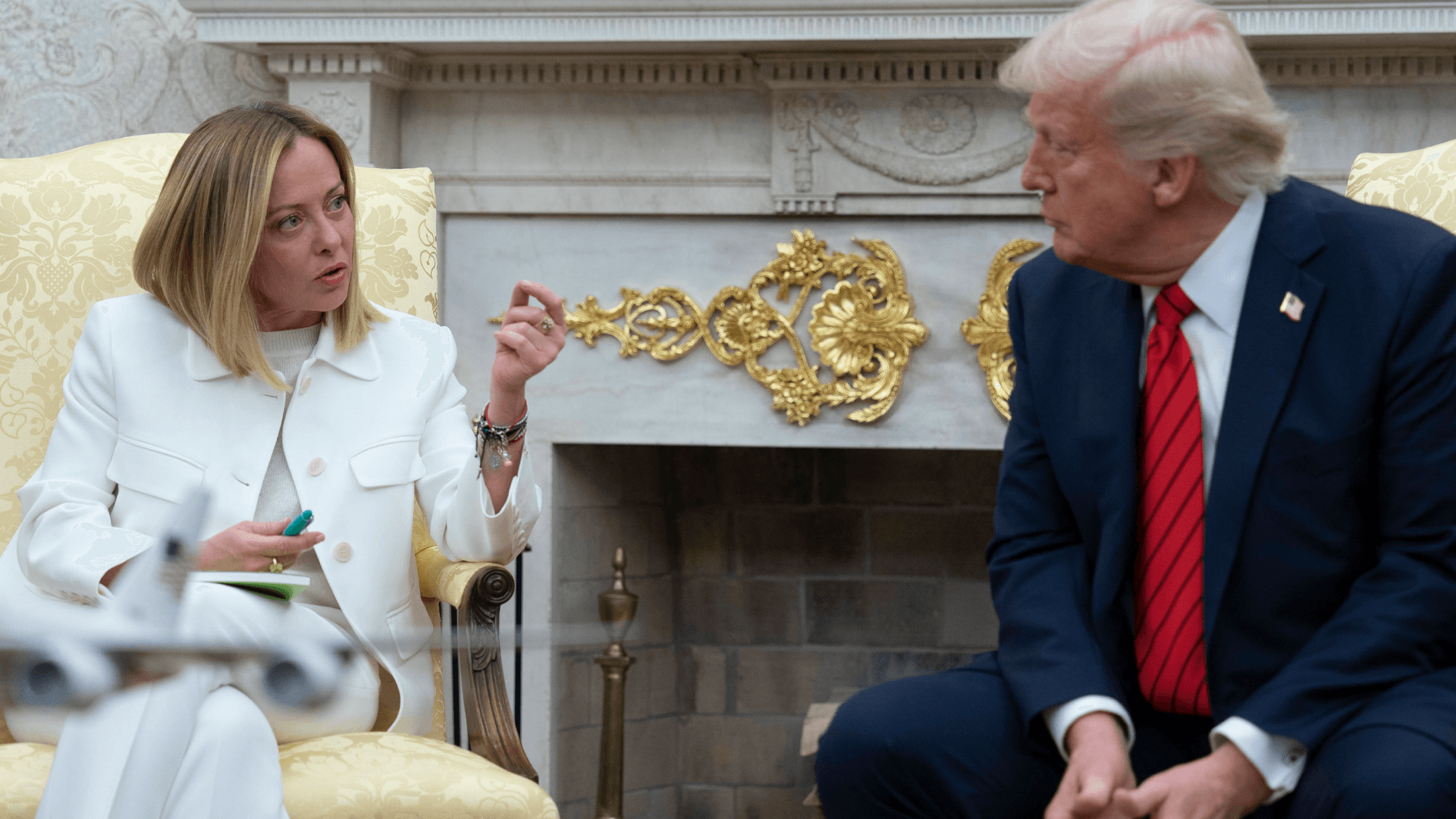Der Gesprächspartner muss auf jede unserer Fragen antworten. Anschließend bekommt er seine Antworten vorgelegt und kann sie autorisieren.
Zum journalistischen Leitbild von t-online.Grünen-Chef Habeck "Der Ausnahmezustand darf nicht zum Normalzustand werden"


Das Coronavirus stellt unseren Alltag auf den Kopf. Es stellt aber auch unsere Art, Politik zu machen, infrage. Wie gut funktioniert Demokratie in der Krise? Und was können wir daraus lernen – oder versäumen?
Robert Habeck ruft an. Journalisten führen Interviews mit Politikern normalerweise persönlich, um Stimmungen einzufangen, sich besser auf das Gegenüber einstellen zu können. Doch normal ist in Zeiten des Coronavirus nichts. Und darum geht es dann auch im Gespräch mit dem Grünen-Chef am Telefon.
Habeck spricht mit t-online.de über die Möglichkeiten und Beschränkungen der Politik in dieser Ausnahmesituation. Er denkt darüber nach, wie sich Gesellschaft durch das Virus verändern könnte. Er will positiv bleiben, sagt er. Doch er ist auch tief besorgt. Er sagt: "Am Ende haben wir es doch selbst in der Hand." Im Positiven wie im Negativen.
t-online.de: Herr Habeck, wie sehr verändert das Coronavirus Ihren Alltag?
Robert Habeck: Sehr. Es geht mir wohl wie vielen, die sonst mit anderen live zusammenarbeiten. Ich telefoniere jetzt den ganzen Tag oder sitze in Videokonferenzen. Arbeitsabläufe sind oft mühsamer, das Ohr ist abends rot telefoniert. Aber das ist natürlich nichts im Vergleich zu Eltern, die mit drei kleinen Kindern in der Zweizimmerwohnung sitzen, im Zweifel noch allein. Oder die nicht zu Hause arbeiten können, nicht wissen, wohin mit den Kindern oder Angst haben, ihren Job zu verlieren.
Wie groß ist der Einschnitt durch das Coronavirus für die Welt?
Wir erleben eine dramatische Zäsur. Es hat eine gesellschaftliche Dimension, die wir seit dem Zweiten Weltkrieg – global gesehen – nicht mehr gekannt haben. Und ökonomisch droht es, noch dramatischer zu werden als die Finanzkrise 2008/2009. Deshalb müssen wir akut alles daran setzen, mit breit angelegten Notprogrammen wirtschaftliche Existenzen zu retten. Selbstständige, kleine und mittlere Betriebe, gemeinnützige Organisationen, Industrie – die Sorgen werden mit jedem Tag größer. Solo-Selbstständige und viele Selbstständige – Musiklehrer, Therapeuten, Restaurantbetreiber, Reinigungskräfte, Paketzusteller – fallen ohne Einkünfte direkt in Hartz IV, völlig unverschuldet. Das kann doch nicht richtig sein. Nach der Phase des Stillstands werden wir dann ein Rieseninvestitionspaket an den Start bringen müssen.
Wie besorgt sind Sie?
Es hängt jetzt viel davon ab, wie lange diese Ausnahmesituation anhält. Wir können das als demokratische Gesellschaft, die auf Zusammenarbeit, soziale Interaktion, auf öffentliche Räume und Debatten angewiesen ist, nicht unbegrenzt aushalten. Wenn es gelingt, den Anstieg der Infektionen einzudämmen und in einer überschaubaren Zeit, wahrscheinlich Schritt für Schritt, wieder zur Normalität zurückzukommen, dann werden wir in einem Jahr auf die Corona-Krise zurückblicken und sagen: Gut, wie entschlossen und stark wir gehandelt haben. Wir werden die sozialen und ökonomischen Folgen wieder ausgleichen können. Wenn es länger dauert, dann weiß keiner, wie es weitergehen soll, glaube ich. Aber ich bin entschlossen, positiv darüber nachzudenken. Und ich möchte selbst alles, was ich kann, dazu beitragen, dass wir, das Land, das gut überstehen.
Sind Sie manchmal überrascht darüber, wie schnell und bereitwillig viele Menschen die sehr krassen Beschränkungen unseres Lebens akzeptiert haben?
Ich glaube, alle sind überrascht, was jetzt möglich ist und wie geschlossen wir die Schließung von Bars, Läden und Schulen als notwendig erachten. Es ist erstaunlich, wie rigoros die Gesellschaft handeln kann. All die Debatten, die wir davor über Tempolimit, Fahrverbote, Impfpflicht hatten, erscheinen vor dem Hintergrund eher relativ.
Also überrascht im positiven Sinne?
All die Einschränkungen führen uns vor Augen, was wir alles verlieren, wenn wir nicht in der offenen Gesellschaft leben und arbeiten können, die wir gewohnt sind. Dieser Ausnahmezustand, der Zusammenbruch der Wirtschaft, die Existenzangst, die Einsamkeit, das kann man nicht schönreden und es ist lehrreich für Weiteres, was wir nicht anstreben sollten, um andere Probleme zu lösen. So notwendig die Maßnahmen auch sein mögen – es ist eine Ausnahme und muss Ausnahme bleiben. Aber die Willensstärke, die wir in dieser Krise zeigen, beeindruckt mich. Das sollten wir nach der Krise nicht vergessen und für die Lösung anderer Fragen nutzen.

Embed
Sind die Einschränkungen notwendig?
Ich bin kein Mediziner und verlasse mich deshalb auf das Wissen und die Einschätzung der Fachleute. Und sie sagen: Wenn es gelingen soll, die exponentielle Infektionsrate zu stoppen, dann muss es schnell und zu Beginn passieren – also jetzt. Spätestens jetzt. Und zwar durch drastische Schritte. Deshalb sind die derzeitigen Maßnahmen richtig und geboten. Die Bundeskanzlerin hat am Mittwoch zu Recht in ihrer eindrücklichen Ansprache gemahnt, dass es jetzt auf jeden ankommt. Es war gut und dringend nötig, dass sie das mit der Wucht ihres Amtes klargestellt hat.
Gibt es für Sie rote Linien bei den Einschränkungen?
Ich habe schon Sorgen, was unkoordiniertes Handeln auslösen kann. Es darf keinen Wettkampf um die härtesten Einschnitte geben, die sich dann nicht mehr medizinisch begründen lassen. Wir sollten keinen Überbietungswettbewerb starten nach dem Motto: Ich weiß immer noch eine drastische Maßnahme mehr als du. Das ist Politikern ja leider nicht ganz fremd.
An welchen Maßnahmen zweifeln Sie?
Es ist natürlich sinnvoll, Tourismus und Reisen jetzt auszusetzen. Aber wenn Grenzkontrollen zu 80 Kilometer langen Staus führen, Familien auf der Rückkehr in ihr Land 20 Stunden an der Grenze ausharren, Lastwagen 60 Stunden, dann können die negativen Folgen irgendwann die positiven überwiegen. Es muss sichergestellt werden, dass Lieferketten nicht abreißen und die Versorgung aufrechterhalten bleibt. Und das muss europäisch vonstattengehen. Die Kanzlerin hat am Mittwoch gesagt, die Lage sei ernst und offen. Das ist weise gesprochen. Es bedeutet, dass alle Maßnahmen immer auf Erfolg und Notwendigkeit überprüft werden müssen. Das war nicht die Rede von der Alternativlosigkeit, sondern vom Gegenteil.
Eine Ausgangssperre ginge Ihnen zu weit?
Ich erlebe in Gesprächen, dass Menschen bei dieser Vorstellung ziemlich mulmig wird. Ich habe die Kanzlerin aber so verstanden, dass wir es selbst in der Hand haben, Ausgangssperren zu verhindern, indem wir uns solidarisch verhalten und die Regeln achten. Das war ja der Kern ihrer Ansprache. Sie hat deutlich gemacht, dass wir aktiv Handelnde sind. Nicht passiv. Auch wenn es sich gerade so anfühlt. Aber wir können durch unser Verhalten die Alternative zur Ausgangssperre herstellen.
Könnte sich das ändern?
Es kommt eben auf unser Handeln an. Wenn es weiterhin Corona-Partys gibt, mit denen Menschen die Logik der bisherigen freiwilligen Einschränkungen unterlaufen, ist das problematisch. Je unsolidarischer wir sind, desto drakonischer werden die Maßnahmen sein müssen. Deshalb der Appell an alle: Lasst es nicht dazu kommen.
- Bundespräsident Steinmeier: "Wir werden das Virus besiegen"
- Grünen-Analyse: Die Radikal-Realos
Ist nicht ein Grundproblem, dass unser Handeln gerade darauf abzielt, die Dauer der Ansteckungsphase zu verlängern, und deshalb dieser Ausnahmezustand erst mal zum Normalzustand werden muss?
Das Handeln zielt darauf ab, das Gesundheitssystem vor einem Kollaps zu schützen. Haben Sie gesehen, dass in Frankreich Krankenhäuser Desinfektionsmittel aus den Wahllokalen zusammenklauben? Aber der Ausnahmezustand darf nicht zum Normalzustand werden.
Wie kommt man da raus?
Am Ende steht man vor einer doppelten Abwägung, die ganz schwierig werden kann. Wenn die Maßnahmen wirken, sich das Infektionsgeschehen verlangsamt, dann steht man vor der Frage: Können wir Maßnahmen aufheben, obwohl sie gut und richtig waren? Und wenn sie nicht wirken, die Infektionen also weiter exponentiell ansteigen, dann muss man entscheiden, verabschieden wir uns von ihnen, weil sie nichts bringen, oder legen wir sogar noch etwas drauf? Maßnahmen zurückzunehmen wird eine mindestens eine ebenso schwierige Entscheidung, wie sie einzuführen.
Wer muss darüber wie befinden?
Die Entscheidung kann nur auf Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse gefällt werden. Aber am Ende wird es eine politische Entscheidung sein. Die Abwägungen werden die Bundesregierung und die Landesregierungen treffen müssen. Und sie müssen sie auch gegen möglichen Unmut kommunizieren und durchsetzen.
Das gibt der Exekutive viel Macht in dieser heiklen Lage. Braucht es Sicherheitsnetze?
Ja. Die besonders tiefen Eingriffe in unsere Grundrechte müssen immer befristet sein. Deshalb laufen jetzt ja auch die meisten Maßnahmen erst mal nur bis Ostern. Eine Regierung darf nicht die Möglichkeit bekommen, sie einfach weiterlaufen zu lassen. Darüber muss es immer wieder eine neue Entscheidung geben. Und es wäre falsch, Verantwortung nun zu monopolisieren. Es ist essenziell, dass die Demokratie und die Parlamente miteinbezogen werden. Am Ende schützt das auch die Exekutive vor dem Vorwurf der Willkür.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat t-online.de gesagt: "Unsere Antwort auf diese Krise wird Teil der weltweiten Auseinandersetzung um das beste politische System sein." Stimmen Sie ihm zu?
Der Bundespräsident zielt sicher auf die Frage ab, ob autoritäre Staaten wie China oder offene Gesellschaften wie Europa besser aus der Krise herauskommen. Ich bin davon überzeugt, dass die Demokratien da überlegen sind. Demokratien haben die Fähigkeit zur Selbstkorrektur. Sie sind die lernfähigeren Systeme. Sie haben das Potenzial, ihre eigenen Entscheidungen immer wieder zu überprüfen, von anderen zu lernen, neuen Ideen Raum zu geben. Und das werden wir für diese Krise brauchen.
Was ist Ihre Prognose für diese schwierige Zeit?
Ich hoffe, dass wir am Ende der Krise neu gelernt haben, wie wichtig Gemeinsamkeit und Solidarität sind. Ein Beispiel: Menschen, die jetzt Todesfälle zu beklagen haben, sind gerade auf sich gestellt. Trauerfeiern fallen aus, Gottesdienste fallen aus. Trost lässt sich aber oft am besten spenden, wenn man jemanden einfach in den Arm nimmt. Werden unsere Eltern, Großeltern einsam, weil niemand sie mehr besuchen soll? Die Bedeutung der direkten Begegnung, Mensch zu Mensch, wird uns noch mal viel bewusster.
Das ist die persönliche Ebene. Wie sieht es in der Politik aus?
Da stellt sich entsprechend die Frage nach der globalen Kooperation von Staaten. Europa als Einheit könnte durch die Krise zusammenwachsen. Wir könnten wieder erkennen, dass die Bekämpfung von Viren und Seuchen besser funktioniert, wenn Staaten zusammenarbeiten. Aber sicher ist das nicht. Es kann sein, dass wir im Stress der Krise unsolidarisch und egoistisch werden und ins Nationale verfallen. Das wäre falsch. Es würde uns schwächen.
Was würden Sie sich konkret wünschen?
Wir legen in Deutschland große Programme auf, um die Unternehmen über die Krise zu retten. Andere Länder können das in der Form nicht. Jetzt wäre die Stunde zu erkennen, dass es auch im deutschen Interesse liegt, wenn Europa eine stärkere fiskalpolitische Schlagkraft entwickelt. Der Europäische Stabilitätsmechanismus, der ESM, muss unkonditioniert helfen, damit in Staaten wie Italien die Sicherheit gegeben ist, dass Finanzmittel im Notfall zur Verfügung stehen. Andernfalls drohen uns ökonomische Verwerfungen. Wir sind ein gemeinsamer europäischer Wirtschaftsraum. Wenn die Wirtschaft in einem Land zusammenbricht, trifft das uns alle. Gegenseitige Sicherung stärkt das System und die nationalen Ökonomien. Nur haben wir diese Lehre nach der Finanzkrise schon einmal nicht beherzigt.
- Coronavirus: Symptome, Übertragung und Ursprung der Krankheit
- Covid-19 in Deutschland: An diesen Orten gibt es Infektionen
Auch in dieser Krise spielt die EU kaum eine Rolle. Worauf sie sich einigen konnte, ist, die Grenzen dicht zu machen. Vorher hatten viele Staaten, auch Deutschland, Ausfuhrstopps für ihre Schutzmasken erlassen. Es waren dann die Chinesen, die Masken und Ärzte nach Italien geschickt haben.
Es ist ja sogar so, dass die Staaten erst Grenzkontrollen national verordnet haben und es gar nicht europäisch koordiniert war. Im Zweifel hat sich erst mal jeder Nationalstaat um seine Bevölkerung gekümmert. Das kann man ja auch irgendwie erst mal verstehen und muss es gar nicht nur verdammen. Als gewählter Politiker steht man in der Verantwortung für die Menschen in seinem Land.
Aber?
Man darf nicht dabei stehen bleiben. Das wäre sogar fahrlässig. Wir leben in einem europäischen Binnenmarkt. Ein sehr abstrakter Begriff, aber er besagt, dass unsere Produktionsketten, unsere Wirtschaft, unsere Gesundheitsversorgung darauf angewiesen sind, dass über die Grenzen Güter transportiert werden. Wenn sich dort Schlangen bilden und die Lkw länger als normal stehen, kann das problematisch werden. Bei allem theoretischen Verständnis für nationale Politik wird zu schnell vergessen, dass Kooperation und Solidarität die Voraussetzung dafür sind, dass das Land funktioniert. Sonst müssten wir alle Güter in Deutschland produzieren. Das ist weder effektiv noch möglich.
Muss die EU also eine stärkere Rolle bekommen?
Ich bin ein Verfechter der Subsidiarität, also dem Prinzip, dass Probleme dort gelöst werden, wo sie entstehen. Gesundheitsämter sind als Ansprechpartner für die Menschen in den Kommunen richtig angesiedelt. Bundesländer, Kreise und Gemeinden können die Situation an Ort und Stelle am besten einschätzen. Der Föderalismus in Deutschland ist eine Stärke. Eine gute Koordination ist dann aber unerlässlich. Ich hoffe, dass Europa jetzt eine neue, stärkere Funktion bekommt. Gerade Pandemien, die vor Grenzen nicht haltmachen, müssen europäisch koordiniert werden. Derzeit hat Europa in der Gesundheitspolitik überhaupt keine Rolle, das muss sich ändern.
Hat der Föderalismus in Deutschland aber nicht in der ersten Phase zu einem problematischen Flickenteppich, zu Verwirrung und Unsicherheit geführt?
Ja, aber nicht weil Föderalismus und Subsidiarität grundsätzlich falsch sind. Sie sind mühsam und erfordern eben Absprache. Das muss jetzt, nach einem ja holprigen Anfang, unbedingt gelten.
Man hätte die Krise besser vorbereiten können?
Jetzt ist nicht die Zeit, zurückzuschauen und Schuld zuzuweisen, sondern nach vorn zu sehen – gemeinsam. Und so verstehen wir auch unsere Rolle als Partei: als Teil der gesamtstaatlichen Verantwortung, in der Exekutive in Ländern und Kommunen, konstruktiv und kooperationsbereit im Bund.
Können wir aus der Krise etwas lernen über unsere Art, Politik zu machen?
Ich weiß von vielen Gemeinden, Kommunen und Landkreisen, die jetzt sehr schnell eine Infrastruktur zur Beratung und Datenerfassung aufbauen. Eigentlich müssten sie dafür komplizierte, langwierige Ausschreibungen machen, aber die Zeit ist nicht da. Vielleicht sollten wir mal darüber nachdenken, zum Beispiel etwas Bürokratie im Kleinen abzuwerfen. Und sicherlich werden wir am Ende noch mehr Lehren ziehen.
Vielleicht ein Stück weit eine neue politische Kultur?
Ja, auch was unsere Fehlertoleranz angeht. Wenn sich herausstellt, dass die Grenzkontrollen nicht wirksam waren, dann stehen wir vor der Wahl: Entweder wir sagen, wie konntet ihr nur so doof sein, dieser Politiker war das, der muss sofort zurücktreten. Wir könnten uns aber auch entscheiden, zu sagen, acht Maßnahmen haben gegriffen, die neunte nicht. Wir lernen daraus.
Mehr Trial and Error, wo es notwendig ist.
Genau. Etwas mehr Spielraum in der Beurteilung politischer Entscheidungen. Wenn wir wollen, dass Politiker mutig agieren und mehr riskieren, müssen wir auch akzeptieren, dass mal etwas nicht gelingt. Das wäre allerdings ein neues politisches Paradigma der Großmütigkeit und Kreativität. Es kann aber auch sein, dass die Ungeduld, die Aggressivität, die Schuldfrage alles überstrahlt und die Gesellschaft auseinandernimmt. Wir leben ohnehin in einer hoch nervösen Zeit. Politik ist in der Regel nicht darauf ausgerichtet, tiefes Verständnis für Fehler zu entwickeln. Meist wird eine Chance gesucht, dem anderen eins auf die Mütze zu geben. Wir müssten also ganz schön gegen unsere politische Laufrichtung arbeiten.
Die Populisten allerorten könnten also am Ende doch profitieren?
Ausschließen kann man das nicht. Es kann sein, dass Populismus und neuer Nationalismus gestärkt aus der Krise hervorgehen. Im Moment habe ich das Gefühl, dass es viel Solidarität und Verständnis gibt. Das Vertrauen in staatliche Institutionen wächst gerade, glaube ich. Da wird ein Stück weit geheilt, was in den vergangenen Jahren kaputtgegangen ist. Am Ende haben wir es doch selbst in der Hand. Auch da sind wir Akteure. Wir sollten also daran arbeiten, dass wir stärken, was uns ausmacht: Gemeinschaft, soziale Interaktion, stabile Wirtschaftskreisläufe – nicht Konkurrenz.
Was stimmt Sie optimistisch?
Vergleiche sind da immer schwierig, aber früher gab es nach Krisen gemeinschaftliche Aufbrüche. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde der Völkerbund aus der Taufe gehoben, der Versuch, als Völkergemeinschaft zu agieren. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Europa als eine politische Einheit gegründet. Man kann aus Krisen als Gesellschaft, als Politik gestärkt herausgehen. Die Erkenntnis ist: All das passiert nicht einfach so, im Positiven wie im Negativen. Es muss und kann politisch erkämpft werden. Das ist die Stunde der Politik.
- Interview mit Robert Habeck per Telefon