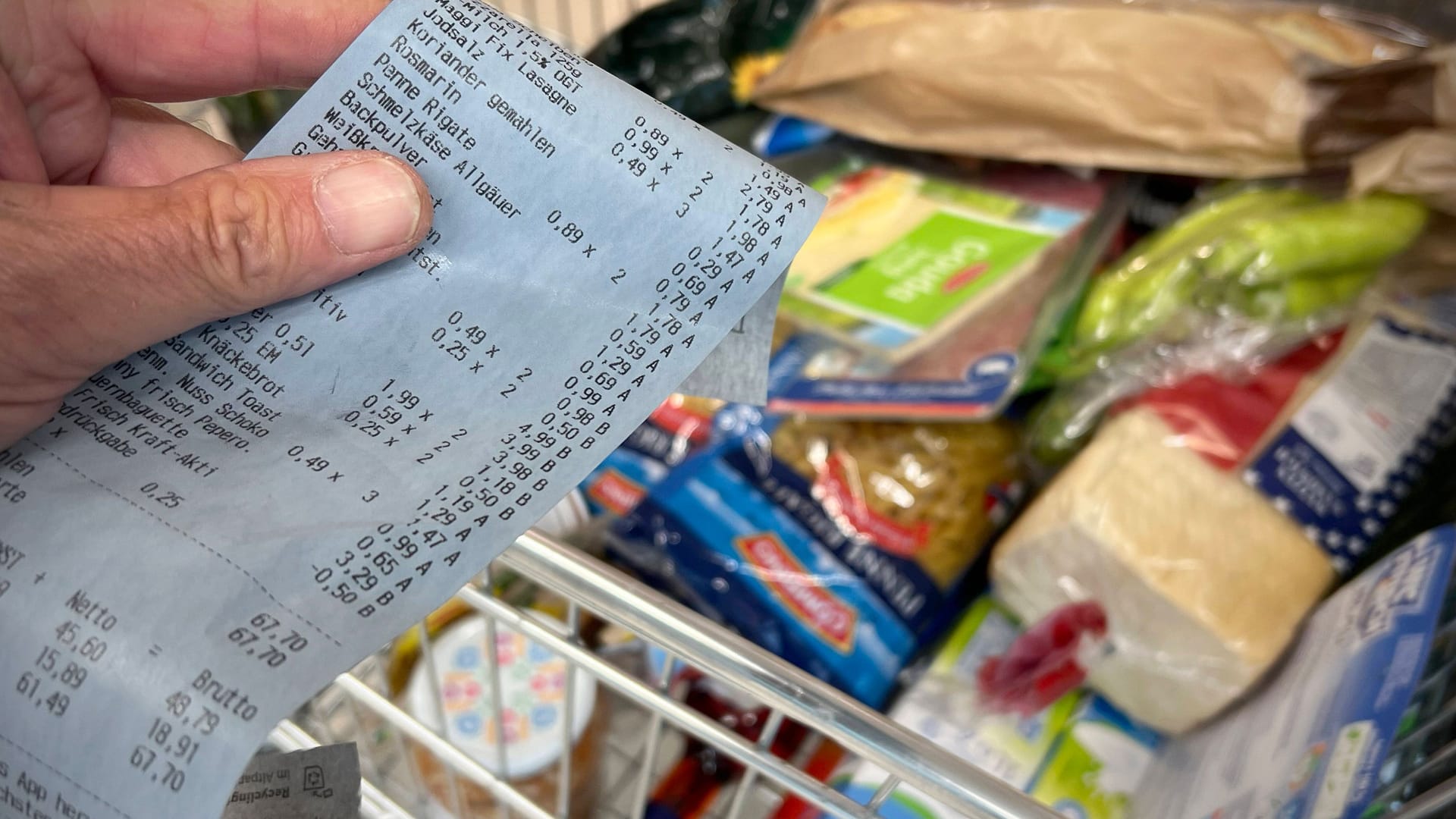Der Gesprächspartner muss auf jede unserer Fragen antworten. Anschließend bekommt er seine Antworten vorgelegt und kann sie autorisieren.
Zum journalistischen Leitbild von t-online.Debatte um Leistungsgesellschaft "Erstaunlich geschichtsblind"


Droht das Ende der Leistungsgesellschaft? Warum in der Debatte ein Blick auf ihren Anfang helfen kann, erklärt die Historikerin Nina Verheyen.
Leistung ist zu einer Art Kampfbegriff geworden. Die einen glauben, Deutschland habe sie verlernt und stürze deshalb in die Krise. Die anderen plädieren für ein neues Verständnis von Leistung, weil das aktuelle die Menschen krank mache. Die Kölner Historikerin Nina Verheyen hat untersucht, wie unser modernes Leistungsverständnis entstanden ist – und fand dabei heraus, was für ein besseres Verständnis helfen kann.
t-online: Frau Verheyen, weil wir ja über Leistung sprechen wollen: Darf ich fragen, was Sie heute schon geleistet haben?
Nina Verheyen: Kommt darauf an, was Sie unter Leistung verstehen.
Was verstehen Sie darunter?
Mir ist wichtig, dass Leistung immer auch eine Frage der Perspektive ist, zumal man streng genommen nie etwas ganz alleine leistet. Jeder ist dabei von anderen abhängig. Konkret: Ich sitze seit ein paar Stunden am Schreibtisch und schreibe an einem Fachartikel. Aber diese Leistung, wenn man so will, hängt von vielen anderen ab: Angefangen bei meinem Mann, der heute unsere Tochter in die Kita gebracht hat, bis hin zu den Studien von Kolleginnen und Kollegen, die ich für den Text gelesen habe, und die Bibliothek, über die ich diese Artikel bezogen habe. Persönliche Leistung ist also immer das Ergebnis einer Koproduktion.
- Kann Deutschland noch Leistung? Hier finden Sie alle Beiträge der Serie
Sie betonen das, weil Ihnen dieser Gedanke in der aktuellen Leistungsdebatte zu kurz kommt?
Ich betone das, weil daraus eine interessante Frage resultiert: Wieso halten so viele Menschen die Kategorie der persönlichen Leistung im Alltag überhaupt für plausibel? Das untersuche ich in historischer Perspektive, wobei aktuelle öffentliche Leistungsdebatten übrigens erstaunlich geschichtsblind sind.
Was genau meinen Sie damit?
Ich habe zum Beispiel aktuell ein Déjà-vu, wenn es heißt, die junge Generation habe sich vom Leistungsprinzip verabschiedet. Eine in Teilen ähnliche Debatte gab es in den Siebzigerjahren in der Bundesrepublik. Man sorgte sich um die Produktivität des Landes und um die Moral der jungen Generation. Damals war das eine sehr normative Debatte, was auch damit zusammenhing, dass sich Vorstellungen von Leistung veränderten. Die Jüngeren waren nicht einfach weniger an Leistung interessiert, sie hatten vor allem ein anderes Leistungsverständnis. Man wertete die Jungen ab mit dem pauschalen Vorwurf, nicht mehr an Leistung interessiert zu sein.
Mithilfe eines sehr auf die Erwerbsarbeit und messbare Produktivität bezogenen Leistungsbegriffs?
Genau. Und das zeigt bereits, dass die Kategorie der Leistung sehr unscharf und zugleich sehr vielschichtig ist. Unschärfe und Vielschichtigkeit, das ist geradezu kennzeichnend für den modernen Leistungsbegriff.
Wann und wie ist dieser moderne Leistungsbegriff denn entstanden?
Das lässt sich nicht eindeutig sagen, aber die eben angesprochene Vielschichtigkeit nahm im 19. Jahrhundert zu. Davor sprachen gelehrte Texte selten von der Leistung eines Menschen im Singular, und wenn doch, dann handelte es sich auffällig oft um Rechtsdiskurse: gemeint war etwas, zu dem ein Mensch verpflichtet war. Oder es ging um herausragendes Können. Beide Aspekte sind bis heute zu finden, aber Leistung ist noch viel mehr.
Nämlich?
Im historischen Verlauf prägten verschiedene wissenschaftliche Disziplinen das Verständnis von Leistung: Den Wirtschaftswissenschaften ging es unter diesem Stichwort um ökonomische Produktivität, die Physik zeichnete die Vorstellung von Leistung als einer physikalisch exakt messbaren Größe, die auf Krafteinsatz und das daraus resultierende Ergebnis verweist. Das moderne Leistungsverständnis ist überdies vom Gedanken sozialer Gerechtigkeit geprägt: In einer Leistungsgesellschaft soll der Status Einzelner nicht an Dinge gebunden sein, auf die er oder sie keinen Einfluss hat, wie etwa Herkunft, Hautfarbe oder die Religion der Eltern. Status soll stattdessen von eigener Anstrengung und eigenem Können, von Leistung abhängen – am besten einer, die gesellschaftlich nützlich ist. Daraus resultiert der Anspruch auf Gegenleistung, etwa Anerkennung und Geld.

Embed
Ist die Vorstellung, dass individuelle Leistung auch der Gesellschaft nutzen soll, nicht schon viel älter?
Ja. Nützlichkeit als Element von Leistung geht historisch sehr weit zurück. Ich beginne in meiner Studie allerdings erst mit dem städtischen Bürgertum um 1800: eine kleine soziale Gruppe, die im Rückblick oft als besonders leistungsorientiert dargestellt worden ist. Man spricht daher auch vom "bürgerlichen Leistungsethos" und suggeriert bis heute gern damit, dass das moderne Leistungsdenken etwas im Ursprung Bürgerliches sei. Das ist aber verkürzend.
Warum?
Für heutiges Leistungsdenken war und ist neben Unschärfe und Vielschichtigkeit auch der Gedanke der Messbarkeit und des Vergleichs zentral: Wer leistet mehr, wer leistet weniger – und wie viel mehr oder wie viel weniger? Das prägte die Art und Weise, wie Menschen über sich selbst nachdachten auch schon im späten 19. Jahrhundert, was man zum Beispiel in Tagebüchern von Männern, aber auch Frauen damals sehen kann. Um 1800 finden Sie das dagegen viel seltener.
Was wurde dann um 1800 unter Leistung verstanden?
Ich beschränke mich im Folgenden ganz auf das deutschsprachige Bürgertum und lasse andere soziale Gruppen aus. Bürgerliche Männer und Frauen sollten und wollten fleißig sein, also arbeitsam, außerdem aber auch gebildet, tugendhaft, religiös und gesellig. Die Familie und das "Gesellschaft leisten" war für ihr Selbstverständnis ganz zentral. Von unserem heutigen Leistungsverständnis führt das manchmal auf erfrischende Weise weg.
Geselligkeit war also eine Form von Leistung?
Jedenfalls war beides aufeinander bezogen. In bürgerlichen Selbstverständigungsdebatten ging es nur teilweise darum, etwas als Individuum besser zu können als andere. Mindestens so wichtig war, etwas Gutes zu tun für andere und mit anderen. Geselligkeit wurde also sehr geschätzt. Auch die Mäßigung und das Maßhalten waren zentrale Maximen. Man sollte regelmäßig arbeiten, aber nicht übermäßig.
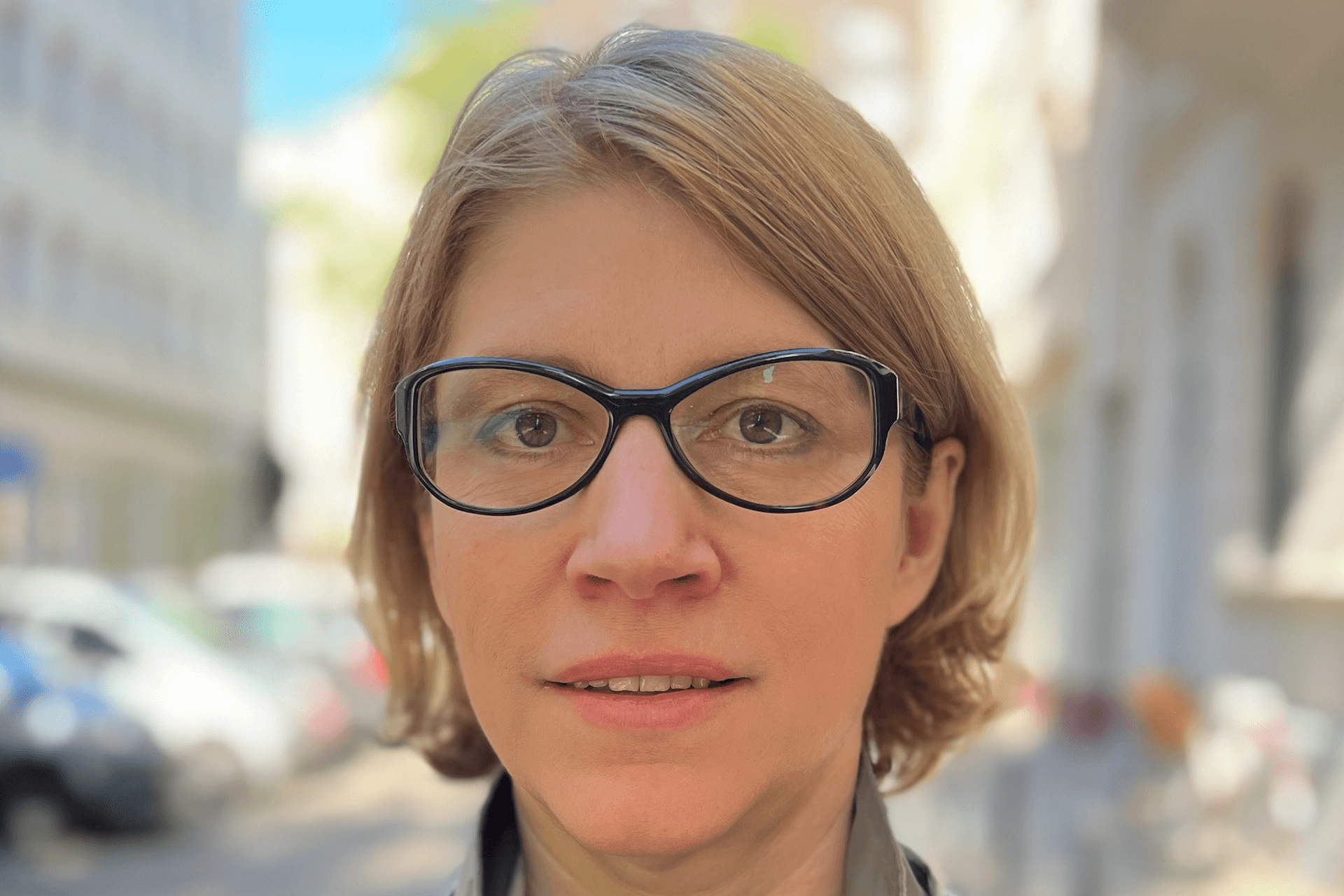
Nina Verheyen
Die Historikerin wurde 1975 in Hamburg geboren. Sie ist Privatdozentin an der Universität zu Köln und war unter anderem Gastprofessorin an der Ruhr-Universität Bochum und der FU Berlin, Fellow am Wissenschaftskolleg zu Berlin und Visiting Scholar an der Columbia University in New York. Sie forscht und lehrt unter anderem zur Kulturgeschichte des "Leistungsprinzips", zur Geschichte der Gefühle und der Alltagskommunikation. 2018 erschien ihr Buch "Die Erfindung der Leistung" im Hanser Verlag.
Klingt nach Work-Life-Balance, wie sie viele junge Menschen heute fordern.
Ja und nein. Bürgerliches Leben war ein Leben voller Aktivität, aber nicht nur auf die Erwerbsarbeit ausgerichtet. Im Selbstverständnis ging es weniger darum, wie viel man am Schreibtisch saß und wie viel man verdiente, sondern auch, wie sehr man sich für seine Stadt und die bürgerliche Gesellschaft einsetzte: für andere. Das ist in heutigen Leistungsdiskursen oft nicht enthalten und wird auch oft vergessen, wenn wir über den bürgerlichen Leistungsbegriff sprechen.
Warum ist das verloren gegangen?
Weil sich Alltagskultur und Lebensformen von Bürgerlichen verändert haben. Vor allem ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gab es immer mehr bürgerliche Männer, die, wenn man den überlieferten Quellen folgt, tatsächlich fast rund um die Uhr arbeiteten, nur die Schlafenszeiten ausgenommen, obwohl das rein finanziell keineswegs notwendig gewesen wäre. Gutes Beispiel ist ein Hamburger Bürgermeister, der starb, als er in der Nacht am Schreibtisch saß. Die Ehefrau fand ihn am Morgen tot mit dem Stift in der Hand, eine ziemliche traurige Szene aus meiner Sicht, aber der Biograf zeigte sich begeistert, sinngemäß: Was für ein herrlicher Tod für einen Mann, der ein Leben lang gewirkt hat!
Wie kam es zu dieser Veränderung?
Da gibt es keine einfache Antwort, es spielten viele Faktoren eine Rolle: Der Staat etwa verklammerte mit dem sogenannten Berechtigungswesen den Bildungsweg immer stärker mit dem Beruf: Nur wem in der Schule ausreichende Leistungen attestiert wurden, der bekam einen Abschluss, der dann zum Studium und darüber zur Ausübung eines bestimmten, vergleichsweise gut bezahlten Berufs qualifizierte. Parallel entwickelten die modernen Wissenschaften neue Strategien, um persönliche Leistungen relativ exakt zu messen – jedenfalls dem Anspruch nach. Auch globale Verflechtungen waren wichtig und die Vorstellung von Wettbewerb auf globaler Ebene. Großevents wie die modernen Olympischen Spiele oder die Weltausstellungen entstanden im 19. Jahrhundert und hatten den Anspruch, die Besten der Welt auszuzeichnen. Leistung wurde so aufgewertet, aber auch standardisiert. Das war eine Entwicklung, die zeitgenössisch positiv wie negativ bewertet wurde und die auch aus meiner Sicht beide Seiten hatte.
Was genau meinen Sie?
Es bestand keine Chancengleichheit, das war eine Illusion, aber: Soziale Mobilität wurde zumindest teilweise gestärkt. Zum Beispiel durch den Sport. Da gab es erfolgreiche Radsportler, die aus einfachen Verhältnissen stammten und dann als Radprofis zu Reichtum gelangten. Solche Aufsteiger gab es auch in vielen anderen Bereichen.
Echte Chancengleichheit ist ja bis heute eine Illusion. Ein Grund, warum der Leistungsbegriff dann im Verlauf zunehmend kritisch gesehen wurde?
Begrenzt ja. In den Sozialwissenschaften wird seit etwa den 1970er-Jahren kritisiert, dass die sogenannte Leistungsgesellschaft viel weniger sozial durchlässig sei, als sie suggeriert. Das stimmt. Ob man es heutzutage weit bringt, hängt immer noch zu stark von der sozialen Herkunft ab. Mir kommt in der Diskussion darüber aber zu kurz, dass historisch gesehen der moderne Leistungsgedanke soziale Durchlässigkeit keineswegs nur bremste, sondern für bestimmte Personen auch systematisch ermöglichte. Im frühen 20. Jahrhundert existierten zumindest für deutsche Männer klar erkennbare Wege, um über das, was als eigene Leistung galt, sozial aufzusteigen. Es gab auch Stipendien für gute Schüler. Nicht allein aus dem Gedanken der sozialen Gerechtigkeit heraus, sondern weil die Begabten im Interesse der ganzen Nation gefördert werden sollten.
Das sind die positiven Seiten des stärker individualisierten und messbaren Leistungsverständnisses. Aber Sie sprachen auch von negativen.
Ja, darüber, wie es sich auswirkt, wenn Leistung gemessen und standardisiert wird, diskutierten schon Zeitgenossen. Nehmen wir die Arbeitsprozesse in einer Fabrik und später die Fließbandarbeit, deren negative Seiten Charlie Chaplin in dem Spielfilm "Modern Times" sehr anschaulich gemacht hat: Er zeigt einen Menschen, der zu einer Art Arbeitsmaschine werden soll und der darüber fast den Verstand verliert. Er leistet dann gar nichts mehr. Das war ein Gedanke, den vorher im 19. Jahrhundert auch Wissenschaftler und Unternehmer hatten: Wie verhindern wir, dass jemand durch zu viel oder falsche Beanspruchung seine Leistungsfähigkeit verliert? Man entwickelte verschiedene Strategien, um die Arbeitsfähigkeit von Arbeitern und Arbeiterinnen zu erhalten.
Etwa durch die Begrenzung der Arbeitszeit?
Unter anderem. Schon vor dem Ersten Weltkrieg reduzierten einige Unternehmen die tägliche Arbeitszeit, teilweise aus einem sozialen, paternalistischen Verantwortungsgefühl heraus, aber auch aus ökonomischem Interesse. Der Mensch, so das Kalkül, sei eben nur dann maximal produktiv, wenn er auch Pausen mache. Für diese Erkenntnis spielte die Wissenschaft wieder eine wichtige Rolle: Die Physiologie erforschte die Leistungsfähigkeit des arbeitenden Menschen und wies nach, wie notwendig Erholung und auch freie Tage sind.
Was lässt sich aus diesen Entwicklungen nun für die aktuelle Leistungsdebatte lernen?
Zum einen, dass das moderne Leistungsverständnis trotz aller damit zusammenhängenden Probleme auch eine Errungenschaft ist. Status und Einkommen dem Anspruch nach an Leistung zu knüpfen statt an Herkunft, löste Strukturen sozialer Ungleichheit zwar nicht auf, förderte aber doch soziale Mobilität. Nicht umsonst kam schon früh Kritik am modernen Leistungsdenken vonseiten reicher Eliten und des Adels, die ihre Privilegien durch soziale Aufsteiger gefährdet sahen.
Und zum anderen?
Schon früh wurde diskutiert, dass eine Fixierung auf Leistung neue Formen der Ausgrenzung hervorrufe und gesundheitsgefährdend sei. Schon in der Jahrhundertwende kam die Klage über zu hohen Leistungsdruck bei Schülern auf und über daraus resultierende Selbstmorde. All das zeigt: Die Orientierung an Leistung ist nicht nur wandelbar, sie sollte auch immer wieder hinterfragt werden.
Frau Verheyen, danke für das Gespräch.
- Video-Interview mit Professor Nina Verheyen