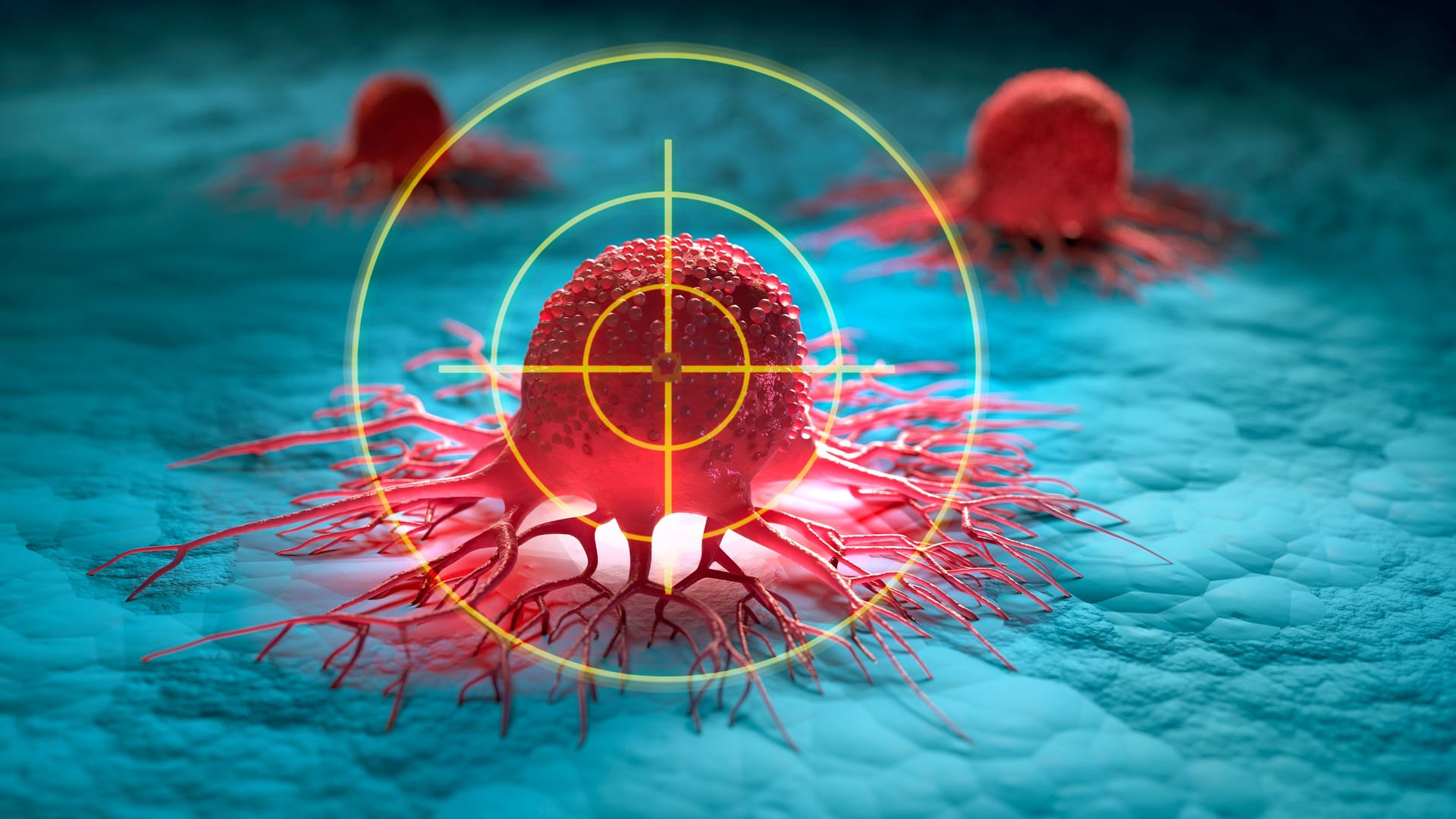Tanklaster-Skandal in Kundus "Die Deutschen haben unser Land besser gemacht"


Vor zehn Jahren ließ der Bundeswehr-Oberst Georg Klein zwei Tanklaster in Afghanistan bombardieren. Hundert Menschen starben, darunter viele Zivilisten. Wie geht es den Dorfbewohnern heute?
Abdul Rahim feierte auf einer Hochzeit, als es passierte. Vielleicht lag es an der lauten Musik, dass er von der Explosion am Fluss und dem folgenden Flammeninferno nichts mitbekam, obwohl er nur ein paar Dörfer von seinem Heimatort entfernt war.
Am nächsten Tag führte man ihn in seine Dorfmoschee. Dort waren viele der Toten des nächtlichen Bombardements hingebracht worden. "Ich bekam die verkohlten Überreste meines Sohnes in einer Plastiktüte", sagt der heute 65-Jährige. "In einer kleinen Plastiktüte. Mehr konnte ich meiner Frau von ihrem Sohn nicht nach Hause bringen."
Oberst Georg Klein gab den Befehl zum Angriff
Abdul Rahims Sohn Fasel, damals 20 Jahre alt, starb in der Nacht zum 4. September 2009, nahe der nordafghanischen Stadt Kundus. Was in jener Nacht geschah, gilt als der blutigste deutsche Einsatz seit dem Zweiten Weltkrieg. Der damalige Bundeswehr-Oberst Georg Klein hatte den Befehl gegeben, zwei Tanklaster zu bombardieren. Er befürchtete, die von den radikalislamischen Taliban entführten Laster könnten als rollende Bomben eingesetzt werden – obwohl sie in einem Flussbett feststeckten.
Auf beiden Seiten des Flusses sagen Dorfbewohner, die Taliban hätten sie erst aufgefordert, ihnen mit Traktoren zu helfen, die Tanklaster ans andere Ufer zu ziehen. Als dies nicht gelang, luden die Taliban die Dorfbewohner demnach ein, sich an dem Benzin zu bedienen. Dann bombardierten US-Kampfjets die Tanklaster. Rund hundert Menschen starben, viele von ihnen Zivilisten.
Die Affäre um das Bombardement und die anschließende Informationspolitik im Verteidigungsministerium kosteten drei Männern ihren Job: Verteidigungsminister Franz Josef Jung (CDU), Staatssekretär Peter Wichert und Bundeswehr-Generalinspekteur Wolfgang Schneiderhan. Gerichtsprozesse wurden geführt, deutsche Medien schrieben seitenlange Artikel. Doch was ist aus den beiden Dörfern und seinen Bewohnern geworden?
Karim Gul hat bei der Bombardierung zwei jüngere Brüder verloren. "Wir haben unsere Augen geschlossen und wieder aufgemacht – und zehn Jahre sind vergangen", erzählt der 30-Jährige in einem Restaurant in der Stadt Masar-i-Scharif. Es vergehe kein Tag, an denen die Mütter und Väter nicht an ihre verlorenen Kinder denken, wie er sagt.
In manchen Häusern leben keine Männer mehr
Karim Gul und vier weitere Dorfbewohner sind nach Masar-i-Scharif gekommen, da ihre Dörfer Omar Chel und Hadschi Amanullah heute von den Taliban kontrolliert werden.
Oberflächlich unterscheide sich das Leben im Dorf heute nicht von dem Leben vor zehn Jahren, erzählen sie. Die Menschen würden weiter Wassermelonen und Weizen anbauen, gingen in die Moschee zum Beten, die Kinder zur Schule. Dazwischen treibe man seine Schafe und Ziegen durchs Dorf, vorbei an den landestypischen Lehmhäusern über nicht asphaltierte Straßen hin zu den Weideflächen oder zum Fluss.
Wenn man genauer hinsehe, erzählt Gul Rahman, der Sohn von Abdul Rahim, erkenne man aber Lücken in den Familien und Häusern seit dem Unglück. Einige seien weggezogen. In manchen Häusern im Dorf gebe es seither keine Männer mehr. In anderen würden nur noch ältere Männer sitzen. "Und wieder andere haben gar keine Überlebenden, diese Häuser blieben nur mit Knochen zurück."
Geändert hat sich auch, wer diese Lücken sehen könnte. Früher wurde das Leben im Dorf unterbrochen durch regelmäßige Besuche deutscher Soldaten. Sie sprachen mit den Einwohnern, halfen ihnen, stellten mobile Kliniken auf und spielten mit den Kindern, wie Karim Gul erzählt. Rundherum hätten sie Beobachtungsposten betrieben.
Heute kontrollieren Taliban die beiden Dörfer
Nach ihrem Abzug hätten Regierungskräfte über die Dorfbewohner gewacht, an Kontrollposten in ihre Autos geschaut und die Kofferräume geöffnet. Vor rund vier Jahren seien diese dann von den Taliban rausgeschmissen worden, und nun kontrollierten die Radikalislamisten die Gegend.
Der zehn Autominuten entfernte Basar, das Bezirkszentrum, wird weiter von Regierungskräften gehalten. Da auch der Flughafen von Kundus nicht weit entfernt ist, gebe es immer wieder Gefechte. Die Taliban würden zudem am Straßenrand Bomben platzieren, um vorbeifahrende Sicherheitskräfte in die Luft zu jagen. Manche Familien seien seit 2001, dem Fall der Taliban nach der US-Invasion, zwanzig Mal geflohen und wieder zurückgekehrt.
Mehrere Tausend Dollar Unterstützung hätten die Familien der Opfer erhalten, erzählen sie. Die meisten, sagt der Dorfälteste Sajid Malik Wasiri, hätten das Geld in ihre Landwirtschaft investiert, Schafe, Ziegen oder Rinder gekauft oder ihre Häuser renoviert und ausgebaut. Die zwei halb zerstörten Tanklaster wurden mit der Zeit von den Dorfbewohnern zerlegt und teils als Altmetall verkauft. Andere Teile habe der Fluss mitgenommen, als das Wasser gestiegen sei.
Trotz des Unglücks und der vielen Lücken seien die Dorfbewohner nicht böse auf die Deutschen. "Sie haben den Afghanen insgesamt keinen Schaden zugefügt, sie haben unser Land besser gemacht", sagt Abdul Rahim. Die Amerikaner seien der Teufel, sie wollten nur Krieg, ruft einer der Männer dazwischen. "Die Deutschen sehen wir nicht negativ."
Der Dorfälteste Wasiri sagt, er habe auch nicht von einem Dorfbewohner gehört, der sich wegen der Bombardierung den Taliban angeschlossen hätte. Ein Wermutstropfen sei, dass noch immer nicht alle Familien die vollständigen Zahlungen erhalten hätten. Ein Sprecher des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr sagte, eine Prüfung dieser Aussage würde einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Männer sagen, auch ehemalige Dorfälteste hätten Zahlungen in der Vergangenheit eingesteckt – zu Unrecht.
- Zahl der Toten unklar: Taliban greifen Kundus an
- Flug nach Kabul: 31 Menschen nach Afghanistan abgeschoben
- Vor den Wahlen in Afghanistan: Taliban rufen zu Gewalt auf
Abdul Rahim, der damals die Plastiktüte aus der Moschee holen musste, findet trotz der prinzipiell guten Meinung von den Deutschen, dass es besser wäre, wenn die ausländischen Truppen das Land verlassen würden. "Wir alle sind wie Brüder hier. Wenn sie gehen, dann werden wir eine gute Zukunft haben."