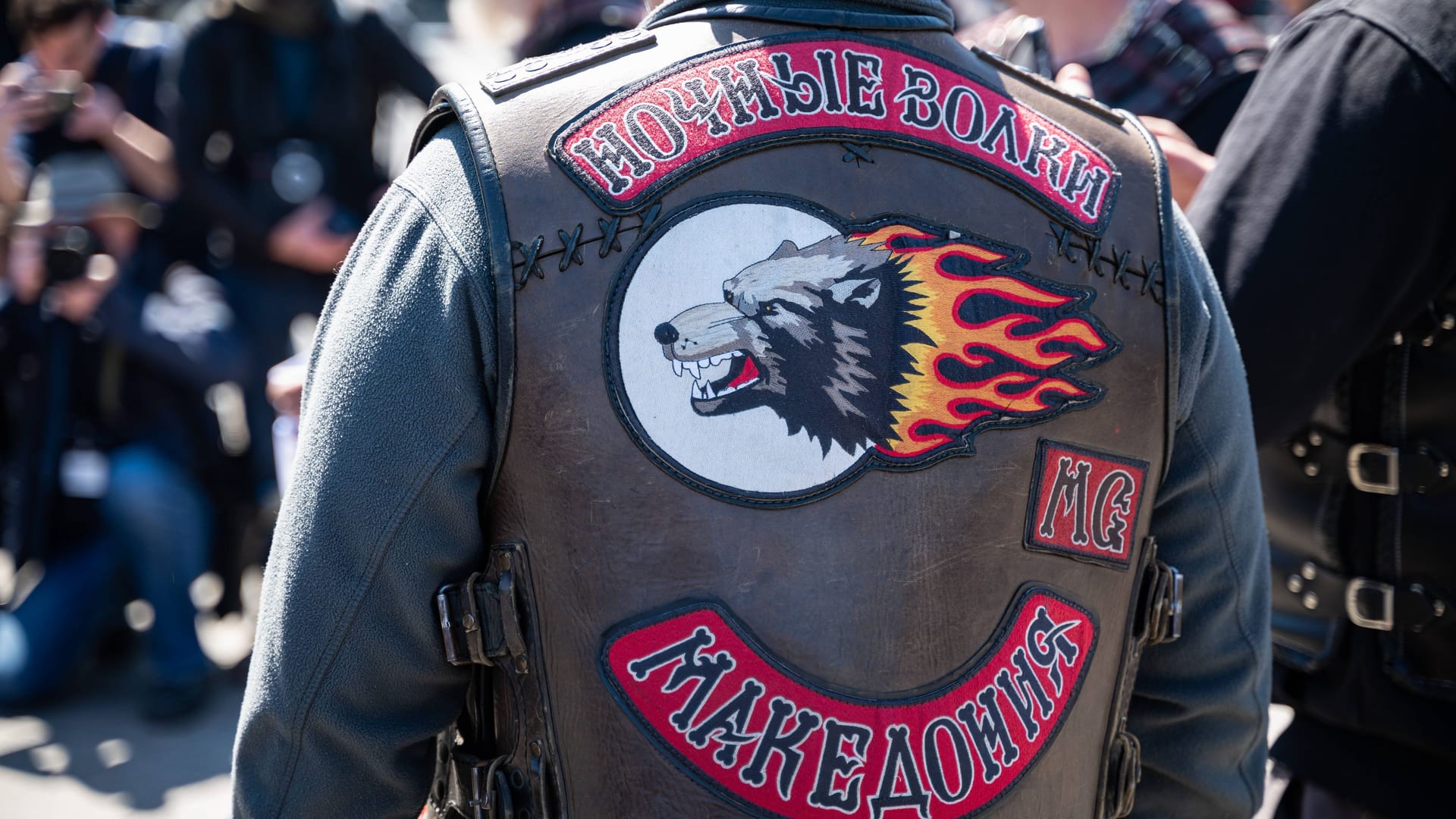Der Gesprächspartner muss auf jede unserer Fragen antworten. Anschließend bekommt er seine Antworten vorgelegt und kann sie autorisieren.
Zum journalistischen Leitbild von t-online.Russischer Exil-Journalist "Die russische Gesellschaft ist völlig niedergeschlagen"


Das unabhängige russische Nachrichtenportal "Meduza" berichtet seit 2014, dem Jahr der Krim-Annexion, aus dem Exil. Trotz Bedrohungen sind sie überzeugt, dass ihre Arbeit im Ernstfall Leben retten kann.
Das unabhängige russische Nachrichtenportal "Meduza" steht seit seiner Gründung 2014 im Exil unter massivem Druck. Nachdem die russische Regierung es 2023 als "unerwünschte Organisation" eingestuft hatte, ist es dort verboten, mit der Plattform zusammenzuarbeiten. Hinzu kommen der Stopp von USAID durch die Trump-Regierung und eine dadurch entstandene Budget-Lücke von rund 15 Prozent, persönliche Angriffe und Cyber-Attacken auf die technische Infrastruktur des Portals.
Der "Meduza"-Chefredakteur und Mitgründer Ivan Kolpakov sieht zudem kein baldiges Ende des Krieges in der Ukraine in Sicht. Der russische Staatsführer Wladimir Putin versuche lediglich weiterhin, seine Position durch Provokationen und Drohungen gegenüber Europa zu stärken. Insbesondere wegen der düsteren Aussichten betont Kolpakov im Interview mit t-online die Bedeutung unabhängiger Berichterstattung – besonders für jene, die Diktaturen gegen Zensur und Propaganda kämpfen.
t-online: Herr Kolpakov, Donald Trump wirbelt nicht nur die Weltpolitik durcheinander, auch Sie als Chefredakteur von "Meduza" waren von seinen Entscheidungen bereits betroffen. Trumps Stopp von USAID riss ein Loch in das Budget des Mediums. Wie gehen Sie damit um?
Ivan Kolpakov: Trump hat unsere Situation massiv verschlechtert. Wir finanzieren uns vor allem über Crowdfunding, aber auch über Buchverkäufe. Anfang des Jahres hatten wir dennoch eine Finanzierungslücke von etwa 20 Prozent. Durch den Stopp von USAID fehlen zusätzliche 15 Prozent unseres Budgets. Trump verschlimmert damit ein Problem, das Wladimir Putin bereits geschaffen hatte.

Zur Person
Ivan Kolpakov, geboren 1983 in Perm in Russland, ist ein russischer Journalist und Schriftsteller. Kolpakov arbeitet als Chefredakteur des kremlkritischen Nachrichtenportals "Meduza", das seit 2014 aus dem Exil in Riga, Lettland, operiert.
"Meduza" gilt in Russland seit 2023 als "unerwünschte Organisation". Jeder, der mit Ihnen in irgendeiner Form zusammenarbeitet, macht sich strafbar. Welche Folgen hatten dieser Umstand und die zusätzlichen finanziellen Probleme bisher?
Unsere Inhalte drehen sich vor allem um das Geschehen in Russland, wir haben eine tiefe emotionale Verbindung mit den Menschen, dort ist auch unsere Zielgruppe. Die Menschen in Russland sind für uns aber kaum mehr erreichbar. Von dort kann man uns auch nicht unterstützen, weil das illegal und damit gefährlich wäre. Infolge des Budgetlochs mussten wir einige Mitarbeiter entlassen, dazu haben wir Gehälter gekürzt. Andere Mitarbeiter mussten zudem befristete Verträge annehmen. Wir versuchen, an allen Ecken und Enden zu sparen.
"Meduza" ist eines der letzten unabhängigen russischen Portale, die noch kritisch über das Geschehen in Russland berichten. Insbesondere den russischen Angriff auf die Ukraine decken Sie seit 2014 ab. Wie sehen Sie die derzeitige Lage des Kriegs?
Es ist nicht abzusehen, dass Putin den Krieg in naher Zukunft stoppen wird. Er versucht, die Annäherung an Trump und die USA dafür zu nutzen, in die für ihn bestmögliche Position zu kommen. Putin will mehr als das, was er bisher in der Ukraine erreicht hat – und er hat Möglichkeiten dazu. Ich denke nicht, dass er ein anderes Land in Europa direkt angreifen wird. Aber Putin kann provozieren, er kann bedrohen und er kann die Situation an den Grenzen zur EU destabilisieren. Besonders in Lettland, wo wir arbeiten, sind die Menschen deshalb zu Recht besorgt.
Wie gestaltet sich die Situation in Russland? Im Westen hatte man lange gehofft, dass die Bevölkerung gegen Putin aufsteht.
Die russische Gesellschaft ist völlig niedergeschlagen. Derzeit befinden sich viele Menschen dort in einer Phase der Akzeptanz. Sie haben sich an die Kriegssituation gewöhnt. Die Anti-Kriegs- und Anti-Putin-Bewegung scheint am Ende zu sein. Einige, die das Land verlassen hatten, kehren zurück, weil sie gemerkt haben, dass es kompliziert ist, sich im Ausland ein neues Leben aufzubauen. Das spielt dem Regime in die Karten. Genau deshalb ist es wichtig, dass wir weiter berichten und denjenigen eine Stimme geben, die gegen Putin sind.
Glauben Sie, dass sich die russische Zivilgesellschaft trotzdem irgendwann gegen das Regime erheben wird?
Wir leben in einer Zeit der Ungewissheiten – das trifft auch und besonders auf Russland zu. Die Geschichte des Landes ist voller Beispiele dafür. In einem Moment kann das Regime stark und unbesiegbar wirken, um im nächsten Moment zu verschwinden. Mit Putins Regime ist es etwas komplizierter: Die Wirtschaft hält den Sanktionen weitgehend stand, die Rüstungsproduktion läuft auf Hochtouren, seine Armee scheint stark zu sein. Ich sehe leider keine Anzeichen für einen baldigen Wandel.
Ihre Mitarbeiter berichten teils auch direkt aus der Ukraine. Was erleben sie dort?
Die Gesellschaft in der Ukraine ist erschöpft. Dieser Krieg verlangt dem Land enorme Anstrengungen unter dem Einsatz Zehntausender Menschenleben ab. Die größten Tragödien spielen sich im humanitären Bereich ab. Unzählige Menschen sterben – und das trifft insbesondere den Teil der Gesellschaft, der sich für das Land engagiert. Für uns ist die Arbeit dort auch nicht leicht. Die Ukrainer lassen kaum russische Journalisten als Berichterstatter zu.
Ab Ende April machen Sie mit einer Ausstellung in Berlin genau das zum Thema: die Arbeit von Journalisten in Zeiten von Krieg, Zensur und Exil. Was hat es damit auf sich?
2024 hatten wir unseren zehnten Jahrestag – aber wir konnten natürlich nicht feiern. Es war für uns ein wichtiger Meilenstein, an dem wir unseren gemeinsamen Weg reflektieren wollten, aber der russische Einmarsch in die Ukraine jährte sich damals schon zum zweiten Mal. Jetzt haben wir uns dafür entschieden, diese Ausstellung zu machen. Sie basiert auf Werken zu neun großen Themen, die diese Zeit für uns definiert haben: Krieg, Exil, Zensur, Polarisierung, Angst, Einsamkeit, aber auch Hoffnung und Widerstandsfähigkeit. Letztlich haben wir uns mit Fragen, wie "Was kann die Gesellschaft für eine freie Presse tun?" und "Welchen Preis ist sie bereit, dafür zu zahlen?" auseinandergesetzt.
Ausstellung "No" in Berlin
Die Ausstellung "No" wird vom 26. April bis zum 6. Juli im Kunstraum Kreuzberg in Berlin gezeigt. Durch Kunstwerke und dokumentarische Erzählungen soll sie für "Meduza" wichtige Themen wie Diktatur, Widerstandsfähigkeit, Zensur, Krieg, Exil, Angst, Polarisierung, Einsamkeit und letztlich Hoffnung erkunden. 14 Künstlerinnen und Künstler stellen ihre Werke aus, darunter Pilvi Takala, Superflex, Gülsün Karamustafa, Fernando Sánchez Castillo, Stine Marie Jacobsen, Pavel Otdelnov, Alisa Yoffe, Alexander Gronsky und andere Künstlerinnen und Künstler aus Russland, die sich aus Sicherheitsgründen dafür entschieden haben, anonym zu bleiben.
Eigentlich liegt der Sitz von "Meduza" in der lettischen Hauptstadt Riga. Warum haben Sie sich für Berlin als Ausstellungsort entschieden?
Ich denke, dass Berlin ein guter Ort ist, an dem man die komplizierten Gespräche über diese Themen führen kann. Zum anderen aber ist "Meduza" mittlerweile teils fest in Berlin verankert, einige Mitarbeiter leben hier. Außerdem gibt es in Berlin viele Menschen, die an zeitgenössischer Kunst und auch an Politik interessiert sind. Das ist genau der Zwischenraum, in dem unsere Ausstellung existiert.
Wie ist es Ihnen ergangen, seitdem Sie das Medium 2014 in Riga gegründet haben?
Es war richtig damals, "Meduza" in Riga zu starten. Viele Leute aus unserem Umfeld fragten sich damals, warum wir unbedingt aus Russland weggehen mussten. Es war damals allerdings bereits offensichtlich, wie sich die Dinge entwickeln werden. Nach dem Beginn des Kriegs wurde Riga zu einem wichtigen Zentrum für russischen Exiljournalismus. Es ist natürlich nicht alles perfekt, aber es funktioniert für uns – und für "Meduza".

Wir stehen ständig unter Beschuss, sind ständig Angriffen ausgesetzt.
ivan kolpakov
Wie hat sich speziell Ihre Arbeit seit Kriegsbeginn verändert?
Sie hat sich komplett verändert. Als wir 2022 all unsere Mitarbeiter aus Russland evakuierten, war das ein heikler Vorgang. Dafür gibt es keine Anleitung. Wie kann man unter diesen Umständen weiter Qualitätsjournalismus machen? Das wusste damals niemand. Eine der größten Herausforderungen ist eben, dass wir in Russland zur "unerwünschten Organisation" erklärt wurden.
Dennoch berichten Sie vor allem aus Russland. Wie funktioniert das?
Derzeit arbeiten wir mit einem Netzwerk aus Freiberuflern, die in Russland unter verdecktem Namen tätig sind. Es gibt strenge Protokolle, beispielsweise für Situationen, in denen sie verhaftet werden könnten. Zudem hat seitdem der Druck der russischen Behörden und die Frequenz ihrer Cyber-Angriffe zugenommen.
Treffen diese Angriffe nur "Meduza" als Plattform oder auch beteiligte Journalisten direkt?
Wir stehen ständig unter Beschuss, sind ständig Angriffen ausgesetzt. Es gibt Beispiele, bei denen Handys unserer Mitarbeitenden mit Spionage-Software infiziert wurden. Im konkreten Fall einer Kollegin wurde das Programm sogar hier in Deutschland installiert. Das muss nicht zwangsläufig bedeuten, dass Deutschland hinter dem Angriff steckt, aber vermutlich ein anderes europäisches Land. Wir sagen uns, dass wir uns in Europa sicher fühlen können. Hundertprozentig sicher ist man mit diesem Beruf allerdings nirgends.
Glauben Sie, dass Sie jemals wieder nach Russland zurückkehren können? Ein Großteil Ihrer Familie und Ihrer Freunde müsste noch dort leben.
Wahrscheinlich kehren wir nie nach Russland zurück. Es bleibt zwar eine Option, aber solange es nicht geht, müssen wir die Menschen dort erreichen. Wir müssen relevant bleiben und verstehen, was vor sich geht. Ja, die Mehrheit meiner Freunde und meiner Familie lebt noch dort. Gleichwohl besteht natürlich immer die Gefahr, dass ihnen etwas zustößt. Bei einigen meiner Kolleginnen und Kollegen war das so. Das ist der schwierigste Teil dieser Arbeit.
Was treibt Sie heute am meisten an, trotz aller Schwierigkeiten weiterhin als Journalist zu arbeiten?
Ich muss zugeben, dass es Tage gibt, an denen ich überhaupt keine Motivation habe, alles andere wäre unehrlich. Es ist ein wirklich schwieriger Job und man fragt sich jeden Tag, ob man weitermacht oder nicht.
Warum haben Sie dann noch nicht aufgegeben?
Wissen Sie, in Russland gibt es keinen echten Journalismus mehr und deswegen ist unsere Arbeit wichtig. Wir können im Notfall Informationen bereitstellen, die im Zweifel Leben retten können. Deswegen versuche ich im Hinterkopf zu behalten, dass es Menschen gibt, die sich auf uns verlassen. Wir können zumindest in manchen Situationen dafür sorgen, dass sie eine Wahl haben.
Herr Kolpakov, vielen Dank für dieses Gespräch.
- Gespräch mit Ivan Kolpakov
- meduza.io: "Meduza" (Englisch)
- meduza.io: "For 10 years, we’ve fought censorship to bring you the truth about Russia" (Englisch)
Quellen anzeigen