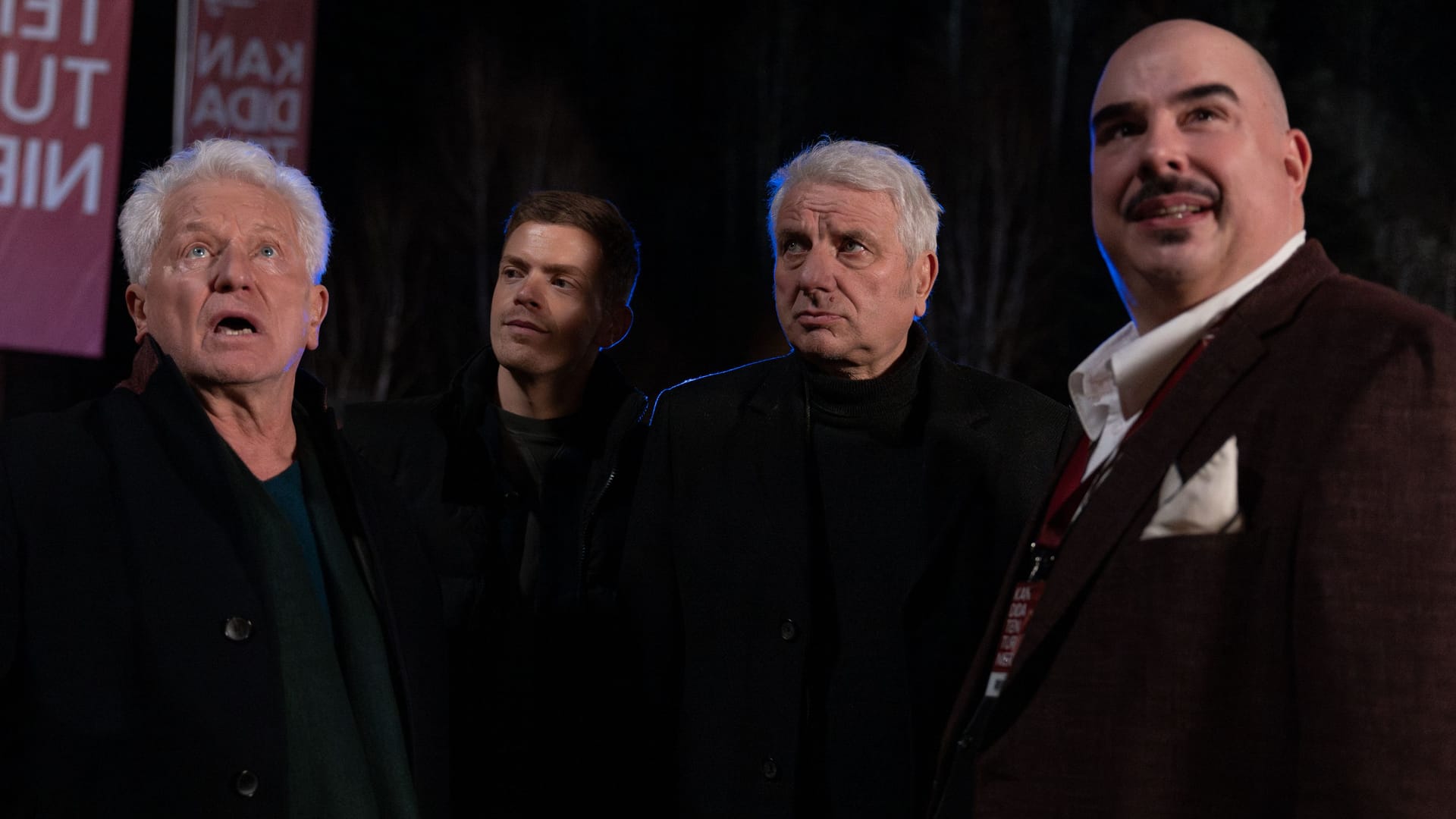Mehr als 150 Journalistinnen und Journalisten berichten rund um die Uhr für Sie über das Geschehen in Deutschland und der Welt.
Zum journalistischen Leitbild von t-online.Vatikanische Kassen Franziskus' Milliardenerbe


Papst Franziskus war nicht nur das Oberhaupt der katholischen Kirche, sondern hatte auch die Oberaufsicht über das riesige vatikanische Vermögen. So steht es um die Kirchenfinanzen.
Kurz nach dem Tod von Papst Franziskus wird viel über seinen Reformwillen gesprochen. Seine Anhänger loben seine demütige Art, die Abkehr von einem gewissen Pomp im Vatikan, die Offenheit für Veränderung, etwa in Bezug auf die Rolle der Frau. Seine Skeptiker sind in diesen Stunden eher leise, vielleicht aus Taktgefühl, vielleicht aber auch, weil sie ihre Kritik in den vergangenen mehr als zehn Jahren immer wieder angebracht haben. Ihnen war Franziskus zu liberal, dem vertrauten Ritus gegenüber zu abgeneigt.
Ein Bereich von Franziskus' Reformstreben aber steht auf beiden Seiten selten im Fokus: das Finanzielle. Dabei übernahm er sein Amt mitten in einer handfesten Krise der Kirche. 2013 hatten die sogenannten Vatileaks – interne Dokumente, von einem Insider an die italienische Presse durchgestochen – die Fehlwirtschaft im Vatikan aufgedeckt.
- Santa Maria Maggiore: Franziskus' Grab liegt inmitten uralter Geheimnisse
- Stiller Mittelpunkt des Vatikans: Der Kardinal, der vier Päpste überdauerte
- Die Stunde der Strippenzieher schlägt: Der lange Weg zum Konklave
Der damalige Papst Benedikt XIV. dankte aus Altersgründen ab. Und mit Franziskus wurde ein Mann gewählt, der nicht nur selbst einen bescheidenen Lebensstil pflegte und jegliches Gehalt ablehnte. Vielmehr wollte er seine neue Macht im Kirchenstaat dazu nutzen, wirtschaftlich aufzuräumen.
Vatikan besitzt rund 5.500 Immobilien
Die vielleicht wichtigste Erkenntnis aus den Dokumenten war, wie intransparent die Finanzen des Kirchenstaats insgesamt gehandhabt wurden. Luigino Bruni, Ökonom der Lumsa Universität in Rom, beriet Papst Franziskus wiederholt in wirtschaftlichen Fragen. "Nachdem die katholische Kirche Geld immer als etwas Schmutziges angesehen hatte, über das man nicht spricht, war das große Neuartige an Franziskus, dass er die Finanzen und die Wirtschaft ins Zentrum der katholischen Kirche gerückt hat", sagte er im "Handelsblatt".
Doch von welchen Beträgen ist dabei eigentlich die Rede? Die Güterverwaltung des Apostolischen Stuhls (Apsa) betreute laut Vermögensverwaltungsbericht 2023 mehr als 2,7 Milliarden Euro. Sie meldete für das Jahr einen Gewinn von 45,9 Millionen Euro, was einen Anstieg um 13,6 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr darstellte. Davon wurden 37,9 Millionen Euro zur Unterstützung der römischen Kurie verwendet, während die restlichen 7,9 Millionen Euro reinvestiert wurden. Als Apostolischer Stuhl wird das Amt des Papstes und die ihn unterstützende Römische Kurie bezeichnet; er stellt das zentrale Leitungsorgan des Vatikanstaats dar.
Der wichtigste Vermögenswert sind die Immobilien des Vatikans. Davon besitzt der Kirchenstaat weltweit rund 5.500. Der Großteil befindet sich in Italien, aber auch in der Schweiz, in Frankreich und England. Es handelt sich dabei um Wohnungen, Kirchen, Klöster, Büros und Land. Fast 20 Prozent der Gebäude werden zu marktüblichen Preisen vermietet, 10 Prozent werden subventioniert vermietet. Das sind wichtige Einnahmequellen für den Kirchenstaat.
Weitere Einnahmen erwirtschaftet der Vatikan über Museen, Souvenirs, Münzen, Briefmarken und Bücher sowie durch Tourismus und Spenden. Genaue Zahlen werden dazu aber nicht veröffentlicht. Hinzu kommen die Vermögenswerte der Kunstwerke, vorwiegend in den Vatikanischen Museen. Doch die Werke gelten als unverkäuflich.
Zum Vatikan gehört zudem die eigene Bank, das Istituto per le Opere di Religione (IOR), gemeinhin auch als Vatikanbank bekannt. Das Geldinstitut betreut etwa 12.000 Kunden, zu denen insbesondere katholische Einrichtungen wie Diözesen, Orden und Stiftungen zählen. Im Jahr 2023 verwaltete die Bank ein Vermögen von rund 5,4 Milliarden Euro und erwirtschaftete einen Nettogewinn von 30,6 Millionen Euro, wie die Nachrichtenagentur Religion News Service berichtet.
Mafia, Korruption, illegale Parteienfinanzierung
Gerade die Vatikanbank hatte zu Beginn von Franziskus' Amtszeit einen schlechten Ruf. In den 70er- und 80er-Jahren löste die Bank mit Mafiaverbindungen und anschließend mit Verwicklungen in Korruptionsfälle und illegaler Parteienfinanzierung Skandale aus. 2010 beschlagnahmte dann die italienische Finanzaufsicht 23 Millionen Euro wegen des Verdachts auf Geldwäsche. Längst hatte die Vatikanbank den Ruf als Offshore-Finanzzentrum mitten in Europa.
Franziskus arbeitete mit externen Finanzberatern zusammen und legte mit dem Apostolischen Schreiben "Fidelis dispensator et prudens" (zu Deutsch: "Wie der treue und kluge Verwalter") im Februar 2014 seine Änderungspläne vor. Darin wurde die Gründung eines Wirtschaftsrats beschlossen, der die finanziellen Aktivitäten des Vatikans überwachen sollte.
Das Wirtschaftssekretariat wurde eingeführt, das eine konsolidierte Bilanz erstellen und die wirtschaftspolitischen Ziele umsetzen sollte. Das Gremium erhielt einen Aufsichtsrat unter dem heutigen Vorsitz des deutschen Kardinals Reinhard Marx. Schließlich wurde das Amt des Wirtschaftsprüfers zur Haushaltskontrolle geschaffen. Erstmals galt im Vatikan nun das Vier-Augen-Prinzip, sodass Beschlüsse nie nur in einem Gremium gefällt werden konnten.
Bei der Vatikanbank wechselte Franziskus den Verwaltungsrat aus und verstärkte insgesamt die Finanzaufsicht des Vatikans, indem er die meisten Italiener entfernte und ein internationales Gremium mit internationalen Finanzexperten einsetzte. In der Folge wurden mehr als 1.600 Konten bei der Bank geschlossen und rund 10 Prozent der Kundenbeziehungen beendet.
"Ein wirklich schrecklicher Moment"
Hinter Franziskus' Reformen stand dabei das Wissen, dass er die Kirche insgesamt nur reformieren könnte, wenn er auch die Finanzen in Angriff nähme. Gleichwohl gab es auch eine Reihe von Rückschlägen.
Im Herbst 2019 wurde etwa bekannt, dass das vatikanische Staatssekretariat eine Luxusimmobilie in London mit großen Verlusten verkauft hatte, obwohl Millionen an den Vermittler geflossen waren. Daraufhin wurde dem Staatssekretariat die Entscheidungsgewalt über die Finanzen entzogen und der Güterverwaltung Apsa zugeteilt. Der zuständige Kardinal Angelo Becciu wurde 2023 vom Gericht im Vatikan zu mehr als fünf Jahren Gefängnis verurteilt, will aktuell aber dennoch beim Konklave dabei sein, wie Sie hier nachlesen können.
Es war "ein wirklich schrecklicher Moment", berichtete Franziskus, "aber ich hatte immer das Gefühl, dass ich weitermachen musste, ohne etwas zu vertuschen", schrieb er in seiner im Januar erschienenen Biografie über diese Zeit.
Sind die Reformen abgeschlossen?
Letztlich war Franziskus selbst mit den Ergebnissen seiner Reformen zufrieden und erachtete sie 2022 als abgeschlossen. Tatsächlich gilt das einstige Skandalinstitut, die Vatikanbank, heute als angesehene Institution.
Doch vor allem sein Aufruf zu mehr Sparsamkeit hat bislang nicht unbedingt Wirkung gezeigt. Denn trotz des großen Vermögens verzeichnete der Vatikan im Jahr 2024 ein Haushaltsdefizit von rund 83 Millionen Euro; ähnlich sah es im Vorjahr aus, wie verschiedene Medien berichten.
Das Spendenaufkommen ist rückläufig, gerade in wohlhabenden Ländern mehren sich die Kirchaustritte. Das veranlasste Franziskus im Herbst des vergangenen Jahres sogar zu einem emotionalen Brief an die Kardinäle, in dem er zu "Mut und Dienstbereitschaft" aufrief, das Defizit auch durch eigene Sparsamkeit zu reduzieren.
Der Präsident der Güterverwaltung Apsa, Giordano Piccinotti, widerspricht der Auffassung, die Reformen seien schon abgeschlossen. Anfang 2025 schätzte er, dass es noch fünf bis zehn Jahre dauere, bis das so weit sei. Beobachter gehen davon aus, dass das am mangelnden Kooperationswillen in Teilen der Verwaltung liegt. So haben die Reformen den Einfluss der Kardinäle beschränkt, was viele Franziskus offenbar auch über Jahre noch nachtrugen. Das zeigt sich auch am andauernden Konflikt zwischen der Güterverwaltung Apsa und der Vatikanbank: Trotz klarer Anordnung des Papstes, alle liquiden Mittel bei der Bank zu deponieren, sind es bis heute lediglich rund 35 Prozent, wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" schreibt.
Das Haushaltsdefizit belastet zudem die Mitarbeiter. Zuletzt beschwerten sich rund 5.000 Angestellte der Vatikanverwaltung, dass die Sparmaßnahmen vor allem sie in Form von Gehaltskürzungen und unbezahlten Überstunden träfen. Auch die Renten gelten nicht mehr als sicher. Die Pläne von Franziskus sind bislang also nicht vollständig aufgegangen. Sein Nachfolger übernimmt den Kirchenstaat zwar nicht in einer Krise, aber in einer andauernden Umbau- und Findungsphase.
- handelsblatt.com: Wie Franziskus die Finanzen des Vatikans reformierte (Bezahlinhalt)
- kirche-und-leben.de: Papst mit dramatischem Spar-Appell an Kardinäle – hohes Haushalts-Minus
- faz.net: Der Vatikan braucht Geld (Bezahlinhalt)
- katholisch.de: Vatikan-Finanzaufsicht friert Millionenbeträge ein
- srf.ch: Franziskus' holpriger Weg zu mehr Transparenz
- msn.com: Papst Franziskus hinterlässt ein Milliarden-Imperium
- orf.at: Vatikan-Vermögen: Verwaltung legt Bilanz vor
- freitag.de: Wie Papst Franziskus die Boni von Kardinälen strich und Finanz-Skandale im Vatikan stoppte (Bezahlinhalt)
Quellen anzeigen