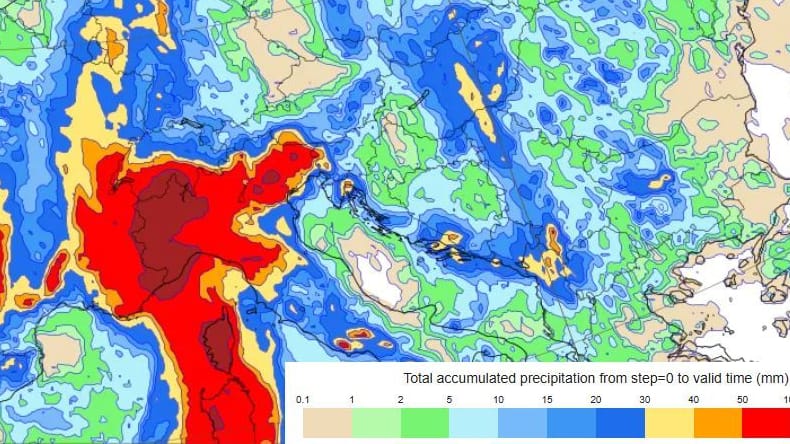Mehr als 150 Journalistinnen und Journalisten berichten rund um die Uhr für Sie über das Geschehen in Deutschland und der Welt.
Zum journalistischen Leitbild von t-online.Krieg in der Ukraine Trump löst Chaos aus


Die Ukraine steht nach der Münchner Sicherheitskonferenz vor einer ungewissen Zukunft. US-Präsident Donald Trump lässt in Deutschland nicht seinen Friedensplan vorstellen. Stattdessen sorgt er für Chaos und große Unsicherheit.
Aus München berichtet Patrick Diekmann.
Er war in München nicht anwesend, schaffte es aber trotzdem, die Agenda der diesjährigen Sicherheitskonferenz zu bestimmen. US-Präsident Donald Trump hat in den ersten Wochen seiner zweiten Amtszeit die internationale Politik durcheinandergewirbelt. Fast jeden Morgen eine neue Ankündigung, eine neue Idee, und oftmals Empörung auch bei den westlichen Verbündeten der Amerikaner. Er will Grönland kaufen, den Panama-Kanal besetzen, die Palästinenser aus dem Gaza-Streifen vertreiben. Und bislang ließ der US-Präsident nur wenig Zweifel daran, dass er seine kruden Ideen vielleicht doch ernst meinen könnte.
In München stand vor allem der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine im Zentrum der Debatten. Trump war zwei Tage vor Beginn der Sicherheitskonferenz in die Offensive gegangen: Er telefonierte mit Wladimir Putin, will den Kremlchef in Saudi-Arabien treffen. Ein schneller Frieden soll her. Die Ukraine soll Territorium an Russland abtreten, ihre europäischen Verbündeten sollen den Wiederaufbau des Landes bezahlen und für Sicherheitsgarantien sorgen, damit Putin nicht erneut angreift.
Der Profiteur dieser Idee wäre vor allem Trump. Er könnte sich als Friedensstifter inszenieren und gleichzeitig mit der weiteren militärischen Aufrüstung der Ukraine viel Geld verdienen. Ein Geschäft auf Kosten der Ukraine, befürchteten in München viele. Angst und Empörung wechselten sich mit Blick auf einen möglichen Ukraine-Plan der USA ab.
Dabei gab es bei der Sicherheitskonferenz keine großen Ankündigungen der Amerikaner. Trump zeigte vor allem eines: Dass er bislang keinen Plan hat. Der US-Präsident schlägt mit seinen Vorstößen aufs diplomatische Wasser, schaut, wie andere Staaten darauf reagieren. Aber genau damit setzt er die US-Verbündeten unter Druck, verbreitet Panik im westlichen Bündnis und in der ukrainischen Regierung. Ein Ausfall der USA wäre für die Ukraine fatal – und die Furcht vor eben diesem Szenario wächst.
Sicherheitskonferenz wird zur emotionalen Talabfahrt
Für viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Münchner Sicherheitskonferenz war die dreitägige Tagung eine emotionale Talabfahrt, besonders angesichts der stetigen Erschütterungen für das transatlantische Bündnis. Vor allem die Rede des US-Vizepräsidenten J. D. Vance am Freitag wühlte viele Politiker, Diplomaten und politische Beobachter auf. Vance ätzte gegen europäische Demokratien, warf ihnen Zensur vor, weil viele europäische Parteien eben nicht mit der extremen Rechte zusammenarbeiten möchten.
Das wurde vor allem in Deutschland eine Woche vor der Bundestagswahl als indirekte Wahlkampfhilfe für die rechtspopulistische AfD verstanden und löste bei vielen Teilnehmern Empörung aus. Die Folge: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Vizekanzler Robert Habeck (Die Grünen) sowie CDU-Chef Friedrich Merz überboten sich am Samstag gegenseitig mit Kritik an der Trump-Administration und stellten sich verbal schützend vor die Souveränität der deutschen Demokratie.
Vance' Rede gab den politischen Takt für den weiteren Verlauf der Konferenz vor. Im Hotel Bayerischer Hof waren Gespräche darüber allgegenwärtig. Politiker, Diplomaten, Staats- und Regierungschefs steckten in den Gängen des Hotels die Köpfe zusammen, viele waren aufgeregt, ja empört. Es gab aber auch Teilnehmer, die Schlimmeres erwartet hatten, eine Vance-Rede mit mehr Sprengkraft für die europäische Sicherheitsarchitektur.
- Exklusiv: Verteidigungspolitikerin Strack-Zimmermann im Podcast:

Embed
Kurz vor Beginn der Sicherheitskonferenz hatten europäische Diplomaten einen ersten Fingerzeig bekommen, welche Inhalte Vance in seiner Rede thematisieren könnte, erfuhr t-online in München. Aber die Informationen waren vage: Befürchtet worden war der Abzug von US-Soldaten aus Deutschland und Europa, ein US-Friedensplan für die Ukraine, der für das angegriffene Land einer Kapitulation gleichkäme. Oder gar ein direkter Wahlaufruf für die AfD.
Trump spielt mit eigener Unberechenbarkeit
Einigkeit gab es darüber, dass Vance' Rede ein Eklat war. Schließlich bezeichnete Trumps Vize die EU-Staaten als gefährlicher als Russland oder China. Aber die Lesart der Provokationen unterschied sich in München durchaus: Während in Deutschland die Empörung überwog, sahen sich andere europäische Diplomaten mit einem blauen Auge davongekommen. Immerhin habe Trump in München noch nichts Substanzielles zertrümmern lassen, meinten einige. Jedenfalls noch nicht.
Im westlichen Bündnis mischt sich derzeit Wut mit Zweckoptimismus. Sicherlich schimpfen viele Vertreter über den politischen Trump-Sturm, der viele diplomatische Scherbenhaufen hinterlässt. Trump wütet, andere müssen hinter ihm aufräumen.
In München fiel auf, dass selbst US-Vertreter Schwierigkeiten haben, die Politik des US-Präsidenten zu erklären. Das mag Strategie sein, denn Trump profitiert auch von seiner Unberechenbarkeit. Schließlich zeigte er in den ersten Wochen seiner zweiten Amtszeit bereits, dass weder Putin noch die EU sicher sein können, welcher Einschlag am kommenden Tag aus Washington kommt.
Aber bei der Sicherheitskonferenz wurde vor allem eines deutlich: Die US-Strategie ist kein koordiniertes Chaos – sondern lediglich Chaos. US-Vertreter konnten in der bayrischen Landeshauptstadt Trumps Politik kaum erklären und schon gar keine Prognosen abgeben. Oft wurde stattdessen in Gesprächen darauf verwiesen, dass der US-Präsident ein Geschäftsmann sei. Trump gehe ohne genauen Plan in die Offensive, wage etwas, würde dann seine Politik korrigieren, wenn die gewünschten Effekte ausbleiben.
So wie ein US-Unternehmer, der ein Start-up gründet und dabei Risiken eingeht. Das Problem dieser Argumentation: Trump ist kein Unternehmer mehr, er ist US-Präsident. In dieser Rolle kann er selbst mit Ankündigungen oder undurchdachten Ansätzen einen massiven Schaden anrichten, gegenseitiges Vertrauen zertrümmern – und damit die Geschlossenheit des westlichen Bündnisses. Der republikanische Senator Lindsey Graham formulierte am Samstag in München präzise, was nun für Freunde und Gegner der USA gleichermaßen gilt: "Wer Trump nicht fürchtet, ist verrückt."
US-Regierung legt Partnern Fragebogen vor
Mit dieser Unberechenbarkeit kann Trump nur durchkommen, weil er eben der US-Präsident ist, die USA die dominierende Supermacht sind. Bei der Sicherheitskonferenz mussten andere das ausbaden, etwa Saudi-Arabien. Denn das saudische Königshaus soll Gerüchten zufolge erst durch Trumps Ankündigung erfahren haben, dass es Friedensgespräche zwischen der US-Regierung und dem Kreml ausrichten soll. Ein Gerücht, das sich im Konferenzhotel wie ein Lauffeuer verbreitete.
Der US-Präsident legt also ein Tempo vor, welches für die organisatorische Planung der US-Diplomatie zu schnell ist. Auch Mitglieder der US-Administration geraten da in München ins Schwimmen, vor allem US-Außenminister Marco Rubio und Trumps Sonderbeauftragter für die Ukraine, Keith Kellogg. Gleichzeitig soll es selbst mit Vance hinter verschlossenen Türen konstruktive und sogar freundliche Gespräche gegeben haben, berichteten unterschiedliche deutsche Delegationen.
Die US-Regierung sendete also unterschiedliche Signale: Die Forderungen an die EU-Staaten, die Trump oder Vance öffentlich verkünden, um den Druck zu erhöhen. Hinter verschlossenen Türen soll die US-Regierung zunächst einmal Deutschland und anderen europäischen Alliierten einen Fragebogen vorgelegt haben, um mögliche europäische Beiträge zu Sicherheitsgarantien für die Ukraine ermitteln zu können.
Was auf den ersten Blick wie der nächste Eklat aussehen mag, ist allerdings gar nicht so unvernünftig. Denn es stellt sich durchaus die Frage, zu welchen Beiträgen die Europäer in der Lage sind, welche Waffensysteme sie liefern können und was sie von den USA erwarten. Eine Erfassung des europäischen Potenzials macht aus Sicht der Amerikaner dabei Sinn.
Furcht vor dem Katzentisch
Die Frage ist lediglich, ob konstruktive und realistische Ansätze auch Einzug in Trumps Politik haben werden, die sich aktuell eher durch das Aufstellen von Maximalforderungen auszeichnet. Nach der Sicherheitskonferenz lässt sich lediglich bilanzieren: Der Druck aus Washington wirkt. Denn um die Frage, was die Europäer zu einem möglichen Friedensdeal beitragen können, soll es bereits an diesem Montag auch bei einem Treffen von Bundeskanzler Olaf Scholz und anderen europäischen Staats- und Regierungschefs in Paris gehen.
Die Europäer wollen den USA Tätigkeit demonstrieren, Signale der Geschlossenheit senden. Vor allem verfolgen sie damit das Ziel, Trump für eine weitere Zusammenarbeit zu motivieren. Denn eines liegt auf der Hand: Ohne die USA ist die Existenz der Ukraine gefährdet, ohne sie werden kurzfristige Sicherheitsgarantien nur schwer möglich sein.
Trump spricht seine Außenpolitik nicht mit den US-Verbündeten ab, stellte das westliche Bündnis schon mit Blick auf das Treffen mit Putin vor vollendete Tatsachen. Auch deshalb wächst die Sorge in Europa, dass er am Ende mit Putin über die Köpfe der Ukraine und der EU-Staaten einen Frieden aushandeln wird. Putin und Trump verhandeln, Kiew und die Europäer sitzen am diplomatischen Katzentisch.
Trump-Dilemma der Ukraine
Für Europa geht es dabei auch um einen Bedeutungsverlust auf der Weltbühne. Die Aussicht, an Verhandlungen über das Ende eines Krieges in Europa nicht beteiligt zu sein, rief in München Fassungslosigkeit hervor. Auch wenn die Stimmen aus Washington sich hierzu zum Teil widersprachen, die bisher bekannten Pläne der US-Regierung sehen keine europäische Beteiligung vor. Trumps Sonderbeauftragter Kellogg sagte in München lediglich, die Europäer könnten "einen Beitrag leisten".
Für die Ukraine und ihre westlichen Verbündeten geht es deshalb nun darum, in die Offensive zu kommen. Sie möchten Kräfte bündeln, um Trump politischen Widerstand leisten zu können. Und sie brauchen einen Plan, um der US-Regierung etwas entgegensetzen zu können. Trump bewirkt, dass die EU-Staaten und Großbritannien zusammenrücken. Auch das wurde auf der Sicherheitskonferenz deutlich. Denn bei den zahlreichen Diskussionsveranstaltungen fiel der Zusammenhalt auf, mit denen die Europäer gegen die US-Regierung argumentierten – so übten viele EU-Vertreter deutliche Kritik an Trump, weil dieser die Nato-Mitgliedschaft für die Ukraine ausschließen wollte.
Warum sollte diese Option noch vor den eigentlichen Verhandlungen vom Tisch verschwinden? Darin sah die überwiegende Mehrheit der Teilnehmer in München einen strategischen Fehler des US-Präsidenten.
Vor allem die Ukraine scheint nun letztlich der politischen Willkür des US-Präsidenten ausgeliefert zu sein. Deshalb strebt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj an, Teil der Solidarität innerhalb der Europäischen Union und der Nato zu werden. "Seine Launen haben die Macht, Nato-Entscheidungen zu blockieren", kritisierte Selenskyj in München, den Ausschluss einer Nato-Mitgliedschaft der Ukraine durch die US-Regierung.
"Putin lügt, und er ist vorhersehbar, er ist schwach, und das müssen wir ausnutzen." Doch für die Ukraine läuft es im Krieg gegen Russland aktuell nicht gut. Zwar kann Selenskyj auf die Solidarität von EU-Staaten bauen. Aber das wird nicht reichen. Ohne Trump und die US-Militärmacht wird es für Kiew eng werden. Es ist das zentrale Dilemma, das auch bei der Münchner Sicherheitskonferenz ungelöst bleibt.
- Teilnahme an der Münchner Sicherheitskonferenz
- Nachrichtenagentur dpa
- Eigene Recherche
Quellen anzeigen