
Die subjektive Sicht des Autors auf das Thema. Niemand muss diese Meinung übernehmen, aber sie kann zum Nachdenken anregen.
Was Meinungen von Nachrichten unterscheidet.Heuchlerische Klimaschützer? Die grüne Welle bleibt an der Kasse stehen


Mehr Klimaschutz ja, aber Geld kosten darf er nicht. Sind die Deutschen heuchlerisch? Nein, sie sind menschlich, findet unsere Kolumnistin.
Eine Mehrheit der Deutschen will mehr Klimaschutz, kosten darf er sie aber nichts. Zu dem Ergebnis kommt eine Umfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). Angesichts dieses Ergebnisses höre ich bereits Vorwürfe der Heuchelei laut werden. Ich gebe zu: Wenn sich Menschen beschweren, dass ausgerechnet bei ihnen keine Windräder aufgestellt werden sollen, erwische ich mich selbst manchmal bei einem Augenrollen. Aber der Reflex greift zu kurz: Die Frage nach den persönlichen Kosten lässt sich nicht einfach abtun.
Das Interesse am Klimaschutz war tatsächlich schon mal höher. In den vergangenen Wahlkämpfen spielte das Thema kaum eine Rolle. Andere Sorgen haben die Klimakrise in den Hintergrund gedrängt. Inflation, Konjunktur, Migration, innere und äußere Sicherheit. Die Klimakrise ist dadurch nicht irrelevant geworden – nur weniger greifbar.
Dass Menschen in einer Welt der multiplen Krisen zusehen müssen, wo sie bleiben – finanziell und existenziell –, ist nicht verwunderlich. Es ist menschlich.
Wenig Unterstützung für Öko-Kosten
Dem IW zufolge befürworten nur 29,9 Prozent der Befragten, ökologische Kosten auf den Preis von Produkten und Dienstleistungen umzulegen. Selbst unter Anhängern der Grünen stimmten nur 68,9 Prozent zu.
Gleichzeitig sehen viele die Verantwortung bei anderen. Die Mehrheit der Deutschen sieht der Befragung des IW zufolge vor allem Unternehmen (65 Prozent), die Regierung (57 Prozent) und andere Bürger (56 Prozent) in der Verantwortung, mehr für den Klimaschutz zu tun. Nur 37 Prozent der Befragten sind jedoch der Meinung, dass sie selbst zu wenig unternehmen, um die Klimakrise zu bewältigen. Das IW überschreibt eine Pressemitteilung dazu daher mit dem Titel "Klimaschutz: Zwischen Zeigefingermentalität und Zumutungsaversion".
Einen tieferen Eindruck liefert die PACE-Studie unter der Leitung der Uni Erfurt, die regelmäßig untersucht, wie sich Einstellungen zu politischen Maßnahmen und Handlungsbereitschaft im Umgang mit der Klimakrise entwickeln. Dies hängt demnach von vielen unterschiedlichen Faktoren ab. Menschen sind eher bereit, Maßnahmen gegen die Klimakrise zu ergreifen und zu unterstützen, wenn sie Gesundheitsrisiken für sich selbst und ihre Angehörigen durch den Klimawandel befürchten. Noch entscheidender ist aber, ob sie das Gefühl haben, selbst etwas bewirken zu können – und ob ihr Umfeld mitzieht.
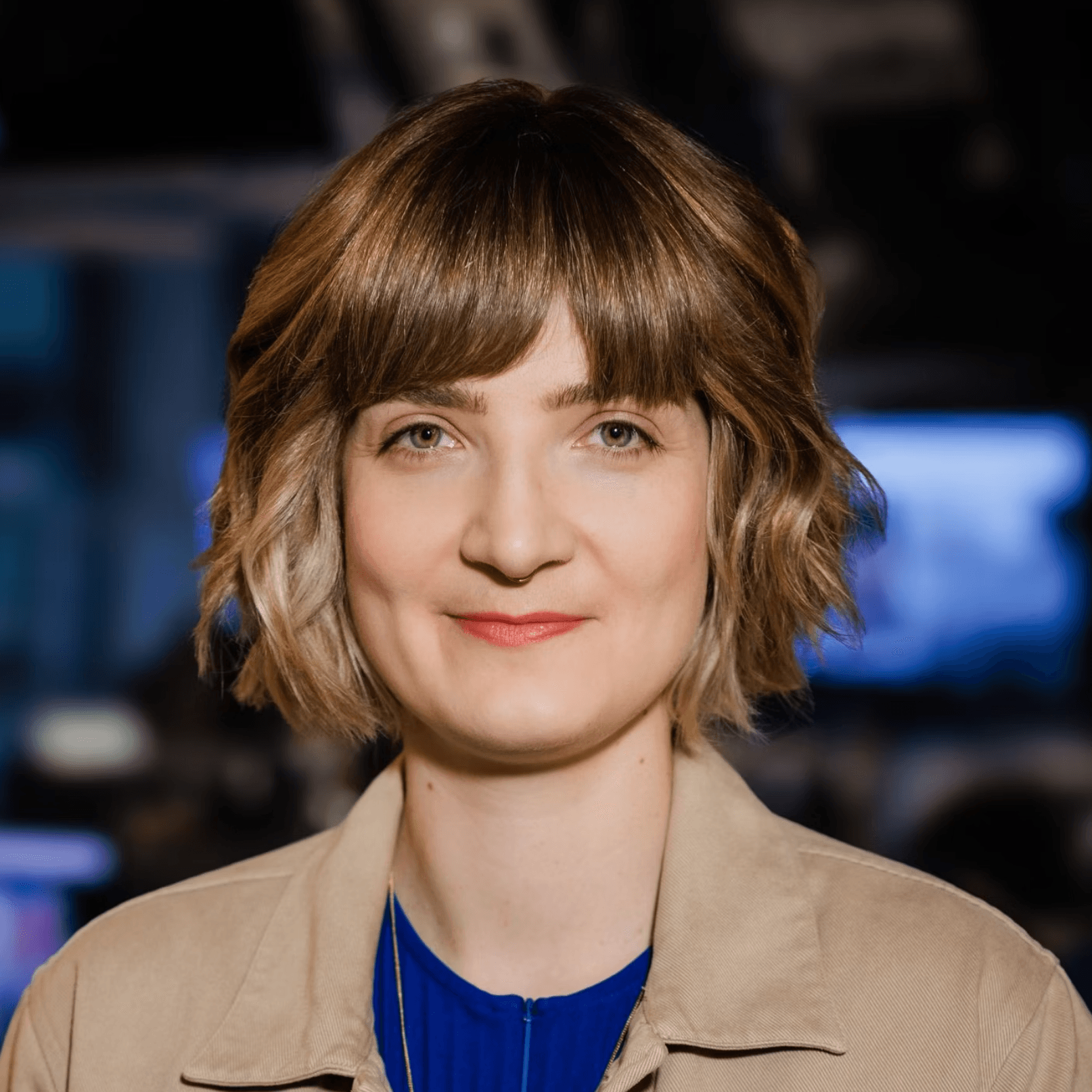
Zur Person
Die Lage ist extrem ernst, aber nicht hoffnungslos. Nach diesem Motto erklärt die freie Journalistin Sara Schurmann die großen Zusammenhänge und kleinen Details der Klimakrise, sodass jede und jeder sie verstehen kann.
Etwa in ihrem Buch "Klartext Klima!" – und jetzt in ihrer Kolumne bei t-online. Für ihre Arbeit wurde sie 2022 vom "Medium Magazin" zur Wissenschaftsjournalistin des Jahres gewählt.
Erfolgserlebnisse motivieren zum Handeln
Angesichts der Fülle an Krisen ist es ein rationales Bedürfnis, den Effekt des eigenen Handelns einschätzen zu wollen. Wir können noch so besorgt sein wegen der Klimakrise – wenn uns klimaschützendes Handeln zu schwer und kostspielig erscheint, werden wir nicht damit beginnen. Wer es jedoch als machbar empfindet und Erfolgserlebnisse hat, wird sich künftig auch mehr engagieren. Selbst dann, wenn er eigentlich aus einem ganz anderen Grund beginnt, mehr Fahrrad zu fahren, etwa um das Geld für die Fahrkarten zu sparen.
Wer die Handlungsbereitschaft von Menschen steigern möchte, muss andere also gar nicht unbedingt erst von der Dringlichkeit der Klimakrise überzeugen – ein Ansatz, den viele Aktivistinnen und Klimakommunikatoren lange verfolgten. Wichtiger sei es, Handlungsmöglichkeiten zu erzeugen und aufzuzeigen.
Mangelndes Vertrauen
In den vergangenen Jahren hat sich zunehmend aber auch die Erkenntnis durchgesetzt, dass die Klimakrise ein strukturelles Problem ist. Dass sie nicht allein durch individuelle Verhaltensänderungen von Verbraucherinnen und Bürgern zu bremsen ist, sondern dass es großer politischer und wirtschaftlicher Veränderungen bedarf. Und dass reiche Menschen mehr zur Krise beitragen als ärmere. Auch so kann man die Ergebnisse aus meiner Sicht interpretieren.
Wichtig für die eigene Handlungsbereitschaft ist laut der PACE-Studie ist aber auch das Vertrauen in Institutionen und das Wissen um die Effektivität von Klimaschutzmaßnahmen. Um beides ist es schlecht bestellt. Im Oktober 2024 gaben weniger als ein Drittel der Befragten an, der Regierung, der EU oder öffentlich-rechtlichen Medien "eher" oder "viel" zu vertrauen. Weniger als die Hälfte der Befragten hält etwa ein Verbot von Öl- und Gasheizungen für effektiv.
Statt Klimaschutz vorrangig über Kosten zu regeln, braucht es also vielfältige Maßnahmen. Statt zu versprechen, Klimaschutz funktioniere ohne Zumutungen, muss die künftige Regierung klar kommunizieren, inwiefern Maßnahmen helfen – und wie sie für die Bürger umsetzbar sind. Statt die Verantwortung etwa für die Wärmewende den Einzelnen anzulasten, braucht es kommunale Angebote wie Wärmenetze. Und wenn die Kosten steigen – und das werden sie –, dann braucht es einen effektiven sozialen Ausgleich.
- iwkoeln.de: "Akzeptanz je nach Betroffenheit – Klimaschutz zwischen Anspruch und Wirklichkeit"
- iwkoeln.de: "Klimaschutz verliert für Wähler an Bedeutung"
- uni-erfurt.de: "PACE-Studie: Politische Akzeptanz- und Entscheidungsprozesse in der Klimapolitik"
- youtube.com: "Klimaschutz in der politischen Debatte – Akzeptanz und Perspektiven" (Video, Englisch falls nicht anders angegeben)
Quellen anzeigen


















