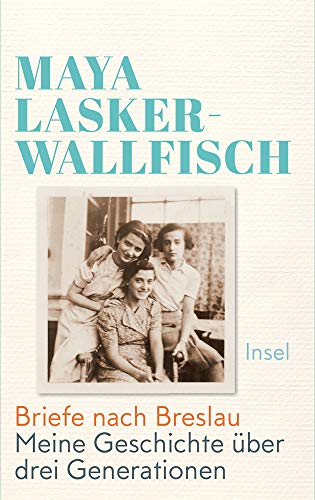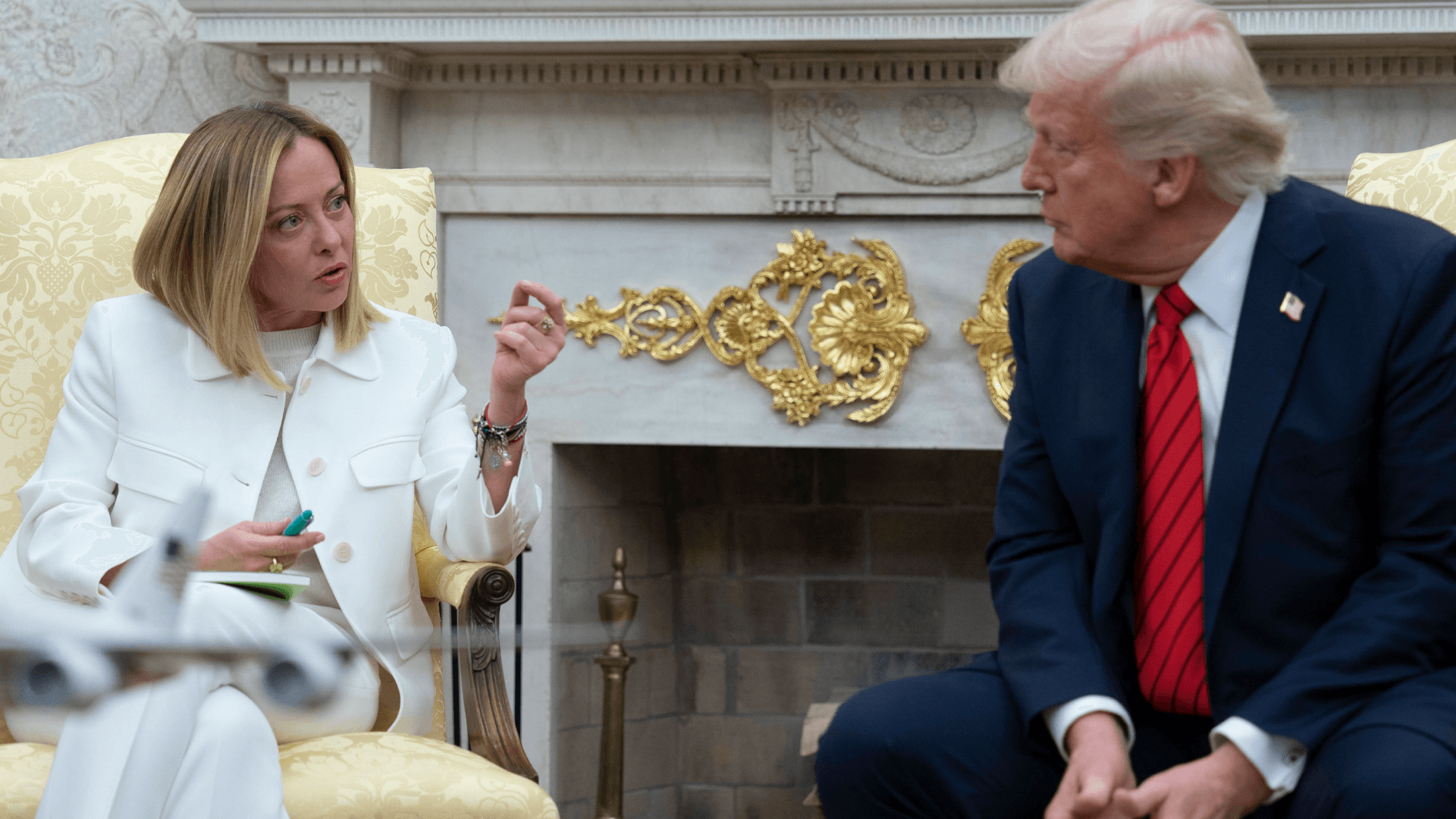Der Gesprächspartner muss auf jede unserer Fragen antworten. Anschließend bekommt er seine Antworten vorgelegt und kann sie autorisieren.
Zum journalistischen Leitbild von t-online.Tochter einer NS-Überlebenden "Es waren schreckliche Bilder von Leichenbergen darin"


Die Mutter von Maya Lasker-Wallfisch ist dem Tod im Holocaust knapp entkommen – und schwieg über diese schreckliche Zeit. Doch auch Nachgeborene leiden unter den Schrecken der Vergangenheit.
Vor 75 Jahren erreichten die Alliierten die letzten deutschen Konzentrationslager und befreiten die überlebenden Häftlinge. In Bergen-Belsen hatte die eingesperrte Anita Lasker-Wallfisch den Terror des Nationalsozialismus überlebt, zuvor war sie in Auschwitz-Birkenau Cellistin im Mädchenorchester gewesen. Mehr als ein Jahrzehnt später bekam sie ihre Tochter Maya, der sie lange nichts über ihre Vergangenheit erzählte.
Doch Schweigen war nicht die Lösung – Maya Lasker-Wallfisch litt in ihrer Kindheit unter Nichtausgesprochenem und dem seltsamen Verhalten ihrer Eltern. Es folgten Drogenmissbrauch und Kriminalität, bis sie erkannte, dass auch sie an den langen Folgen des Holocaust leidet. Kürzlich hat Lasker-Wallfisch ein Buch als Schritt des Heilungsprozesses veröffentlicht. Mit t-online.de sprach sie über die Entdeckung furchtbarer Fotografien, die Wunden, die Schweigen bei einem Kind hinterlassen können und wie sie entdeckte, dass sie nicht allein ist.
t-online.de: Frau Lasker-Wallfisch, Ihre Mutter Anita hat die nationalsozialistischen Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau und Bergen-Belsen überlebt. Wann haben Sie davon erfahren?
Maya Lasker-Wallfisch: Erst sehr, sehr spät. Meine Mutter hat jahrzehntelang kein Wort darüber erzählt. Sie hat früher geglaubt, einen Schlussstrich unter ihre Vergangenheit ziehen zu können. Auf der einen Seite lagen Auschwitz und Bergen-Belsen, auf der anderen ihr Leben nach 1945.
Aber das war ein Irrtum.
Selbstverständlich. Vor allem hatte sie keine Ahnung, dass auch ihre Kinder von den in der Vergangenheit erlittenen Traumata betroffen sein könnten.
Wann wurde Ihnen klar, dass Ihre Mutter etwas Schreckliches erlebt haben muss?
Ich war ungefähr 13 Jahre alt. Damals gab es in unserem Haus einen Schrank, der eigentlich für mich tabu war. Ich dachte, dass dort vielleicht Zigaretten versteckt wären. Dann fand ich allerdings eine Mappe mit Fotografien: Es waren schreckliche Bilder von Leichenbergen darin. Und auf einem Foto war eine junge Frau, die meiner Mutter äußerst ähnlich sah.
Was haben Sie getan?
Nichts. Ich habe alles wieder an seinen Platz gelegt. Und fühlte mich schuldig.
Maya Lasker-Wallfisch ist psychoanalytische Psychotherapeutin. Sie wurde 1958 als Tochter der Holocaust-Überlebenden Anita Lasker-Wallfisch in London geboren. Sie beschäftigt sich in ihrer Arbeit vor allem mit transgenerationalen Traumata. Über ihre eigene Lebenserfahrung brachte sie kürzlich das Buch "Briefe nach Breslau. Meine Geschichte über drei Generationen" heraus.
Sie haben nicht nachgefragt? Es war doch ein verstörendes Erlebnis.
Nein, ich habe geschwiegen. Für Außenstehende ist es schwer zu verstehen, aber bei uns Zuhause herrschte eine gewisse Form der Sprachlosigkeit. Ich hatte bereits als Kind früh das Gefühl, das etwas Unausgesprochenes im Raum war. Aber es anzusprechen? Undenkbar!
Wie war Ihre Kindheit in solch einem Haushalt?
Meine Eltern waren mir peinlich. Ich weiß, die meisten Kinder empfinden ihre Eltern bisweilen als peinlich. Aber bei mir war es wirklich so. Das fing schon beim Essen an. Während überall normale Lebensmittel aufgetischt wurden, gab es bei uns Schwarzbrot und stinkenden Käse. Vor allem war meine Mutter nicht wie andere Mütter: Sie trug kein Make-Up, lehnte jeden Luxus ab: Ich habe mir früher sehnlich gewünscht, dass meine Mutter auch einmal Stöckelschuhe kaufen würde. Symbole der Weiblichkeit eben. Bei uns wurde aber immer nur das Notwendigste eingekauft. Die Leute fragten mich auch nach der komischen Nummer auf dem Arm meiner Mutter. Manche dachten, sie hätte dort eine Telefonnummer eintätowiert.
Es war die Häftlingsnummer aus Auschwitz.
Richtig, das weiß ich heute. Aber damals war es sehr schwer, mit solchen Dingen umzugehen. Ohne zu wissen, warum meine Mutter so war, wie sie war. Später erfuhr ich, dass sie mit 16 Jahren ihre eigene Mutter verloren hatte. Dass sie Jahre während des Nationalsozialismus im Gefängnis, in Auschwitz und in Bergen-Belsen eingesperrt worden war. Dass sie im Mädchenorchester von Auschwitz Cello gespielt hatte. Aber ohne dieses Wissen? Wie hätte ich es ahnen sollen? Erst viel später ist mir klar geworden: Das Schweigen half meiner Mutter beim Überleben angesichts der Schrecken, die sie miterlebt hat. Zumindest für eine gewisse Zeit.
Ihr Vater Peter Wallfisch war vor dem Kriegsausbruch nach Palästina gegangen. Was war er für ein Mann?
Mein Vater stammte wie meine Mutter ursprünglich aus Breslau. Später traf er meine Mutter in Paris wieder und zusammen ließen sie sich dann in London nieder. Mein Vater lebte für das Klavierspiel, er reiste viel umher für Konzertauftritte. Dabei war seine Welt – im übertragenen Sinne – sehr klein. Jede Störung seines gewohnten Alltags verärgerte ihn. Und ich war eben eine solche Störung. Vor allem als mein Verhalten immer herausfordernder wurde. Er war auch bisweilen sehr ungerecht: Seinen Studenten brachte er viel Zuneigung entgegen, nahm sich Zeit für sie und war ihnen ein guter Lehrer. Bei mir hat mein Vater das nicht getan.
Zeigten Ihre Eltern nie Verständnis?
Meine Eltern verstanden einfach nicht, was falsch war an ihrer Tochter. In meiner Kindheit mangelte es nicht so sehr an Liebe, vor allem mangelte es an Verständnis. Verstehen Sie mich nicht falsch: Ich war in gewisser Weise ein Opfer, ein oft ängstliches Kind, das niemand wollte. Ich erinnere mich sehr gut daran, wie meine Mutter immer wieder versuchte, mich bei Freunden unterzubringen. Wenn sie selbst arbeiten musste und genau wusste, dass mein Vater nicht mit mir zurechtkam. Bei meinem Bruder Raphael war es ganz anders.
Er hat den gleichen Beruf wie ihre Eltern ergriffen und ist Berufsmusiker geworden.
Und vor allem hatte er auch eine ganz andere Beziehung zu meinem Vater. Raphael hört es auch heute nicht gerne, wenn ich mich kritisch äußere. Er denkt, dass es das Andenken unseres Vaters beschädigt.
Anders als Sie teilte Ihr Bruder mit Ihren Eltern die Leidenschaft für die Musik. Fühlten Sie sich ausgeschlossen?
Natürlich. Ich bin einfach nicht so musikalisch wie meine Eltern und mein Bruder. Er spielt hingegen Cello wie meine Mutter, das allein verbindet. Aber vor allem verständigten sich meine Eltern in einer weiteren Sprache, die ich nicht verstand.
In der gemeinsamen Muttersprache Deutsch?
Ja! Für mich war es völlig unbegreiflich, dass sich die beiden auf Deutsch unterhielten. Denn alles Deutsche war bei uns eigentlich völlig verpönt. Allein wenn meine Mutter Menschen auf der Straße Deutsch sprechen hörte, wurde sie zornig. Nie wieder wollte sie etwas mit dem Land zu tun haben.
Ihre Eltern besprachen wahrscheinlich Dinge auf Deutsch, die Sie als Kind nicht verstehen sollten.
Völlig richtig. Aber natürlich hatte ich wie jedes Kind ein Gespür dafür, dass dort Sachen besprochen wurden, die mich nichts angingen. Was mich natürlich getroffen hat. Deutsch war für uns Kinder etwas Verbotenes. Wie sich die Zeiten ändern: Heute nimmt meine Mutter es mir übel, dass ich Deutsch nicht gelernt habe.
Sie reagierten damals mit Rebellion?
Absolut. Ich war auf die Bilder vom Holocaust ja nur dadurch gestoßen, weil ich als Dreizehnjährige auf der Suche nach Zigaretten gewesen bin. Ich versuchte viele Dinge, um irgendwie einen Sinn im Leben zu entdecken und mich besser zu fühlen. Ich aß zu viel, verletzte mich auch selbst. Und nicht zuletzt entdeckte ich die Drogen.
Wann haben Sie damit angefangen?
Sehr früh. Mit etwa 14 Jahren. Im Laufe der Zeit wurden es natürlich immer härtere Drogen.
Bitte erzählen Sie etwas mehr über diese Zeit.
Es war sehr schwierig. Natürlich hatte ich auch große Probleme in der Schule, glitt in die Kriminalität ab. Und nicht zuletzt waren meine Beziehungen zu Männern zum Teil sehr problematisch.
Sie waren drei Mal verheiratet?
Ja, das ist richtig. Mit einem Ehemann – er war Rastafari – bin ich sogar nach Jamaika gezogen, um dort neu anzufangen. Aber es endete tragisch, er verfiel den Drogen immer mehr.
Wie gelang Ihnen die Rückkehr?
Dafür muss ich meiner Mutter danken. Wir machten damals einen Deal: Sie bezahlte das Rückflugticket, ich habe mich im Gegenzug bereit erklärt, einen Entzug zu machen. Aber eine Sache ist wirklich paradox…
Was meinen Sie?
Es ist völlig klar, dass mich die Drogen wahrscheinlich auf lange Sicht irgendwann umgebracht hätten. Aber auf gewisse Weise haben mich die Drogen auch gerettet.
Das müssen Sie näher erklären.
Die Drogen haben eine Zeit lang dafür gesorgt, dass ich mich besser fühlte. Wer weiß, was sonst passiert wäre. Ich nahm sie, um eine Leere in mir zu füllen. Dann hatte ich natürlich das große Glück, rechtzeitig von den Drogen wegzukommen.
Nicht nur das: Sie haben später in einer Klinik für Drogensüchtige gearbeitet. Und machten eine Ausbildung zur psychoanalytischen Psychotherapeutin.
Das waren sehr wichtige Schritte in meinem Leben. Aber das wichtigste Ereignis erfolgte erst, als ich eines Tages die Zeitung las. Darin war eine Anzeige, sie warb für eine Therapiegruppe für Kinder von Holocaust-Überlebenden. Mir wurde plötzlich klar, dass ich nicht allein bin. Das war eine Art Befreiung. Und dass ich unter einem transgenerationalen Trauma litt.
Können Sie diesen Begriff bitte näher erläutern?
Es klingt ein wenig paradox: Menschen wie ich, die natürlich niemals die schreckliche Erfahrung der Judenverfolgung selbst durchgemacht haben, können ebenso unter den Folgen leiden. Es wird von ihren Eltern übertragen. Nehmen Sie als Beispiel das Schweigen meiner Mutter, ihre Ablehnung von allem, was über die Grundbedürfnisse hinausgeht. So kann auch die Generation der Nachgeborenen unter transgenerationalen Traumata leiden. Und diesen Menschen muss geholfen werden.
Schließlich hat auch Ihre Mutter das Schweigen über den Holocaust gebrochen.
Richtig. Sie hat das Buch "Ihr sollt die Wahrheit erben" geschrieben und ist sogar 1994 zum ersten Mal seit Jahrzehnten wieder nach Deutschland gefahren. Es war der erste Besuch von vielen, um die Erinnerung an den Holocaust wach zu halten.
Sie selbst haben auch einen Weg gesucht, um sich mit ihren Traumata weiter auseinanderzusetzen. Sie haben Briefe an ihre Großeltern geschrieben, die lange vor Ihrer Geburt während des Holocaust ermordet worden sind. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen?
Ich war damals in Deutschland und ging spazieren. Plötzlich wurde mir klar, dass ich mich mit meinen Großeltern Edith und Alfons unterhielt. Dann beschloss ich, ihnen Briefe zu schreiben, um ihnen die Dinge über ihre Nachkommen zu schildern, die sie niemals hatten erfahren können. Für mich war das sehr sinnig.
Fiel es Ihnen schwer?
Es ist tatsächlich sehr schwer, Menschen zu schreiben, die man niemals kennengelernt hat. In meiner Kindheit war mir nicht einmal richtig klar, dass ich Großeltern gehabt habe. Meine Eltern sprachen ja nie über sie, es gibt nicht einmal eine richtige Grabstelle für sie. Aber ich wusste, dass ich das richtige tat. Und verstehen Sie es nicht falsch, ich bin ein wenig spiritueller Mensch.
Was für Menschen waren ihre Großeltern Ihrer Meinung nach?
Es waren bemerkenswerte Leute, sehr gebildet, sehr tolerant. Und sehr gewissenhaft in der Erziehung ihrer drei Töchter.
Mittlerweile ist Ihr Buch "Briefe nach Breslau" erschienen, das unter anderem Ihre elf Briefe an die verstorbenen Großeltern enthält. Hat Ihnen die Publikation geholfen?
Ja. Obwohl ich auch auf gewisse Weise traurig bin. Denn die Corona-Krise überschattete natürlich das Erscheinen. Aber genauso wichtig ist, dass das Buch dabei hilft, die verschiedenen Generationen der Laskers zu vereinen.
Ihre Beziehung zu Ihrer Mutter ist ambivalent. Wie stehen sie beide heute zueinander?
Wir sehen uns unsere gegenseitigen Fehler und Schwächen nach. Und ich verstehe sie heute viel, viel besser. Und ich hoffe, sie mich auch.
Eine letzte Frage: Was sind Ihre Pläne für die nächsten Jahre?
Ich würde gerne nach Berlin ziehen. Es ist eine wundervolle Stadt, in der ich mich sehr wohl fühle.
Frau Lasker-Wallfisch, vielen Dank für das Gespräch.
- Telefonisches Gespräch mit Maya Lasker-Wallfisch