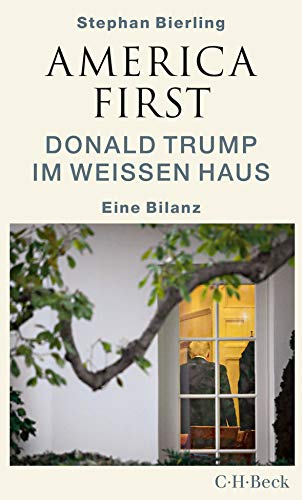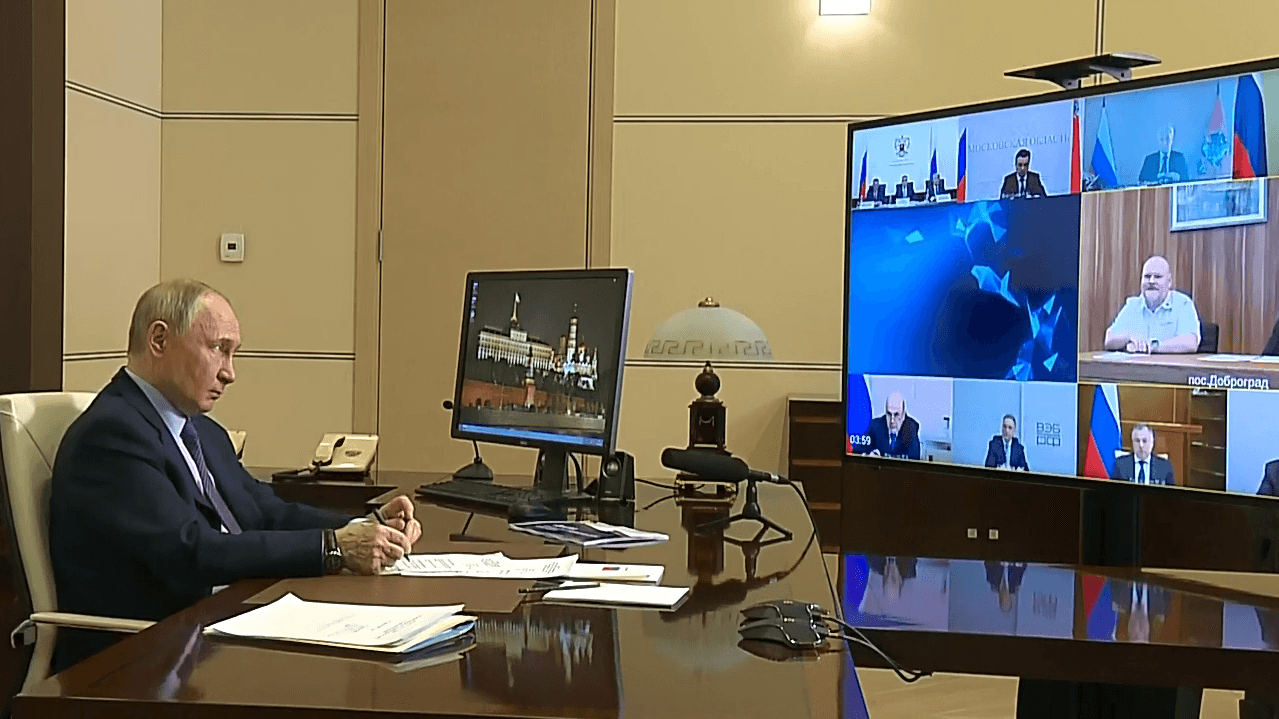Der Gesprächspartner muss auf jede unserer Fragen antworten. Anschließend bekommt er seine Antworten vorgelegt und kann sie autorisieren.
Zum journalistischen Leitbild von t-online.100 Tage-Bilanz "Joe Biden regiert, Donald Trump schmollt"


Als "schläfrig" verspottete Donald Trump seinen Nachfolger, nun deklassiert ihn Joe Biden. In den ersten 100 Tagen im Amt hat der Demokrat mehr geschafft als Trump in vier Jahren, so Experte Stephan Bierling.
t-online: Professor Bierling, vor 100 Tagen hat der Demokrat Joe Biden seinen Konkurrenten Donald Trump als US-Präsident abgelöst. Was treiben die beiden Männer seitdem?
Stephan Bierling: Joe Biden regiert, Donald Trump schmollt.
Wie bitte?
Man kann es kaum anders ausdrücken: Trump schmollt vor sich hin. Und er hat Rachegelüste. Sein Zorn richtet sich vor allem gegen diejenigen Republikaner, die ihm im zweiten Impeachment-Verfahren die Gefolgschaft verweigert haben. Er sammelt immense Spendengelder ein, um weiter der wichtigste Machtfaktor in der Republikanischen Partei zu bleiben.
Wie hat Trump ansonsten den Abschied vom Weißen Haus verkraftet?
Das Weiße Haus an sich vermisst er sicher nicht. Trump war ohnehin derjenige Präsident in der Geschichte der USA, der sich am wenigsten dort aufgehalten hat. Es war ihm nicht luxuriös genug …
… und auch der nächste Golfplatz war recht weit entfernt.
Das kommt dazu. Aber es nagt furchtbar an Trump, nach nur einer Amtszeit als Präsident abgewählt worden zu sein. Jimmy Carter oder George H. W. Bush mussten 1981 und 1993 ebenfalls nach nur vier Jahren abtreten. Sie haben lange gebraucht, um diese Niederlagen zu verkraften. Trump vermisst am meisten seinen Hofstaat und die öffentliche Aufmerksamkeit.
Bei Twitter ist er immer noch gesperrt.
Und das trifft ihn sehr. Mit jedem Tweet, jeder noch so kleinen Äußerung, zog Trump vier Jahre die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf sich. Darum ging es diesem Ultra-Narzissten schließlich auch. Wie kein anderer Präsident zuvor war er auf diese Art der Kommunikation angewiesen.
Stephan Bierling, geboren 1962, lehrt Internationale Politik an der Universität Regensburg. Der Politologe war Gastprofessor in den USA, Israel, Australien und Südafrika. 2013 wurde Bierling von der Zeitschrift UNICUM zum "Professor des Jahres" gewählt. Regelmäßig analysiert er für große Medienhäuser politische Entwicklungen in Deutschland und den Vereinigten Staaten. Bierling ist Autor des Spiegel-Bestsellers "America First. Donald Trump im Weißen Haus. Eine Bilanz".
Den Twitter-Account des US-Präsidenten hat nun Joe Biden inne. Wie hat sich das 46. Staatsoberhaupt der USA in den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit geschlagen?
Biden regiert überaus professionell. Statt Chaos gibt es nun Kompetenz im Weißen Haus. Trump hat seinen Nachfolger Biden oft genug als alten, kraftlosen Mann verspottet, nun straft Biden ihn Lügen.
Bidens Erfolg beruht auch auf seinem Team.
Selbstverständlich. Zahlreiche seiner Leute haben bereits in der Administration von Barack Obama oder Bill Clinton gearbeitet. Mit dieser Unterstützung konnte Biden vom ersten Tag an mit Volldampf loslegen.
Und er hat bereits Ergebnisse vorzuweisen: Fast zwei Billionen Dollar umfasst der sogenannte Amerikanische Rettungsplan (American Rescue Plan Act), der im März den Kongress passierte.
Knapp sieben Wochen hat Biden dafür gebraucht. Trump hat nur einen vergleichbaren Erfolg erreicht: seine massive Steuersenkung. Dafür hat er allerdings elf Monate benötigt.
Welches Ziel verfolgt Biden mit seiner Präsidentschaft?
Joe Biden verfolgt eine sehr ehrgeizige Agenda, er könnte als Präsident der dritte große Sozialreformer der amerikanischen Geschichte nach Franklin D. Roosevelt und Lyndon B. Johnson werden. Und nichts weniger strebt Biden an.
Dazu muss er sich in der Migrationsfrage an der Südgrenze positionieren, bei der sich Trump mit seiner Grenzmauer zu Mexiko ein Denkmal hatte setzen wollen.
In den ersten drei Monaten dieses Jahres haben die US-Behörden so viele illegale Grenzübertritte verzeichnet wie seit 20 Jahren nicht mehr. Biden schiebt diese Problematik zurzeit von sich fort, weil er sich nicht von seinen sozialpolitischen Projekten ablenken lassen will. Die Republikaner wittern bereits ein Wahlkampfthema: die Biden-Grenzkrise. Der Präsident hat deshalb seine Vizepräsidentin Kamala Harris beauftragt, mit Honduras, Guatemala und El Salvador über einen Stopp der Auswanderung zu verhandeln.
Also mit den Ländern, aus denen der Großteil der Migranten an der US-Grenze stammt.
Richtig. Die Lage soll in diesen ziemlich kaputten Staaten so stabilisiert werden, dass die Menschen dort bleiben.
Nun hat Biden das Präsidentenamt in einer Zeit übernommen, in der neben Corona und Migration sehr viele Probleme auf Lösung drängen.
Biden hat eine wichtige Erkenntnis in seiner langen Laufbahn gewonnen: Man kann sich als Präsident immer nur auf ein oder zwei große Vorhaben konzentrieren, wenn man sie als Gesetz durch den Kongress bekommen will. Zuerst hat er sich um den American Rescue Plan Act, über den wir gerade gesprochen haben, gekümmert. Jetzt steht die Verwirklichung seines großen Infrastrukturprojekts in Billionenhöhe an, mit dem Biden die USA modernisieren will. Er möchte sein Land in einen Wohlfahrtsstaat umwandeln: Von diesem Ziel wird er sich nicht ablenken lassen. Auch nicht durch das, was an der Grenze zu Mexiko passiert.
Das wird auch bei Teilen seiner Demokraten nicht durchweg auf Begeisterung stoßen.
Wahrscheinlich nicht. Die Demokraten bestehen aus verschiedenen Gruppen, die gerade in Sachen Migration unterschiedliche Auffassungen vertreten: Die den Gewerkschaften verbundene Arbeiterschaft innerhalb der Partei hatte sogar große Sympathien für Trumps restriktive Politik gegenüber Immigranten. Viele progressive, jüngere und multiethnische Mitglieder der Demokraten fordern hingegen eine sehr liberale Migrationspolitik.
Nicht nur die Anhänger der Demokraten, sondern auch die Europäer haben sich vom Wechsel an der Spitze des Weißen Hauses viel versprochen: Hat sich das transatlantische Verhältnis unter Joe Biden verbessert?
Auf jeden Fall, die Beziehungen haben sich entspannt. In Washington regiert nun der überzeugteste Transatlantiker seit George H. W. Bush Anfang der Neunzigerjahre. Biden hat viel Ballast der Ära Trump abgeworfen, die USA sind unter anderem wieder der Weltgesundheitsorganisation sowie dem Pariser Klimaabkommen beigetreten. Die gegenseitigen Sanktionen Boeing und Airbus betreffend wurden auf Eis gelegt und auch der von Trump angedrohte Abzug von 10.000 US-Soldaten aus Deutschland ist vom Tisch.
Im Gegenteil, Biden will noch 500 GIs mehr in Deutschland stationiert sehen.
Genau. Überhaupt stärkt Biden durch die Rückkehr der USA zu Multilateralismus und Diplomatie das gegenseitige Vertrauen. Aber Biden ist natürlich kein selbstloser Wohltäter, er erwartet in der internationalen Politik etwas von uns Europäern.
Eine gemeinsame Politik gegenüber China?
Ja, außenpolitisch hat Biden ein großes Vorhaben: Er will den aufsteigenden Rivalen China eindämmen. Dazu räumt der US-Präsident gerade Altlasten aus dem Weg, der Abzug aus Afghanistan zählt dazu. Biden erwartet, dass die Europäer in der einen oder anderen Form entsprechend liefern werden.
Erst einmal aber hat die Europäische Union durch ihr Investitionsschutzabkommen mit China Biden kurz vor seiner Amtsübernahme enttäuscht.
Es war eine Klatsche für die noch nicht angetretene Biden-Administration. Die Deutschen wollten aber diesen Erfolg mit China in den letzten Tagen ihrer EU-Ratspräsidentschaft unbedingt. Es sollte ein Beleg für die sogenannte strategische Unabhängigkeit Europas darstellen. Klug war das nicht. Nach sieben Jahren Verhandlungen hätte man warten sollen, bis Biden vereidigt ist. Im Schulterschluss mit den USA kann man mehr herausholen bei den Verhandlungen mit Peking.
Europa hat keine derart brisanten Berührungspunkte mit China, wie es bei den USA etwa mit den in Südkorea oder Japan stationierten eigenen Truppen der Fall ist.
Das mag sein, aber Reibungen gibt es sehr wohl. China will die Staaten der EU dividieren. Manchmal kauft sich Peking zu diesem Zweck einfach Länder heraus. Und nicht zuletzt zwingt uns China dazu, Menschenrechtspositionen über Bord zu werfen. Das machen die Chinesen sehr geschickt, planmäßig und erfolgreich. Wenn Europa nicht eng mit den USA in solchen Fragen kooperiert, werden wir sehr wenig erreichen.
In Sachen Klimaschutz ist das Wohlwollen Chinas aber dringend notwendig.
Der gerade von Biden abgehaltene Klimagipfel signalisierte die Bereitschaft der USA, sich in dieser Frage mit Peking zu verständigen. Denn es ist klar, dass effektiver Klimaschutz China einbeziehen muss – schließlich stößt das Land weltweit mit Abstand die meisten Treibhausgase aus.
Aber grundsätzlich gefragt: Können Europa und die USA gemeinsam denn China zukünftig überhaupt noch Paroli bieten?
Der Westen hat noch eine Chance, das politische Parkett im 21. Jahrhundert nach seinen Vorstellungen zu gestalten, vor allem in Sachen Handels- und Menschenrechtspolitik. Aber die Chance schwindet, weil die Chinesen stärker und ihre Methoden brachialer werden.
Vieles wird davon abhängen, ob Bidens Politik auch nach seiner Amtszeit fortgesetzt wird. Wenn alles nach Plan verläuft, könnte Vizepräsidentin Kamala Harris ihm nachfolgen.
Biden fördert Harris nach Kräften. Sie war früher Justizministerin Kaliforniens, dann Senatorin in Washington. Beides sind eher Jobs, in denen man innenpolitisches Profil erwirbt. Biden überträgt ihr nun etwa die Migrationsverhandlungen mit den lateinamerikanischen Ländern und zieht sie bei seinen Beratungen mit internationalen Staatschefs hinzu. Dadurch gewinnt Harris an Statur in der Außenpolitik – keine schlechte Voraussetzung, um 2024 oder 2028 nach dem höchsten Amt zu greifen.
Harris wird also von Biden zu seiner Nachfolgerin aufgebaut. Donald Trump war hingegen ein ausgesprochener Einzelkämpfer, auch wenn er einst mit dem Gedanken gespielt hatte, seine Tochter Ivanka zur Vizepräsidentin zu machen.
Trump ist eine Naturgewalt. Es war beeindruckend, wie er bei seinen beiden Wahlkämpfen Millionen von Nichtwählern aus ihrer Resignation über das politische System zurückholte. Aber über seine Nachfolge macht er sich keine Gedanken. Das hieße ja, von der eigenen Sterblichkeit auszugehen. Solche Gedanken gibt es in Trumps Welt nicht.
Also ist es denkbar, dass Trump in ein paar Jahren wieder zu Wahl antreten wird?
Trump sollte man niemals abschreiben. 2015 hat es zunächst niemand für möglich gehalten, dass er wirklich antritt und dann auch noch gewinnt. Sicher überlegt er sich ein Comeback. Die Ungewissheit hat zusätzlich einen disziplinierenden Effekt auf seine Republikaner. Solange der große Zampano Trump nicht erklärt hat, was er 2024 will, kann sich dort niemand in Stellung bringen und ihm Konkurrenz machen.
Hätte Trump noch einmal Chancen?
Als er seine Anhänger im Januar zum Sturm aufs Kapitol aufhetzte, hat Trump selbst bei Republikanern an Ansehen eingebüßt. Bei nationalen Wahlen, die seit Jahrzehnten meist sehr knapp entschieden werden, dürfte es deshalb nicht mehr für ihn reichen. Aber nochmals Präsidentschaftskandidat der Republikaner? Das wäre denkbar.
Donald Trumps Amtszeit war verheerend: Gibt es überhaupt etwas, das positiv in Erinnerung bleiben wird?
Die Corona-Pandemie ist die größte soziale und gesundheitspolitische Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg – und Trump hat bei der öffentlichen Kommunikation völlig versagt. Eine Sache allerdings hat er allerdings richtig gemacht: Bereits im Mai letzten Jahres hat er 18 Milliarden Dollar bereitstellen lassen, um Impfstoffe gegen das Coronavirus zu erforschen und sie später schnell produzieren zu können.
Damit war er Deutschland und der Europäischen Union weit voraus.
Oh ja. Die EU hat es bei der Impfstoffbeschaffung ziemlich vermasselt. Amerika war immer besser als wir, entschlossen und unbürokratisch auf akute Herausforderungen zu reagieren.
Professor Bierling, vielen Dank für das Gespräch.
- Gespräch mit Stephan Bierling via Zoom