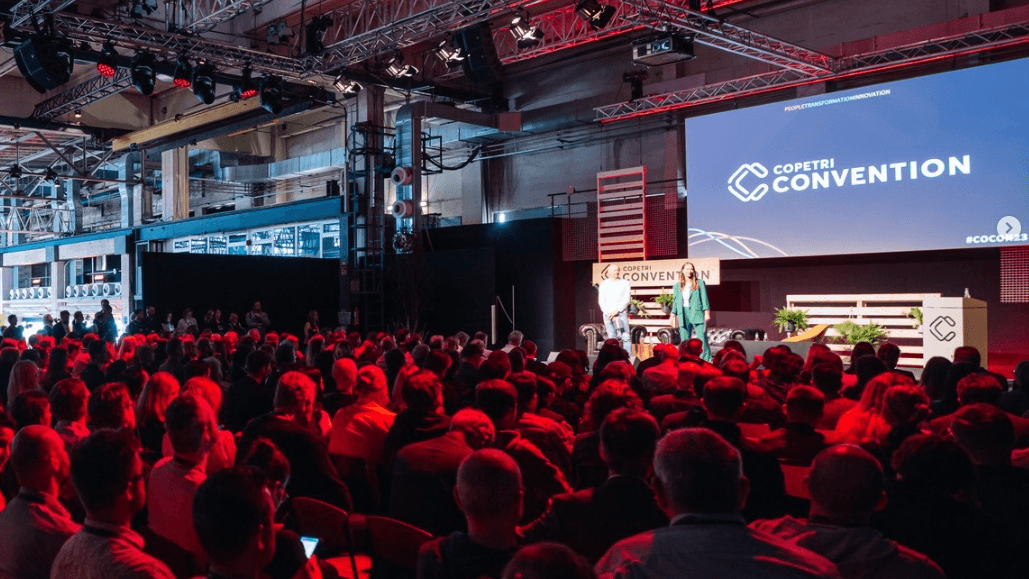Mehr als 150 Journalistinnen und Journalisten berichten rund um die Uhr für Sie über das Geschehen in Deutschland und der Welt.
Zum journalistischen Leitbild von t-online.Rassismus in den USA "Sie finden immer einen Vorwand, um Dich umzubringen"


In Amerika tobt wütender Protest. Was bedeuten Rassismus und Polizeigewalt im Leben schwarzer Amerikaner? Einer, der was zu sagen hat, beschreibt es anschaulich.
Wer die Wucht der Proteste in den USA verstehen will, kann in die Zahlen schauen: Nur 36 Prozent der Afroamerikaner haben Vertrauen in ihre örtliche Polizei, im Gegensatz zu 77 Prozent der Weißen. In Washington stellen Schwarze fünf von zehn Einwohnern, aber neun von zehn Todesopfern durch Polizeigewalt.
Wem die Zahlen nicht reichen, kann Cameron C. Trimble anrufen. Trimble geht momentan Abend für Abend in Washington auf die Straße, aber jetzt steht er daheim in der Küche und sagt: "Wir befinden uns in einem langen Krieg."
Trimble ist kein Schwarzer aus einem Brennpunktviertel, er ist auch kein Radikaler. Er ist in einer behüteten Vorstadt in Ohio aufgewachsen, die eine Modellsiedlung für Rassenintegration sein sollte. Er hat Medizin studiert, im US-Kongress gearbeitet, ist ein umtriebiger Typ, der zahlreiche Organisationen gegründet hat. Gerade macht er, neben einigem anderen, einen Podcast über Politik und Hip Hop namens "Hip-Politics".
Er hat es also besser als viele andere Schwarze, die in Amerika häufiger arm und krank sind oder aus kaputteren Familien kommen als Weiße. Er sagt das selbst auch oft. Gerade deshalb kann er veranschaulichen, was es unabhängig von Einkommen, Job und Herkunft heißt, schwarz zu sein in Amerika und was hinter den zornigen Protesten steckt.
"Es kann jedem von uns jeden Tag in ganz Amerika zustoßen"
Jeder Schwarze müsse gewisse Dinge beachten, um sicher durch den Tag zu kommen, sagt er. Ein Übergriff der Polizei, wie er zum Tode George Floyds und zu den Protesten geführt hat, "kann jedem von uns jeden Tag in ganz Amerika zustoßen."
Weshalb er bis heute das tut, was ihm seine Eltern, als er 14 war, mitgaben – als schwarzer Junge ja nichts in der Hand zu haben, wenn ihn die Polizei anhält, oder gar eine Bewegung etwa zum Portemonnaie machen, die missverstanden werden könne. Weiße Eltern geben ihren Kindern solche Überlebenstipps in der Regel nicht.
Mit dem langen Krieg meint er das: "Die Sklaverei", sagt er, "war ein Prozess von 400 Jahren." Die US-Verfassung? Geschrieben von Männern, die zwar niederschrieben, dass alle Menschen gleich seien, aber zugleich Sklavenhalter waren. Nach der Abschaffung der Sklaverei folgten "hundert Jahre Jim Crow", das ist das Schlagwort für all jene geschriebenen und ungeschriebenen Gesetze, mit denen nach der Sklavenbefreiung speziell im Süden mit Erfolg versucht wurde, dass Schwarze maximal Bürger zweiter Klasse werden, dann Drogengesetze, die Crack der Schwarzen härter bestraften als das Kokain der Weißen, obwohl es die gleiche Wirkung hat. "Wir haben doch erst seit zwanzig, dreißig Jahren gleiche Rechte."
Auf dem Asphalt, Knie im Rücken, Bargeld aus den Taschen
An die Warnungen seiner Eltern beim Kontakt mit der Polizei halte er sich bis heute, sagt der 38-Jährige. "Ich behaupte nicht, dass mir Polizeigewalt angetan worden ist", betont er, und berichtet dann aber noch von den kleinen und mittelgroßen Nadelstichen: Wie er selbst in Washington – der liberalen, schwarzen Hauptstadt mit einer vergleichsweise moderaten Polizei – rausgefischt worden ist.
Mit dem Knie auf dem Asphalt ausharren, durchsucht werden, wenn man Pech hat, geht das Bargeld aus den Hosentaschen flöten. "Ist mir alles schon passiert". Mit einem Polizistenknie, das den Tod des Schwarzen George Floyd und die Massenproteste verursachte, kennen sich Amerikas Schwarze aus. Trimble hatte es auch schon im Rücken. Angehalten, weil ein junger schwarzer Mann ein schickes Auto fuhr. Racial Profiling nennen das Soziologen, einfacher ausgedrückt: angehalten, weil schwarz.
Seine Sicht auf die Polizei ist davon geprägt. "Jeder Schwarze weiß, was die Polizei mit uns macht." Die aktuellen Proteste hätten die Umstände ausgelöst, dass es ein eindeutiges Video der unverhältnismäßigen Gewalt gegen Floyd gibt und dass dieser daran gestorben ist. "Doch so etwas, das weiß jeder von uns, passiert ständig." Dieses Wissen gehört zu der Lebensrealität der Schwarzen in den USA.
Zur Person: Cameron C. Trimble, 38, ist Kommunikationsberater und Gründer der Plattform "Hip-Politics" und Moderator eines gleichnamigen Podcasts, die sich um Politik und Hip Hop-Musik drehen. Zuvor hat er im Kongress für Abgeordnete der Demokraten gearbeitet.
Er sieht die Polizei deshalb in einem anderen Licht, als es viele Weiße tun. Als Institution, die neben anderem auch zur Verfolgung von Ex-Sklaven gegründet worden sei, in der viele ehemalige Ku-Klux-Klansmänner nach dem Verbot ihrer rassistischen Organisation untergekommen seien und Traditionen – Großvater, Vater, Sohn im Polizeidienst – vererbt würden und Korpsgeist herrsche.
Die Angst bei Fahrten durch den Süden
Trimble wird bis heute mulmig, wenn er durch die amerikanische Provinz fährt, selbst wenn er die Schwester nur drei Stunden entfernt in Virginia besucht oder den Cousin in North Carolina. Vom richtigen Süden ganz zu schweigen. Das Warnzeichen: Dort, wo die alte Südstaatenflagge wehe, drohe Ärger durch Polizei – oder durch weiße Bürger, die sich auf weite Rechte zur Selbstverteidigung und großzügige Waffenrechte berufen können. "Es gibt Gegenden, in denen ich nie zum Tanken anhalten würde", sagt Trimble. "Sie können immer einen Vorwand finden, um dich umzubringen".
Interessieren Sie sich für US-Politik? Washington-Korrespondent Fabian Reinbold schreibt über seine Arbeit im Weißen Haus und seine Eindrücke aus den USA unter Donald Trump einen Newsletter. die dann einmal pro Woche direkt in Ihrem Postfach landet.
Wie eben kürzlich beim Fall Ahmaud Arbery, einem Schwarzen, der auf einer Joggingtour in Georgia von zwei weißen Männern, Vater und Sohn, erschossen wurde. Wie im Fall Floyd folgte bis zum Aufschrei der Öffentlichkeit keine Festnahme, der Vater war einst Polizist.
Trimble erzählt all das sehr ruhig, er beschreibt einfach die Realität für ihn und so viele andere Afroamerikaner.
Die "Mikro-Aggressionen" der Weißen
Dazu gehören auch, wie er sie nennt, "Mikro-Aggressionen", die kleinen Grenzübertretungen, der mehr oder weniger bewusste Alltagsrassismus. "Wenn du in einen Laden gehst, fühlst du, dass die Augen auf dich genauer gerichtet werden als auf andere. Wenn die Leute kommen und dein Haar anfassen wollen, als ob du etwas Exotisches bist."
Er selbst ist viel in progressiven Zirkeln unterwegs, in denen man sich aufgeklärt gibt. Selbst dort, sagt er, werde es seltsam, wenn er aufgefordert wird, speziell "schwarze" Dinge zu erklären. "Ich bitte doch auch keine Weißen, mir weiße Dinge zu erklären." Er spricht also von tief verwurzelten, nicht immer bewussten rassistischen Denkmustern.

Embed
Trimble hat weiße Kollegen, weiße Freunde, aber zur Wahrheit gehöre, dass die engen Freunde eben doch Schwarze sind. In Washington ist gut die Hälfte der aktuellen Demonstranten weiß. Trimble sagt, das sei "extrem wichtig", aber nur "ein erster Schritt". Sie müssten dann auch selbst die Mikro-Aggressionen einstellen, für Gleichheit eintreten.
Obama und Trump
Die aktuelle Auseinandersetzung sieht er ohnehin nur als einen Schritt eines langen Weges. Selbst Barack Obama, in dessen letzte Amtsjahre ebenfalls viele dokumentierte Vorfälle von tödlicher Polizeigewalt gegen Schwarze und Proteste fallen, konnte nicht viel daran ändern. Ist er davon enttäuscht? Nein, sagt Trimble, was seien schon acht Jahre des ersten schwarzen Präsidenten gegenüber den 400 Jahren, seit die ersten Sklaven verschifft wurden? Er sei stolz auf Obama, der "viele Schlachten gewonnen habe".
Dessen Nachfolger Donald Trump habe das Problem der Polizeigewalt wieder verschärft. "Ohne Trump gäbe es Proteste in solchem Ausmaß nicht."
Fragt man den schwarzen Amerikaner Cameron C. Trimble, welche Frage er von Weißen bitte gar nicht mehr hören will, überlegt er lange. Schließlich sagt er: Eine Sache könne er wirklich nicht mehr hören, die "Ich bin überrascht"-Nummer.
Wenn ihm Weiße etwa sagten: "Ich bin überrascht, dass die Polizei euch so etwas antut." Wenn sie staunen, dass es in schwarzen Wohngegenden Mangel an Supermärkten oder Krankenhäusern gebe. Trimble sagt: "Wer jetzt immer noch überrascht ist, was irgendeinen Aspekt von Ungleichheit und Benachteiligung der Schwarzen betrifft, der will einfach nicht hinsehen."
- persönliches Gespräch mit Cameron C. Trimble per Telefon und Videokonferenz.