
Die subjektive Sicht des Autors auf das Thema. Niemand muss diese Meinung übernehmen, aber sie kann zum Nachdenken anregen.
Was Meinungen von Nachrichten unterscheidet.Gleichgewicht wankt Das kommt überraschend


Das Meereis in der Antarktis hatte sich Anfang des Jahres überdurchschnittlich stark ausgedehnt. Sind das endlich gute Klimanachrichten? Leider nicht, meint unsere Kolumnistin.
Dass die Eisflächen auf der Erde schmelzen und ihre Größe schwankt, ist normal. Jahrtausendelang gab es dabei aber ein Gleichgewicht: Im Sommer nahm die Größe der Eisfläche ab, im Winter gefror Wasser zu neuem Eis. So kamen neue Eisflächen hinzu. Durch die Erderhitzung sind jedoch sowohl die Sommer als auch die Winter im Durchschnitt wärmer geworden, die Meere heizen sich auf. Das Eis schmilzt in den Sommerperioden daher stärker. Gleichzeitig bildet sich im Winter weniger neues Eis. Insgesamt wird die Fläche somit immer kleiner. Nach der starken Schmelze der vergangenen Jahre weckte daher die Nachricht, dass das Eis in der Antarktis im Januar überdurchschnittlich gewachsen war, kurz eine Hoffnung: Könnte das ein Zeichen für eine Umkehr im Wärmetrend sein?
Ich erinnere mich, wie ich als Kind die Bilder von hungrigen Eisbären auf Eisschollen gesehen habe, wohlgemerkt in der Arktis auf der Nordhalbkugel. Aber die Kaiserpinguine an der Antarktisküste im Süden haben mit den gleichen Problemen zu kämpfen wie die Eisbären. Jahrzehntelang war das Bild der schmelzenden Eisscholle das Symbol für die menschengemachte Klimakrise. Es sollte Mitgefühl und Sorge wecken, und das tat es bei mir auch. Aber dieses Bild führte auch dazu, dass das Problem vielen als weit weg erschien, auch mir. Ich machte mir wegen des schmelzenden Meereises Sorgen um die Eisbären, vielleicht auch um Pinguine. Aber ich machte mir deswegen keine Sorgen um die Menschen oder gar um mich.
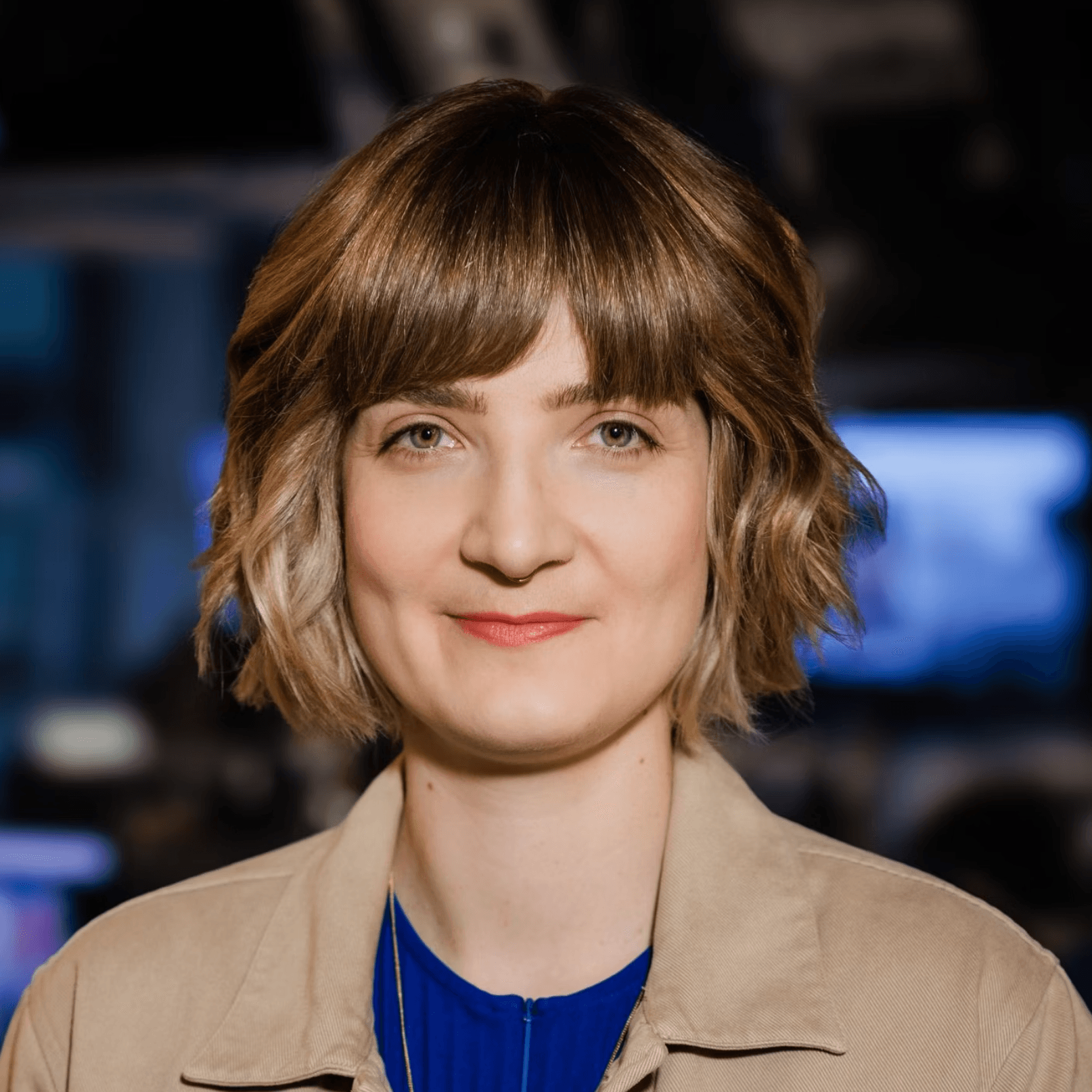
Zur Person
Die Lage ist extrem ernst, aber nicht hoffnungslos. Nach diesem Motto erklärt die freie Journalistin Sara Schurmann die großen Zusammenhänge und kleinen Details der Klimakrise, sodass jede und jeder sie verstehen kann.
Etwa in ihrem Buch "Klartext Klima!" – und jetzt in ihrer Kolumne bei t-online. Für ihre Arbeit wurde sie 2022 vom "Medium Magazin" zur Wissenschaftsjournalistin des Jahres gewählt.
Dabei beeinflusst die Eisschmelze nicht nur das Leben der Tiere im Eis, sie hat Einfluss auf das Klimasystem an sich. Betrachtet man die Erde aus dem Weltall, erscheint das Meereis als eine weiße Fläche. Fallen Sonnenstrahlen darauf, reflektiert es einen Teil der einfallenden Energie zurück. Schmilzt das Eis, nimmt die weiße Fläche ab, die dunkle Fläche des Meeres nimmt zu. Es kommt zu einem doppelten Effekt: Einerseits wird weniger Energie durch weiße Flächen abgeleitet, andererseits nehmen dunkle Flächen mehr Energie auf und tragen so dazu bei, dass sich die Meere und die Erde weiter erhitzen.
Der Eisschild in der Antarktis
Der Eisschild in der Antarktis gehört zu den sogenannten Kippelementen im Klimasystem. Das sind wichtige Teilsysteme der Erde, deren Zustand sich stark verändert, wenn ein bestimmter Schwellenwert überschritten wird. Aus dem Urwald, der seinen eigenen Regen erzeugt, wird eine Steppe, wenn zu viel davon abgeholzt wird. Aus einem immer wieder schmelzenden und zufrierenden Eisschild wird irgendwann einfach Wasser, wenn eine zu große Menge der Eismasse geschmolzen und der selbsterhaltende Rhythmus zerstört ist. Und diese Veränderungen sind nicht einfach wieder umzukehren. Es gibt drei Typen von Kippelementen: Ökosysteme wie der Amazonas oder die Korallenriffe, Strömungssysteme wie der Golf- oder Jetstream und eben Eis- und Permafrostsysteme. Viele Experten zeigten sich von der Entwicklung der vergangenen Jahre alarmiert. Einige Studien gehen davon aus, dass bestimmte Gebiete der Antarktis bereits einen Kipppunkt erreicht haben könnten.
Erst 2023 hatte das Meereis in der Antarktis, dem Polargebiet auf der Südhalbkugel, den niedrigsten je gemessenen Stand erreicht. (Ich spreche in diesen Zusammenhängen ungern von "Rekorden", warum, das habe ich hier erklärt.) 2022 und 2024 sah es nicht viel besser aus. Auch deshalb überraschte die große Ausdehnung des Meereises Anfang Januar. Vielleicht, so hofften einige, könnte sich das Eis der Antarktis in diesem Winter erholen und den Rückgang damit verlangsamen. Doch diese Hoffnung war vergebens. Es handelte sich nur um ein kurzzeitiges Phänomen. Ab Mitte Januar dehnte sich das Eis sogar weniger stark aus als im Durchschnitt. Gleichzeitig erreichte es in der Arktis im Januar einen neuen Tiefstwert.
Von einer Trendumkehr kann also keine Rede sein. Im Gegenteil. Im Januar gab es nämlich noch eine andere schlechte Nachricht: Die Kohlendioxid-Messstation auf dem Vulkan Mauna Loa verzeichnete den größten Zuwachs an CO2 in ihrer 66-jährigen Geschichte. Die Station auf Hawaii ist die führende Institution weltweit, wenn es um die Messung der CO2-Konzentration in der Atmosphäre geht. Von 2023 zu 2024 stieg der Wert um 3,58 Einheiten auf 422 und übertraf damit alle Erwartungen.
Die CO2-Konzentration steigt immer schneller
Gemessen wird die Konzentration von Kohlenstoffdioxid in der Atmosphäre in ppm, parts per million, übersetzt: Teile pro Millionen oder auch Millionsteln. Je höher dieser Wert ausfällt, desto stärker ist die aufheizende Wirkung des Treibhausgases. 1988, im Jahr meiner Geburt, wurden 352 ppm gemessen. Über große Teile der vorindustriellen Zeit lag dieser Wert im Bereich von 280 ppm.
Die CO2-Konzentration in der Atmosphäre steigt immer schneller an. Ursache dafür ist einerseits, dass die Menschen global noch nie so viel Kohle, Gas und Öl verbrannt haben wie 2024. Andererseits trägt auch die veränderte Nutzung von Landflächen dazu bei. Rodungen etwa führen dazu, dass die Natur weniger CO2 aufnehmen kann und selbst mehr davon in die Atmosphäre abgibt. Auch Brände haben einen ähnlichen Effekt, deren CO2-Ausstoß erreichte 2024 einen neuen Höchstwert. In der Vergangenheit hatte die Vegetation CO2 aus der Luft gezogen, sonst wäre die Konzentration noch viel höher. Diese Kapazität schwankt, vor allem im Zusammenhang mit den Wetterphänomenen El Niño und La Niña. Sie lässt mit der Erderhitzung aber auch insgesamt nach. Bei El Niño und La Niña handelt es sich um natürliche Veränderungen im System der Meeres- und Luftströmungen im Pazifik rund um den Äquator.
Wetterphänomen dämpft Erderhitzung ab
Für dieses Jahr wird erwartet, dass der Anstieg der CO2-Konzentration geringer ausfallen wird. Wegen des Wechsels von El Niño zu La Niña wird die Natur voraussichtlich wieder mehr CO2 aufnehmen können. El Niño bringt heißere und trockenere Bedingungen in den tropischen Landgebieten mit sich und führt in der Regel zu einem schnelleren jährlichen CO2-Anstieg. La Niña hat weitgehend gegenteilige Auswirkungen und führt somit zu einer langsameren Zunahme von CO2. Trotzdem wird der jährliche Anstieg zu hoch ausfallen, um mit den 1,5-Grad-Szenarien des IPCC vereinbar zu sein, prognostiziert der britische Wetterdienst Met Office. Die Temperaturmarke war 2024 erstmals übertroffen worden.
La Niña wird die Erderhitzung und ihre Auswirkungen in den kommenden Jahren also im besten Fall ein wenig abdämpfen. Stoppen wird sie die menschengemachte Entwicklung nicht. Der Januar 2025 war den Daten des EU-Erdbeobachtungsprogramms Copernicus zufolge der wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen. Und das, obwohl die gerade beginnende La-Niña-Phase eigentlich Kühlung bringen sollte.
- nsidc.org: "Charctic Interactive Sea Ice Graph" (englisch)
- zeit.de: "Rekordhoher CO₂-Ausstoß 2024 durch Waldbrände in Nord- und Südamerika"
- metoffice.gov.uk: "Mauna Loa carbon dioxide forecast for 2025" (englisch)
- climate.copernicus.eu: "Copernicus: January 2025 was the warmest on record globally, despite an emerging La Niña" (englisch)
- dpa-factchecking.com: "CO2-Messungen am Mauna Loa auf Hawaii sind aussagekräftig"
Quellen anzeigen























