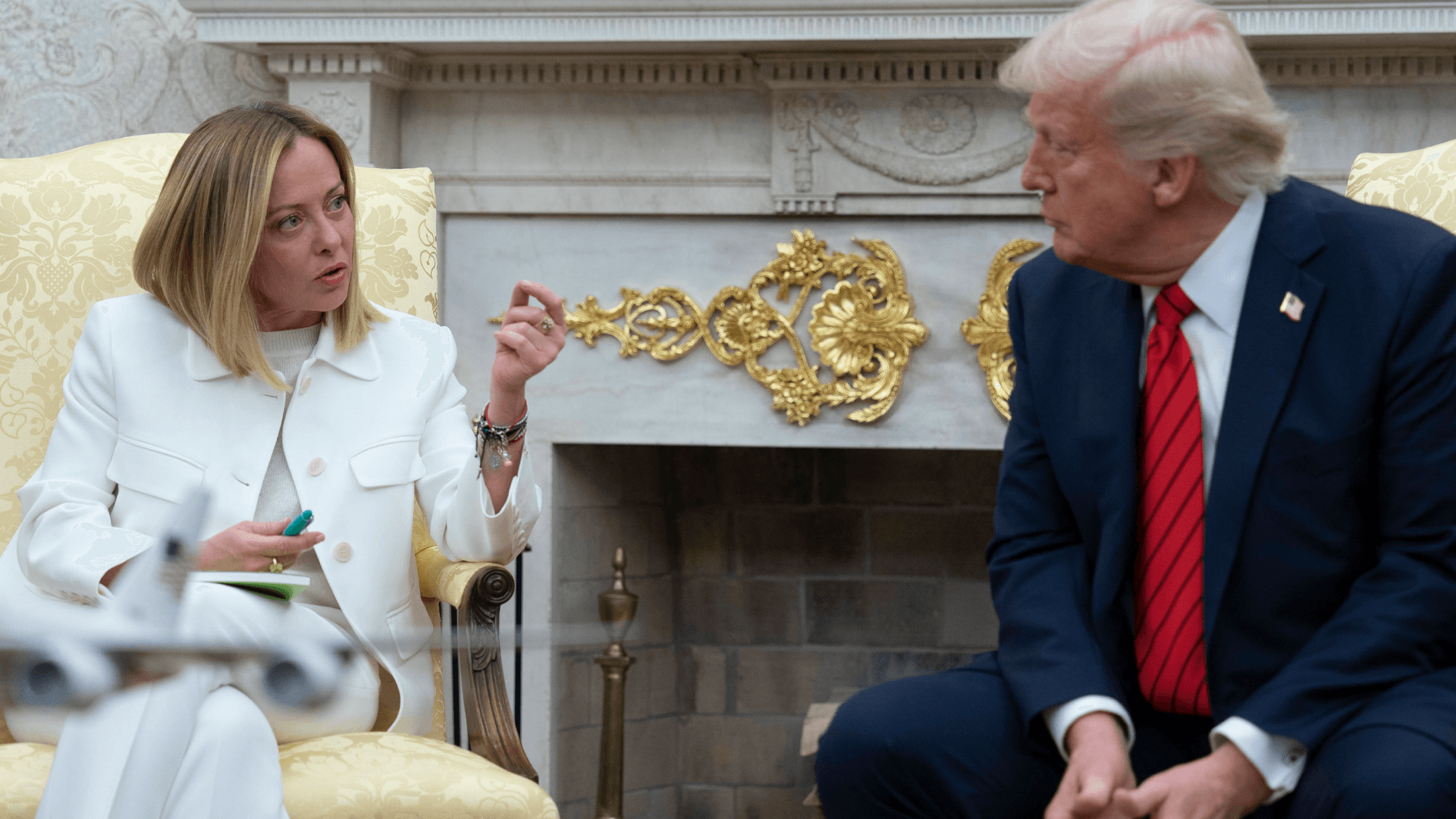Die subjektive Sicht des Autors auf das Thema. Niemand muss diese Meinung übernehmen, aber sie kann zum Nachdenken anregen.
Was Meinungen von Nachrichten unterscheidet.Flüchtlinge in Griechenland Diese Jahre der Schande waren ein Armutszeugnis für Europa


Nicht erst seit dem Brand in Moria ist das Leid für Flüchtlinge in Griechenland unfassbar groß. Reporterin Sophia Maier hat in den letzten Jahren das Schrecken in den Lagern miterlebt und ihren Glauben an Europa verloren.
In den vergangenen fünf Jahren war ich viele Male in europäischen Flüchtlingslagern. Idomeni, Samos, Grenzgebiet zur Türkei, und auch auf Lesbos. Nun ist dort das Lager Moria abgebrannt. 13.000 Verzweifelte, die jetzt auch ihr letztes Hab und Gut verloren haben, die Hoffnung auf Menschsein. Mit dieser Tragödie habe Europa seine Humanität und Würde verloren, lese ich in den sozialen Netzen und Kommentarspalten. Das ist falsch.
Europa, Träger des Friedensnobelpreises für den Einsatz für Menschenrechte, hat mit jedem Ertrunkenen im Meer und jedem Geflüchteten in den Elendslagern bereits vor vielen Jahren alle Werte vor seinen eigenen Toren abgegeben.
Ein persönliches Protokoll:
Lesbos (Griechenland), 2016:
Ich reise das erste Mal nach Lesbos, habe meinen Job an den Nagel gehängt und will hier für eine Hilfsorganisation arbeiten. Ich stehe an der Küste der griechischen Insel, blicke zur türkischen Grenze. Ein schöner, trügerischer Ausblick, denke ich mir. Während die Wärmedecken der letzten Nacht hinfort wehen, ertrinken in diesem Moment fünf Menschen in dem Meer vor mir. Es ist das Ende ihrer Reise.
Das Ende der Reise in ein menschenwürdiges Leben, hinein in einen unwürdigen Tod. Auch die eines sechs Monate alten Babys. Das Meer, es ist ein Friedhof, ein Massengrab für die Vergessenen. Zur gleichen Zeit: Der große Durchbruch, die Geburtsstunde des EU-Türkei-Deal. Das Lager Moria wird zu einem sogenannten EU-Hotspot. Der Plan: Innerhalb von wenigen Wochen sollen Asylanträge hier geprüft und Geflüchtete innerhalb der EU verteilt werden, während diejenigen ohne Schutzanspruch zurück in die Türkei sollen.
Sophia Maier (33) ist eine deutsche Journalistin und Fotografin. Seit 2016 ist sie freie Reporterin für das Format "stern TV".
Es sollte ein Masterplan sein, eine Antwort auf die vielen Geflüchteten, die nach Europa wollen, aber vor allem Antwort auf die Sorgen der besorgten Bürger. Aber nichts davon erfüllt sich, der Deal scheitert in der Praxis. Die Geflüchteten stecken bis zu mehreren Jahren in den Lagern auf den griechischen Inseln fest, im Dreck und Schlamm, teilweise ohne fließend Wasser und Elektrizität. Ja, es ist zwar ein Leben in Europa, aber einem Europa unwürdig, denke ich mir damals zum ersten Mal.
Idomeni (Griechenland), 2016:
Die Bilder der Menschen mit Willkommensplakaten an deutschen Bahnhöfen scheinen eine Ewigkeit her, tausende Geflüchtete versuchen über die Balkan-Route nach Westeuropa zu kommen. 2015 darf sich nicht wiederholen, mahnen Politiker. Die Grenzen in Europa werden dicht gemacht. Im griechischen Dorf Idomeni, nahe Mazedonien, stranden über mehrere Monate 10.000 Geflüchtete, meine Hilfsorganisation verlagert die Projekte hierher.
Während viele von uns gemütlich daheim im Warmen sitzen, harren sie unter erbärmlichen Bedingungen hinter einem riesigen Stacheldrahtzaun aus. Ein Zaun, den wir für viel, viel Geld gebaut haben. Die Menschen aber leben in undichten Zelten, im Dreck, in der Kälte, sie haben weder genug Wasser und Essen, noch genug Kleidung. Es sind Menschen mit Verletzungen, alte Menschen im Rollstuhl, Schwache, Kranke. Und es sind 5.000 Kinder. Unsere Zukunft. Die Verwundbarsten. Ich erlebe immer wieder gewaltsame Aufständen im Lager, Beamte reagieren mit Blendgranaten und Tränengas, die inmitten von Zelten von Familien einschlagen. Es sind Bilder, die schwer zu ertragen sind. Der damalige Innenminister Thomas de Maizière sagt: "Wir müssen diese harten Bilder aushalten."
Norbert Blüm will diese Bilder nicht nur aushalten, er will ein Zeichen setzen, Anteil nehmen. Er reist nach Idomeni. Der damals 80-Jährige steht im Regen und Matsch vor dem Stacheldrahtzaun, an dem Kinderkleidung zum Trocknen hängt, und sagt: "Europa, schäm dich!" Eine Szene, die mir bis heute Gänsehaut macht. Ich arbeite zu dieser Zeit für die Hilfsorganisation im Lager, wir verteilen Wasser, Essen und Kleidung. Ich treffe Norbert Blüm, zeige ihm unsere Arbeit, habe ehrliche Hoffnung, dass Europa bald zur Besinnung kommt, dass es diesen Menschen helfen wird. Ich glaubte damals noch fest daran, dass Europa nicht nur auf dem Papier für Menschenrechte und Menschenwürde steht. Sondern, dass diese europäische Idee wahrhaftig ist. Doch ich werde in den kommenden Jahren eines Besseren belehrt.
In Idomeni kursieren in dieser Zeit immer wieder Gerüchte, dass die Grenze aufgeht. Weil die Menschen leben wollen, halten sie an der Hoffnung fest. Dass sie doch noch die Chance auf ein Leben bekommen, ohne Bomben, Verfolgung und Krieg. Ein würdiges Leben, wie wir es führen dürfen. Offensichtlich ein Privileg im Europa des 21. Jahrhunderts.
Ich begleite mit der Kamera hunderte Menschen beim Versuch, nach Mazedonien gelangen. Unmenschliche, beschämende Momente. Kinder, die verzweifelt versuchten, einen reißenden Fluß zu überqueren, in dem kurz zuvor erst drei Menschen bei ihrem Fluchtversuch ertrunken sind. Alte, kranke Menschen, am Ende ihrer Kräfte, die sich durch den Schlamm kämpfen und immer wieder stürzen. Familienväter, die mit ihrer Familie einfach nur dem Ort entkommen wollen, an dem Europa seine Menschlichkeit aufgegeben hat.
Endlich angekommen werden sie von der mazedonischen Polizei verhaftet, geschlagen. Andere Familien stecken tagelang in den Bergen fest, festgehalten von Militär und Polizei. In der Kälte. Mit ihren Kindern. Ohne nichts. Es war hoffnungslos, die Grenze ging nie auf. Nach wenigen Monaten werden die Menschen mit Bussen in andere Lager gekarrt, wo sie unter den gleichen menschenunwürdigen Bedingungen ausharren müssen. Nichts ändert sich, niemand hilft, alles wird nur schlimmer.
Camp Moria (Lesbos), 2018:
Zwei Jahre später. Die Zahl der Asylanträge in Deutschland sinkt weiter, während immer noch fast täglich Boote auf den griechischen Inseln mit Geflüchteten ankommen. Manche ertrinken und sterben, andere überleben die gefährliche Überfahrt. Sie sind erleichtert und hoffnungsvoll, dass jetzt ein besseres Leben beginnt, ohne Krieg und Bomben. Aber sie wissen nicht, dass im Lager das nächste Trauma auf sie wartet.
Zu dieser Zeit warnt "Ärzte ohne Grenzen" immer wieder vor selbstmordgefährdeten Kindern im Lager, es sind Appelle, die schon längst nicht mehr gehört werden. Ich bin wieder zurück, möchte eine Reportage über die Kinder vor Ort machen. Zu diesem Zeitpunkt habe ich schon viele Lager auf der Welt sehen können: Im Irak, in Jordanien, im Libanon. Ich habe aber nie etwas Schlimmeres als auf Lesbos gesehen und erlebt. Die Menschen vegetieren in Zelten vor sich hin, inmitten von Müll und Ratten, sie haben zu wenig Essen und Trinken. Unter ihnen: Kranke, traumatisierte Menschen, Folteropfer. Und die EU? Es ist still geworden. Hauptsache, die Menschen bleiben, wo sie sind.
Ich treffe hier das Mädchen Paria aus Afghanistan. Sie erzählt mir, wie unfassbar kalt das Leben im Zelt ist, sagt, dass das hier kein Ort für Menschen ist, sondern für Tiere. Ich frage sie nach Spielsachen, sie lächelt, kramt in ihrer Jacke und holt stolz ihr einziges Spielzeug raus: Steine. Stinknormale, dreckige Steine. Sie sagt: "Ich bin alleine hier, ich muss mich beschäftigen, was soll ich sonst tun? Ich bin einsam und versuch mir mit diesen Steinen die Zeit zu vertreiben." Es ist eine berührende Begegnung von etlichen, und doch prägt sie sich tief in mir ein. Diese kleine Mädchen, das alles verloren hat, und sich über ein paar Steine freut, es macht mich fertig. Es ist mein persönlicher Wendepunkt, weil ich immer mehr verstehe, dass das hier alles nicht aus Versehen passiert, sondern dass es gewollte Abschreckung ist, dass sich nichts ändern wird, dass die europäischen Werte in der Praxis keinen Bestand haben.
Samos, Griechenland (2019):
Während in Moria gerade wieder zwei Menschen bei einem Feuer ums Leben gekommen sind, fahre ich in das Lager der Insel Samos. Hier gibt es Platz für knapp 700 Menschen, tatsächlich leben hier aber über 4.000 Geflüchtete. Ein Leben ist es nicht, sie vegetieren in Zelten vor sich hin, sind verzweifelt, apathisch, hoffnungslos. Pro Person gibt es gerade mal eine Wasserflasche pro Tag, für ein wenig Essen müssen sie sich stundenlang anstellen.
Die hygienischen Zustände sind katastrophal, das Lager ist voller Insekten, Schlangen und Ratten. Es gibt kaum Toiletten oder Duschen, und die wenigen sind völlig verdreckt, kaputt und unbenutzbar. Ich habe eine junge Frau getroffen, deren Toilette ein kleiner Eimer in ihrem Zelt ist. Sie hat Angst, nachts rauszugehen, es gibt Berichte von Missbrauch. Frauen erzählen, dass sie aus Verzweiflung von irgendjemanden schwanger werden, nur damit sie die Chance haben, die Hölle von Samos verlassen zu dürfen. Eigentlich sollten die Geflüchteten maximal drei Monate auf ihren Asylentscheid warten, inzwischen sind es mehrere Jahre. Mehrere Jahre in absoluter Perspektivlosigkeit, Leere und ohne zu wissen, wie das eigene Leben weitergeht, ob es denn überhaupt weitergeht.
Das Lager lässt mich so nachdenklich wie schon lange nichts mehr zurück. Was sagt man einer schwangeren Frau, die wissen will, wo sie ihr Baby auf die Welt bringen kann? Was sagt man einem kleinen Kind, dessen Finger nachts von einer Ratte abgefressen wurde? Wie sagt man all den hier gestrandeten Menschen, dass dieses Elend, diese Menschenverachtung nun das sichere Europa ist, von dem sie geträumt haben? Das ist kein Ort zum Leben, es ist ein Ort zum Sterben. Jeden Tag kommen immer neue Boote an der Küste an, auf ihnen schwangere Frauen, etliche Kinder, traumatisierte Menschen. Wie können wir zulassen, dass Menschen, die vor Terror, Verfolgung und Krieg geflohen sind, unter solchen inhumanen, menschenunwürdigen Bedingungen leben müssen? Ich verstehe: All das wird nicht enden. Europa wird weiter wegschauen. Europa interessiert sich nicht für diese Menschen. Es gibt keine europäische Idee. Es war alles eine große, verdammte Lüge.
Türkisch-griechische Grenze, 2020:
Die türkische Regierung hat verkündet, dass sie ab sofort niemanden mehr davon abhält, die Grenze zu Griechenland zu überqueren. Tausende Menschen machen sich in Bussen auf den Weg. Griechenland reagiert mit Härte, versucht die Menschen mit Gewalt zu stoppen: Bilder zeigen, dass griechische Beamte Tränengas und Blendgranaten einsetzen. Ich sitze vor meinem Smartphone in meiner Wohnung in Beirut, schaue die Bilder und Videos an, erinnern mich an alles, was ich damals in Idomeni gesehen und erlebt habe. 2015 kann sich wiederholen. Europa hat nichts gelernt. Ich nehme den nächsten Flieger in die Türkei.
Ich treffe die junge Mutter Asma, sie sitzt auf dem Gras im Nirgendwo zwischen der Türkei und Griechenland. Ihr kleiner Sohn will einfach nicht aufhören zu schreien, sie gibt ihm die Brust, singt arabische Kinderlieder, schaukelt, streichelt ihm langsam über den Kopf. Der Wind pfeift höllisch, hier am Grenzfluss Evros. "Ich kann nicht ertragen, dass mein Kind hier so friert und es ihm so schlecht geht. Das bricht einem das Herz", sagt sie. In ihren Augen sehe ich viel Wut, aber noch mehr Verzweiflung. Doch sie will nicht aufhören zu hoffen, dass sich bald die Grenze nach Europa öffnet. Dass sie und ihre Familie endlich leben dürfen, leben wie wir auf der anderen Seite des Flusses. Ihre Hoffnung ist das letzte bisschen Würde, das ihr auf ihren vielen Jahren der Flucht geblieben ist.
Wenige Tage später werden die Menschen wieder von der Grenze in Bussen abtransportiert. Sie waren nicht mehr als Spielfiguren, einer Verhandlungsmasse der Politik. Wieder einmal. Monate später recherchiert der Spiegel, dass griechische Beamte einen Geflüchteten beim Versuch des Grenzübertritts erschossen haben. Tödliche Schüsse aus der EU auf Menschen, die auf der Flucht sind. Ich möchte kotzen.
Heute:
Ich habe in den vergangenen Jahren viele Geflüchtete in Europa getroffen. Eines verbindet sie alle: Sie glauben bis heute an Europa. Ein Europa der Menschenrechte und der Menschenwürde. "Europe, good!" Diesen Satz habe ich immer wieder gehört. Ich habe auch einmal an dieses Europa geglaubt.
Ich erinnere mich, ich saß im Unterricht, 11. Klasse, Sozialkundeunterricht. Gründung der EU, Europäischer Rat, Europäisches Parlament, viel Theorie und Auswendiglernen, also nichts, worauf ich als Schülerin besonders Lust hatte. Auf eines hat unser Lehrer besonders viel Wert gelegt: Die Charta der Grundrechte der EU. Der zweite Satz lautet: "In dem Bewusstsein ihres geistig-religiösen und sittlichen Erbes gründet sich die Union auf die unteilbaren und universellen Werte der Würde des Menschen, der Freiheit, der Gleichheit und der Solidarität." Immer wieder wurde mir als Schülerin eingebläut, wie fortschrittlich, anders, besonders Europa ist.
Heute bin ich 33, Sozialkunde liegt viele Jahre zurück, nicht so lange, aber der tiefe Stolz in mir, ein Teil von diesem Europa der Menschenrechte und Menschenwürde zu sein. Ja, ich war stolz. Stolz, dass ich in einem Europa großgeworden bin, das Menschen würdevoll behandelt. Das demokratisch ist. Das Recht einhält. Nicht wie viele andere Staaten, durchtränkt von korrupten Strukturen, dokumentierten Menschenrechtsverletzungen und mit Diktatoren an ihrer Spitze.
Wenn ich heute an Europa denke, bin ich nicht mehr stolz. Ich begreife, dass wir nicht besser als die anderen sind, nur auf dem Papier die Guten sind. Ich schäme mich zutiefst. Denn was seit vielen Jahren an den europäischen Außengrenzen und in Europa passiert, ist – nicht erst mit dem Brand von Moria – die finale Komplettaufgabe von allen humanistischen Werten.
Die einzige Antwort auf das Flehen von Verzweifelten sind Armeen, Mauern und Stacheldraht. Wir feuern Tränengas und Gummigeschosse auf Geflüchtete, auf Menschen, die Schutz bei uns suchen. Anstatt Ihnen zu helfen, setzen wir das Asylrecht aus, lassen sie jahrelang in Elendslagern auf europäischen Boden vor sich hinvegetieren, verletzten sie, töten sie. Inzwischen sind es zehntausende Ertrunkene auf dem Meer, vor unseren Toren. Es ist uns egal, wir haben uns an die Verzweifelten in den Lagern und Toten auf dem Meeresgrund gewöhnt. Ein Armutszeugnis für diesen angeblichen Kontinent der Menschenrechte und Menschenwürde.
Schätzungsweise 50.000 Geflüchtete leben in Griechenland. Das würde bei einer gerechten Verteilung für jedes einzelne EU-Land die Aufnahme von 1.851 Menschen bedeuten. 1.851. Das ist lächerlich wenig, aber zu viel für uns. Uns, die alles haben, nur keine Empathie und Mitmenschlichkeit. Irgendwo auf dem Weg haben wir vergessen, dass die Menschen vor unseren Grenzen und in den Lagern tatsächliche Menschen sind, Menschen wie du und ich. Wir vergessen, dass wir diese Menschen sein könnten, dass auch von unserem Himmel Bomben fallen könnten, wir in diesem makaberen Spiel nicht die Besseren, sondern einfach nur die Glücklicheren sind. Ich wünsche mir, dass sie alle eines Tages zu den Glücklichen gehören.
- Eigene Recherche