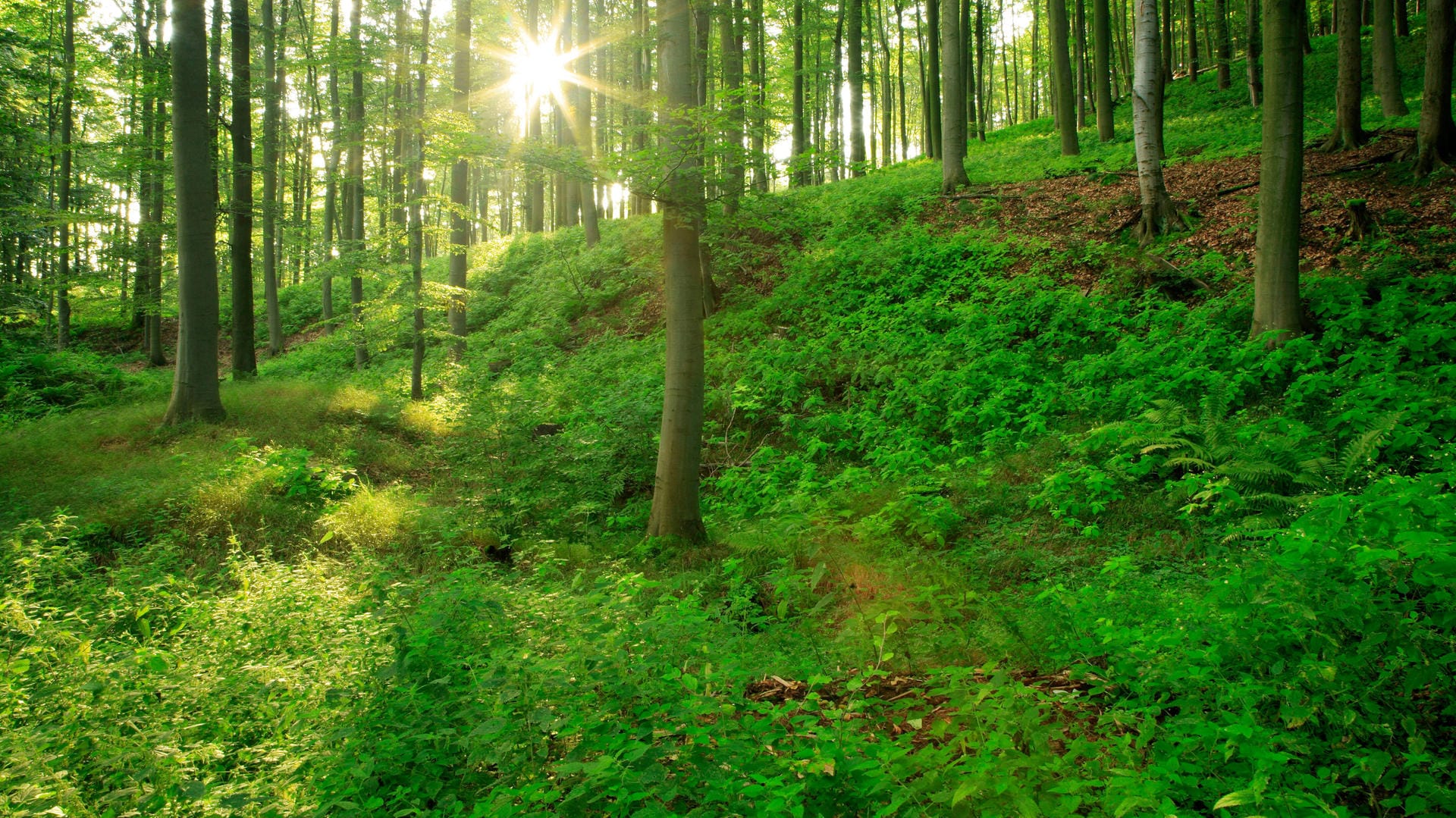Der Gesprächspartner muss auf jede unserer Fragen antworten. Anschließend bekommt er seine Antworten vorgelegt und kann sie autorisieren.
Zum journalistischen Leitbild von t-online.Waldbrände in Deutschland "Wir könnten Feuer bekommen wie in Kanada"


Hitze, Borkenkäfer, Waldbrände – die deutschen Wälder sind großen Belastungen ausgesetzt. Wie kann Deutschland dagegen vorgehen? Der Forstwissenschaftler Alexander Held hat Antworten.
Seit 2018 ist die Zahl der Waldbrände in Deutschland stark gestiegen. Auch in diesem Jahr sagen Meteorologen wieder einen extrem heißen und trockenen Sommer voraus. Die Gefahr von Waldbränden steigt. Ist Deutschland dieses Jahr besser auf Waldbrände vorbereitet? Brauchen wir einfach mehr Löschhubschrauber oder sitzt das Problem tiefer? Und welche Rolle spielt der Klimawandel?
Alexander Held ist Forstwissenschaftler und Feuermanager. Er sagt: Die deutsche Politik muss den Wald mehr wertschätzen. Im Interview mit t-online.de erklärt er, was Deutschland im Brandschutz besser machen muss, wieso wir den bestmöglichen Wald brauchen und warum Waldschutz nicht umsonst bleiben darf.
t-online.de: Herr Held, hinter uns liegen zwei heiße und trockene Jahre. Die Zahl der Waldbrände ist stark gestiegen, auch der Borkenkäferbefall macht den Wäldern zu schaffen. Wie ist es im Jahr 2020 um den deutschen Wald bestellt?
Alexander Held: Die Lage der deutschen Wälder ist kritisch. Wir sehen, dass zwei Jahre Trockenheit ausreichen, um unseren Wald, unsere Wirtschaftswälder auf die Probe zu stellen. Folgeschäden wie der Borkenkäfer sind eine zusätzliche Belastung. Wir beobachten zum Beispiel ein großflächiges Absterben von hauptsächlich Fichtenwäldern.
Inwiefern ist das ein Problem?
Das ist vor allem aus menschlicher Sicht problematisch. Denn Dienstleistungen, die die Wälder uns liefern, beschränken sich ja nicht nur auf Bauholz. Der Wald liefert uns Sauerstoff und Wasser, speichert CO2, gleicht die Temperatur aus und spendet Schatten. All das ist in Zeiten des Klimawandels viel wichtiger als Bauholz und gerät immer mehr in Gefahr. Rein aus Waldsicht sind die Schäden kein Problem, Wälder regenerieren sich. Ob das 100 oder 200 Jahre dauert, ist dem Ökosystem egal. Nur wir mit unseren Ansprüchen an den Wald, der die wichtigste Baustelle im Klimawandel ist, haben diese Zeit nicht.
Wurden die Probleme nicht rechtzeitig erkannt?
Dass unsere Wälder sind, wie sie sind, ist natürlich historisch bedingt. Es gab sogar schon in den 1920ern genügend Förster, die lamentiert haben, dass Fichtenplantagen keine Wälder sind. Das waren aber Einzelstimmen, die untergegangen sind. Wo wir auf jeden Fall Versäumnisse haben, ist, dass es zu lange gedauert hat, bis unter den Förstern – und ich möchte mich da bewusst mit einnehmen – ein Umdenken stattgefunden hat. Erst Ereignisse wie schwere Stürme in den 90ern haben ein Umdenken überhaupt salonfähig gemacht.
Laut Prognosen von Meteorologen steht nach den vergangenen zwei Dürrejahren auch dieses Jahr wieder ein heißer Sommer bevor. Wächst damit auch die Gefahr für Waldbrände?
Ja, unbestritten. Das Risiko für Waldbrände wird in Deutschland mit Sicherheit zunehmen. Nach Messdaten des Deutschen Wetterdienstes ist es eindeutig, dass wir in eine wärmere Zukunft gehen. Wir bekommen häufiger Extremwetterlagen, egal ob Niederschlag, Sturm oder Hitze. Dadurch wird Deutschland brennbarer – nicht nur in Brandenburg, sondern auch im Rest der Republik. Hinzu kommt die Wuchsleistung unserer Wälder. Wir produzieren unglaublich viel Biomasse. Die Brandlast ist um ein Vielfaches höher als zum Beispiel in Spanien. Das heißt, wenn unsere Biomasse anfängt, trocken zu werden und sich die Biomasse in Brennstoff verwandelt – was im Übrigen durch den Borkenkäferbefall noch beschleunigt wird – dann spricht nichts dagegen, dass wir mit unserer Waldstruktur Feuer bekommen, die wir normalerweise eher aus Kanada kennen.
Was bedeutet das für ein dicht besiedeltes Land wie Deutschland?
Wir leben nicht in Kanada. Bei uns gibt es alle paar hundert Meter eine Straße, eine Eisenbahnlinie, eine Siedlung. Wir brauchen keine riesigen Brände wie in Kalifornien. Uns reichen oft ganz kleine Brände, die genauso viel Schaden anrichten. Straßen müssen gesperrt, Siedlungen evakuiert werden, weil wir nirgendwo einen Übergangsbereich zwischen Wald und Zivilisation haben. Solche Sicherheitsstreifen oder Pufferzonen gibt es fast nirgendwo in Deutschland. Das sind keine Konzepte, die man erst erfinden müsste. Die gibt es längst überall auf der Welt. Aber die Bedrohung durch Brände ist in unserer Mentalität noch nicht so angekommen wie durch Hochwasser. Jeder in der Bevölkerung versteht, warum in der Überflutungszone der Oder nicht gebaut wird, aber beim Wald sind wir noch nicht so weit. Sein Haus mitten ins Grüne zu bauen ist wunderschön, aber an Feuer denkt keiner.
Wurden Waldbrände hierzulande lange Zeit nicht ernst genug genommen?

Alexander Held, 45 Jahre alt, ist seit 2012 Experte für forstliches Risiko am European Forest Institute (EFI). Zuvor war der studierte Diplomforstwirt als Feuerökologe und Feuermanager weltweit unterwegs, unter anderem lange Zeit in Afrika. Er sitzt in Arbeitskreisen zur Waldbrandbekämpfung im Bund und der EU.
Wir müssen zu einer Strategie kommen, dass alle an einem Strang ziehen. Momentan sind es nur sektorale Ansätze. Feuerwehren diskutieren über neue Löschfahrzeuge und Hubschrauber, doktern aber eigentlich nur am Symptom herum. Wir müssen die Land- und Forstwirtschaft genauso in die Pflicht nehmen.
Andere Länder sind schon weiter. Inwieweit können die Behörden von den Erfahrungen europäischer Nachbarn lernen?
Vor etwa 20 Jahren war es noch relativ schwierig, einen Austausch zwischen den Mittelmeerländern und Zentral- und Nordeuropa hinzubekommen. Das waren zwei getrennte Welten im Bereich Waldbrand. Heute ist es kein Problem mehr, sich auszutauschen und auch zu diskutieren, was in den letzten Jahrzehnten schiefgelaufen ist. Die Spanier und Portugiesen sind mittlerweile sehr offen zu sagen, dass sie jahrzehntelang unnötigerweise auf Löschflugzeuge gesetzt haben und Hunderte Millionen Euro pro Jahr und Land ausgegeben haben. Wir am EFI bieten zum Beispiel Austausche nach Portugal, nach Spanien oder auch nach England an, das uns im Übrigen etwa zehn Jahre im Management von Feuer voraus ist. Leider trifft man aber oft auf die deutsche Bürokratie, die den Austausch verlangsamt.
Haben Sie einen Vorschlag, wie es besser laufen könnte?
Wir müssen von befristeten Projekten wegkommen hin zu nachhaltigen Waldbrandprogrammen. Dann gibt es eine bessere Finanzierung, um internationales Wissen anzupassen und auch auf deutscher Sprache verfügbar zu machen. Wir müssen uns auf Resilienz und präventiven Brandschutz konzentrieren, nicht mehr nur wie üblich auf die Bekämpfung und Unterdrückung von Bränden. Wir sehen ja weltweit, dass es nicht mehr funktioniert. Genauso sollte nicht mehr so viel Zeit für das Stellen von Projektanträgen verschwendet werden müssen. Aber dazu brennt es wahrscheinlich noch nicht genug in Deutschland.
Ist Deutschland denn besser auf Waldbrände vorbereitet als in den vergangenen Jahren?
Was den präventiven Brandschutz anbelangt – also zu verstehen, warum sich das Feuer in der Landschaft ausbreitet, wie man die Ausbreitung vorbeugend verhindern kann und wo man das Feuer am besten bekämpfen kann –, haben wir noch Nachholbedarf. Aber die Feuerwehren lernen schnell. Es gibt eine hohe Nachfrage nach Schulungen. Schauen wir uns aber an, wie viele Feuerwehrleute wir eigentlich trainieren müssten, geht das nur über ein koordiniertes Programm, über die Landesfeuerwehrschulen und parallel dazu über die forstlichen Ausbildungsstätten. Denn wenn das Klima noch trockener wird – das sehen wir ja in Spanien, in Griechenland, in Kalifornien – dann können wir noch so viele Feuerwehrleute ausbilden. Wenn die Landschaft nicht besser gemanagt wird, hilft uns irgendwann auch die beste Feuerwehr nichts mehr.
Inwiefern wird das Problem durch den Klimawandel noch dringlicher?
Dass der Klimawandel Einfluss darauf hat, dass wir häufiger Extremwetterlagen haben, ist unbestritten. Es gibt aber diejenigen, die sagen, dass man als Einzelner ohnehin nichts dagegen machen kann. Eigentlich ist das eine Ausrede dafür, weiterzumachen wie davor. Es geht aber darum, zu sagen: ja, wir haben den Klimawandel, ja es wird schlimmer. Das behindert uns aber nicht, sondern sollte uns im Gegenteil anspornen, mit der Land- und Forstwirtschaft daran zu arbeiten, dass unsere Landschaft resilienter wird. Und dass, wenn sie brennt, sie nicht so viel Schaden nimmt. Es geht darum, Strukturen zu schaffen, innerhalb derer wir auch Waldbrände sicher und effizient bekämpfen können. Das kann man ohne Berücksichtigung des Klimawandels sowieso tun. Unter dem Szenario Klimawandel müsste man aber noch viel mehr Energie investieren. Denn es wird mehr brennen.
Gerade wegen des Klimawandels wird eine Zusammenarbeit auf internationaler Ebene in der Waldbewirtschaftung und Aufforstung immer wichtiger. Wo sehen Sie da die größten Probleme?
Wir brauchen einen besseren politischen Rahmen. Es geht darum, dass sich beispielsweise Grundbesitzer in Südamerika darauf einlassen, keine Rinder mehr zu züchten oder Palmöl zu produzieren, sondern stattdessen Waldflächen auf ihrem Grund anlegen.
Welche Anreize müsste man dafür schaffen?
Wir kommen nicht drum herum, dass die Gesellschaft, die vom Wald als CO2-Speicher, Wasserspeicher und Klimapuffer profitiert, irgendwann eine Abgabe zahlt. Diese Waldfunktionen sind momentan kostenlos. Das wird auf Dauer aber nicht durchzuhalten sein. Genauso muss es beim präventiven Waldschutz funktionieren. Wenn ein Waldbesitzer heute anfängt, seinen Bestand aufzulichten, verzichtet er ja auf potenzielle Einnahmen. Das tut er natürlich für sich und seinen Wald, aber auch für die Gesellschaft. Wir werden diese Leistungen irgendwie honorieren müssen. Ob das dann Steuererleichterungen sind oder Subventionen, bleibt abzuwarten.
Wird der Wald mit all seinen Funktionen für die Gesellschaft also nicht genügend wertgeschätzt?
Ja. Insgesamt brauchen wir einen viel größeren politischen Stellenwert von Wald, auch bei uns. Dabei dürfen wir aber nicht nur auf die Quantität schauen und Millionen Hektar neuen Wald pflanzen, sondern auch auf die Qualität. Der neue, aufgeforstete Wald müsste weg von Monokulturen hin zu einem richtig reichhaltigen Waldboden, der Wasser speichern kann. Es muss der Gesellschaft etwas wert sein, den bestmöglichen Wald zu bekommen. Es geht aber wie bei so vielen Dingen immer ums Geld. Es wird noch dauern, bis wir politische Rahmenbedingungen dafür haben. Das wichtigste ist jetzt die Aufforstung. Es darf aber keine Hektik aufkommen, sonst machen wir wieder dieselben Fehler, die wir schon einmal gemacht haben.
Wie können wir es denn schaffen, den bestmöglichen Wald zu bekommen?
Das geht über den Waldumbau – also die Umstellung von Mono- zu Mischkulturen – dem man sich in den 90er-Jahren verschrieben hat. Eigentlich müsste er viel weiter sein. Ist er aber nicht. Waldumbau funktioniert nicht von jetzt auf gleich. Es gibt Hürden, die das erschweren.
Und wie wären?
Einerseits haben wir in Deutschland noch eine sehr hohe Dichte an Wildbeständen. Gerade an den Standorten, die wir jetzt umbauen müssten, verhindert ein hoher Verbissdruck des Wildes den eigentlich natürlichen Waldumbau.
Was meinen Sie mit Verbissdruck?
Wenn man sich anschaut, was normalerweise am Waldboden keimt, kommt der Mischwald eigentlich von allein. Aber Rehe sind natürlich Feinschmecker und fressen die Keimlinge der Baumarten, die wir eigentlich brauchen, so wie Ahorn, Tanne, Eiche oder Linde. Wenn wir den Umbau beschleunigen wollen – und das auf großer Fläche – bräuchten wir eine daran angepasste Jagdstrategie.
Können Sie das genauer erläutern?
Die Jagd ist eine Baustelle, die den Waldumbau tatsächlich verzögert. In Thüringen gibt es einen ersten Beschluss, die die Jagdausübung und das Jagdrecht auf großen Schadflächen anpasst, damit diese Flächen überhaupt eine Chance haben, auf natürliche Weise zu wachsen.
Was verstehen Sie unter Schadflächen?
Mit Schadflächen meine ich die vom Borkenkäfer, Trockenheit und Feuer betroffenen Waldbestände, die jetzt absterben. Auf diese Flächen muss jetzt aufgeforstet werden. Idealerweise kommt die neue Waldgeneration durch natürliche Verjüngung aber von ganz allein.
Und so einen Beschluss wie in Thüringen müsste es für ganz Deutschland geben?
Richtig. Das wird aber unglaublich kompliziert, weil die Jagdlobby natürlich über Jahrhunderte gewachsen ist und es eine starke Verflechtung zwischen Jagd und Politik gibt. Wenn wir das nicht tun, dann müssen wir künstlich aufforsten. Aber wo bekommen wir die Pflanzen her und Leute, die gut pflanzen können? Und wie schützen wir diese Pflanzen? Das Wild ist ja trotzdem da. Die Jagd ist eine Stellschraube, die nicht so leicht zu drehen ist.
Und die andere Hürde?
Es hängt nicht nur vom Willen des Försters ab, ob er einen reinen Fichtenbestand in einen Mischbestand überführt. Da spielen noch die Waldbesitzer mit rein. Das sind nicht immer Förster, sondern auch Kommunen, der Staat oder private Besitzer. Und die wollen mit dem Wald wirtschaften und Geld verdienen. Jeder hat natürlich die Freiheit selbst zu entscheiden, wie er mit seinem Bestand wirtschaftet. Aber es gibt genügend Beispielbetriebe in Deutschland, die schon seit Jahrzehnten nach den Kriterien der naturnahen Waldwirtschaft wirtschaften.
Was für Kriterien sind das?
Die Betriebe arbeiten nach den Prinzipien der Arbeitsgemeinschaft Naturgemäße Waldwirtschaft. Diese Prinzipien orientieren sich am Modell des unberührten Naturwaldes. Man schaut sich Wälder an, die seit vielen Jahrhunderten kaum oder gar nicht vom Menschen genutzt wurden und untersucht deren Dynamik. In solchen Wäldern gibt es bis zu zehn verschiedene Baumarten, die irgendwann an Altersschwäche sterben. Einzelne Baumriesen brechen zusammen und hinterlassen relativ kleine Lücken, in denen sich der Wald selbst regeneriert. Der naturnah wirtschaftende Wald erntet also alte dicke Bäume und ahmt das System des Naturwaldes nach. Das bedeutet aber auch, dass in einem solchen Betrieb streng und scharf gejagt wird, damit diese permanente Verjüngung stattfinden kann.
Und das lohnt sich für die Betriebe?
Es gibt eine ganze Liste an Betrieben in Deutschland – die damit auch Geld verdienen –, die deutlich weniger betroffen sind von der Trockenheit und dem Borkenkäferbefall. Ihr Wald ist abwechslungs- und strukturreicher. Aber das verlangt von dem Waldbewirtschafter viel Fingerspitzengefühl. Man muss seinen Wald schon verstehen.
Könnte so etwas auch in Brandenburg funktionieren, das von Waldbränden ja besonders stark getroffen wurde?
Brandenburg hat eine Sonderlage mit ausgedehnten Kiefer-Monokulturen auf Sandboden. Und darunter wächst Gras. Das ist eine Kombination, die unglaublich brennbar ist. Deswegen ist es nicht verwunderlich, dass wenn es bei uns brennt, es hauptsächlich in Brandenburg ist. Natürlich ist die Kiefer die einfachste Baumart, die auf diesen Standorten wachsen kann. Aber auch hier haben wir Beispiele, dass wir, wenn wir die Jagd richtig betreiben, etwa Linden, Douglasien und Eichen pflanzen können. Die wachsen dort natürlich nicht so gut wie im Schwarzwald, aber wir können auch dort eine Waldstruktur hinbekommen, die lange nicht so brennbar ist wie Monokulturen.
Es gibt Studien, die besagen, dass durch nachhaltige Aufforstung im globalen Maßstab die CO2-Bilanz deutlich aufgebessert werden kann. Was sagen Sie zu solchen Vorhaben?
Ich habe die Hoffnung, dass diese Ideen umgesetzt werden. Es gibt in Lateinamerika den Plan, riesige Flächen wieder aufzuforsten. Man sieht schon, dass sich da was tut. Es geht in die richtige Richtung, aber der Maßstab ist noch viel zu klein. Es ist richtig und wichtig, Wald zu pflanzen, um CO2 zu binden, die heißen Temperaturen zu dämpfen und den Wasserhaushalt zu regulieren. Das eine ist, CO2 in wachsenden Bäumen zu speichern. Das andere ist aber, dass das gespeicherte CO2 nicht wieder verbrannt wird, sondern langfristig gespeichert wird, zum Beispiel durch den Bau von Holzhäusern.
Herr Held, vielen Dank für das Gespräch.
- Telefoninterview mit Alexander Held