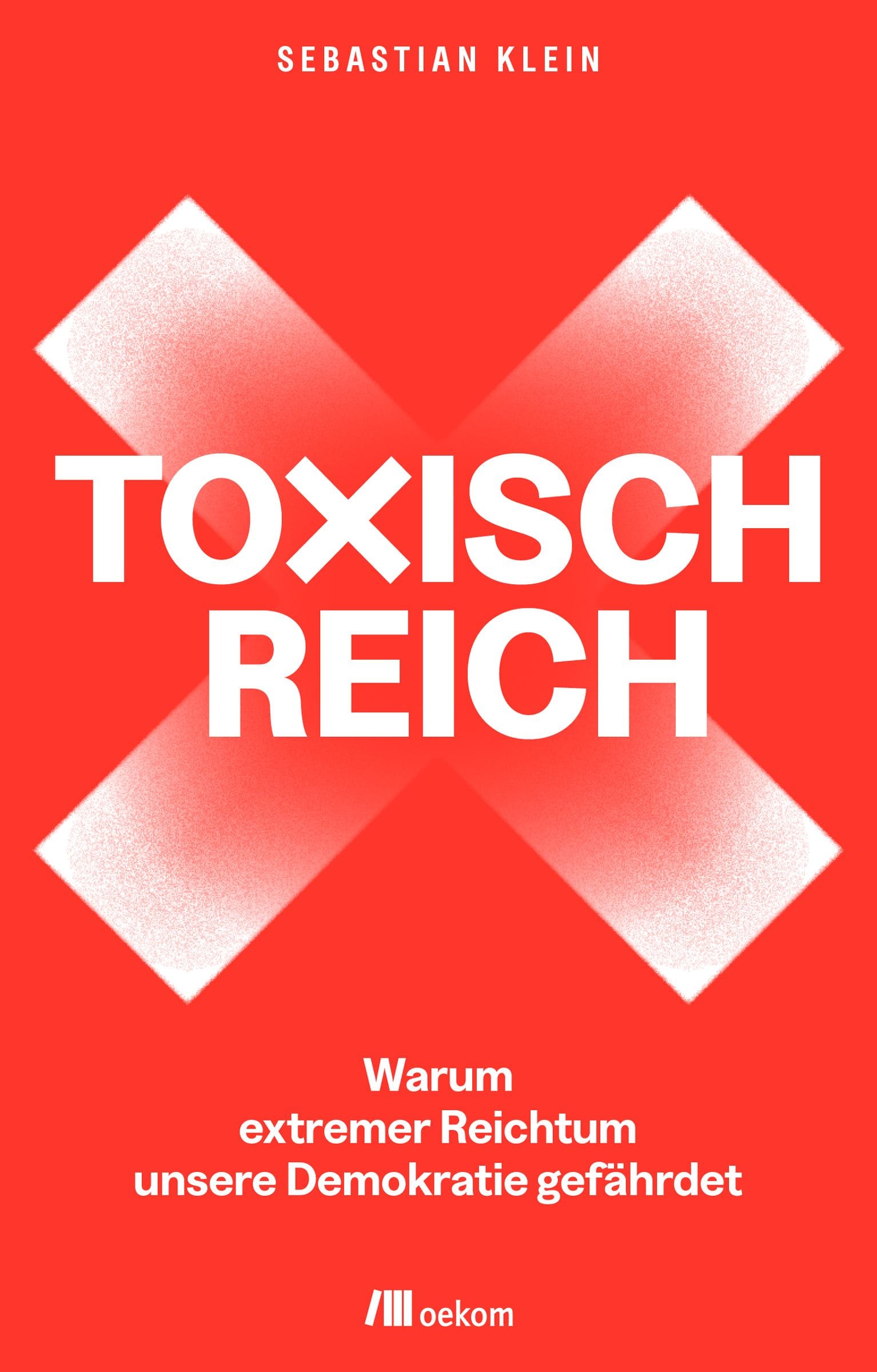Der Gesprächspartner muss auf jede unserer Fragen antworten. Anschließend bekommt er seine Antworten vorgelegt und kann sie autorisieren.
Zum journalistischen Leitbild von t-online.Toxisch reich Er hatte Millionen – und gab sie auf


Ein ehemaliger Unternehmer entschließt sich, 90 Prozent seines Vermögens für gemeinnützige Zwecke zu geben. Er sagt: "Reichtum ist Macht – und das ist gefährlich."
Im Jahr 2012 gründete Sebastian Klein das Unternehmen Blinkist – eine App, die Buchinhalte in Kurzform anbietet. Als Blinkist verkauft wird, ist Klein Millionär. Doch dann traf er eine radikale Entscheidung: Er entschied sich, 90 Prozent seines Vermögens abzugeben und in gemeinnützige Zwecke fließen zu lassen. Warum?
Im Interview mit t-online spricht er über die toxische Wirkung von Geld, die Schattenseiten des Reichtums, die Verantwortung von Vermögenden und darüber, wie gesellschaftlicher Wandel auch mit persönlichem Verzicht beginnen kann.
t-online: Herr Klein, womit wurden Sie reich?
Klein: Im Jahr 2012 habe ich gemeinsam mit drei Mitgründern das Unternehmen Blinkist ins Leben gerufen – ein Dienst, der Buchinhalte in kurze, verständliche Zusammenfassungen überträgt. Vor etwa zwei Jahren wurde Blinkist von einer australischen Firma übernommen. Der Großteil meines Vermögens stammt aus diesem Verkauf. Bereits vorher hatte ich etappenweise Anteile verkauft und weitere Firmen gegründet und investiert. Auch wenn nicht alles aus Blinkist stammt – es ist der größte Teil meines Vermögens.
Können Sie sagen, wie viel das insgesamt war?
Nach dem Verkauf belief sich mein Privatvermögen auf etwas über fünf Millionen Euro.
Wann haben Sie gemerkt, dass Sie das Geld gar nicht mehr wollen?
Das war ein schleichender Prozess. Ab 2017 begann ich, erste Anteile zu verkaufen. In dieser Zeit fiel mir auf, dass das Geld zunehmend mein Denken bestimmte. Ich fing an, mich mehr mit Investitionen, Renditen und Vermögensverwaltung zu beschäftigen – auf eine Art, die mir selbst unangenehm wurde. Ich hatte das Gefühl, mich zu weit von dem zu entfernen, was mir eigentlich wichtig war: Beziehungen, einfache Freuden, Natur.
War das eine Art innerer Wandel?
Absolut. Ich merkte, dass Geld ein Sog ist – fast wie eine Sucht. Ich hatte eine Excel-Tabelle, die meine Investitionen auflistete. Ich überprüfte sie ständig, überlegte, wie ich umschichten könnte, was mehr Rendite bringen würde. Das Geld begann, mein Denken zu dominieren. Das war nicht die Person, die ich sein wollte.
Wann fiel die Entscheidung, sich von Ihrem Vermögen zu trennen?
Ich habe mich ab 2018 intensiv mit gesellschaftlicher Ungleichheit beschäftigt. In Deutschland besitzen wenige Tausend Familien ein Fünftel des Gesamtvermögens, während die Hälfte der Bevölkerung praktisch nichts hat. Ein Fünftel lebt sogar in Armut oder ist armutsgefährdet. Das fühlte sich für mich falsch an – auch deshalb, weil ich als sehr vermögender Mensch Teil dieser Schieflage war. Ich konnte meinen Reichtum nicht genießen, wenn ich draußen Menschen sah, die Flaschen sammelten – viele davon mit einem Leben voller Arbeit hinter sich.
Sie haben 90 Prozent Ihres Vermögens abgegeben. Wie reagierte Ihr Umfeld?
Überraschend positiv. Viele sagten mir zwar, sie hätten es anders gemacht, vielleicht mehr behalten – aber fast alle konnten den Schritt nachvollziehen. Bei meinem Buchprojekt fragte ich viele: "Was würdest du tun, wenn du eine Million hättest?" – die häufigste Antwort war: spenden oder teilen.

Sebastian Klein ist Psychologe, Unternehmer und Autor. Sein aktuelles Buch "Toxisch reich: Warum extremer Reichtum unsere Demokratie gefährdet" befasst sich mit den Superreichen und ihrer Rolle in der Gesellschaft.
Wie viel haben Sie konkret behalten und was mit dem Rest gemacht?
Ich habe rund eine halbe Million Euro behalten – allerdings nicht als Rücklage, sondern um sie weiter in Unternehmen zu investieren, mit denen ich aktiv arbeite. Den Großteil habe ich in eine gemeinnützige GmbH überführt, in der ich auch aktiv mitgestalte – etwa beim Media Forward Fund, der journalistische Medienprojekte fördert.
Warum war es Ihnen wichtig, Einfluss auf die Mittelverwendung zu behalten?
Es ist ein Widerspruch, den ich anerkenne: Einerseits kritisiere ich, dass Vermögende darüber entscheiden, was "gut für die Gesellschaft" ist. Andererseits will ich als Unternehmer natürlich gestalten. In der GmbH entscheide ich aber nicht allein, wir arbeiten im Team, mit Jury-Verfahren – das ist demokratischer.
Warum gerade Medienförderung?
Weil Demokratie ohne unabhängigen Journalismus nicht funktioniert. Der Einfluss von Social Media, Propaganda und Desinformation ist enorm. Medien haben heute oft nicht die Mittel, um dagegenzuhalten. Unser Ziel ist, journalistische Start-ups zu fördern – auch als Antwort auf die Demokratiekrise.
Sie sagen, Geld sei toxisch für die Demokratie. Wie meinen Sie das?
Geld an sich ist neutral. Aber extremer Reichtum konzentriert Macht. Wenn Einzelpersonen wie Elon Musk oder Donald Trump unermesslich reich sind, gefährdet das die demokratischen Strukturen. Auch in Deutschland besitzen wenige sehr viel und haben entsprechend mehr politischen Einfluss – sei es durch Lobbyarbeit oder Medienbeteiligungen.
Was würden Sie ändern?
Zuerst braucht es ein gesellschaftliches Bewusstsein, dass diese Ungleichheit ein Problem ist. Politisch wären Maßnahmen wie eine gerechte Erbschaftssteuer, Wiedereinführung der Vermögenssteuer und ein ausgewogenes Steuersystem nötig. Arbeit wird heute stark besteuert, Kapital kaum – das muss sich ändern.
Bereuen Sie manchmal Ihre Entscheidung, sich von den Millionen getrennt zu haben?
Manchmal denke ich: "Hätte ich mir ein Haus kaufen sollen?" Aber im Endeffekt: Nein. Ich möchte später nicht dasitzen und sagen: Ich habe Vermögen gehortet, während die Gesellschaft zerbricht. Mein Ziel ist, jetzt etwas beizutragen.
Wenn Sie erneut reich würden – würden Sie es wieder tun?
Ja. Ich würde wieder den Großteil abgeben, einen kleineren Teil behalten. Wie und wo ich das Geld einsetze, hängt dann von den Gegebenheiten ab. Aber klar ist: Meine Firmen sind heute in Verantwortungseigentum – sie können mich nicht mehr reich machen.
Was möchten Sie den Lesern Ihres Buches "Toxisch reich" mit auf den Weg geben?
Dass Ungleichheit ein zentrales Problem ist. Und dass Steuergesetze kein trockenes Thema sind, sondern eines der stärksten Mittel, die wir als Demokratie haben, um unsere Gesellschaft zu gestalten. Darüber sollten nicht nur Lobbyisten entscheiden – sondern wir alle.
- Gespräch mit Sebastian Klein