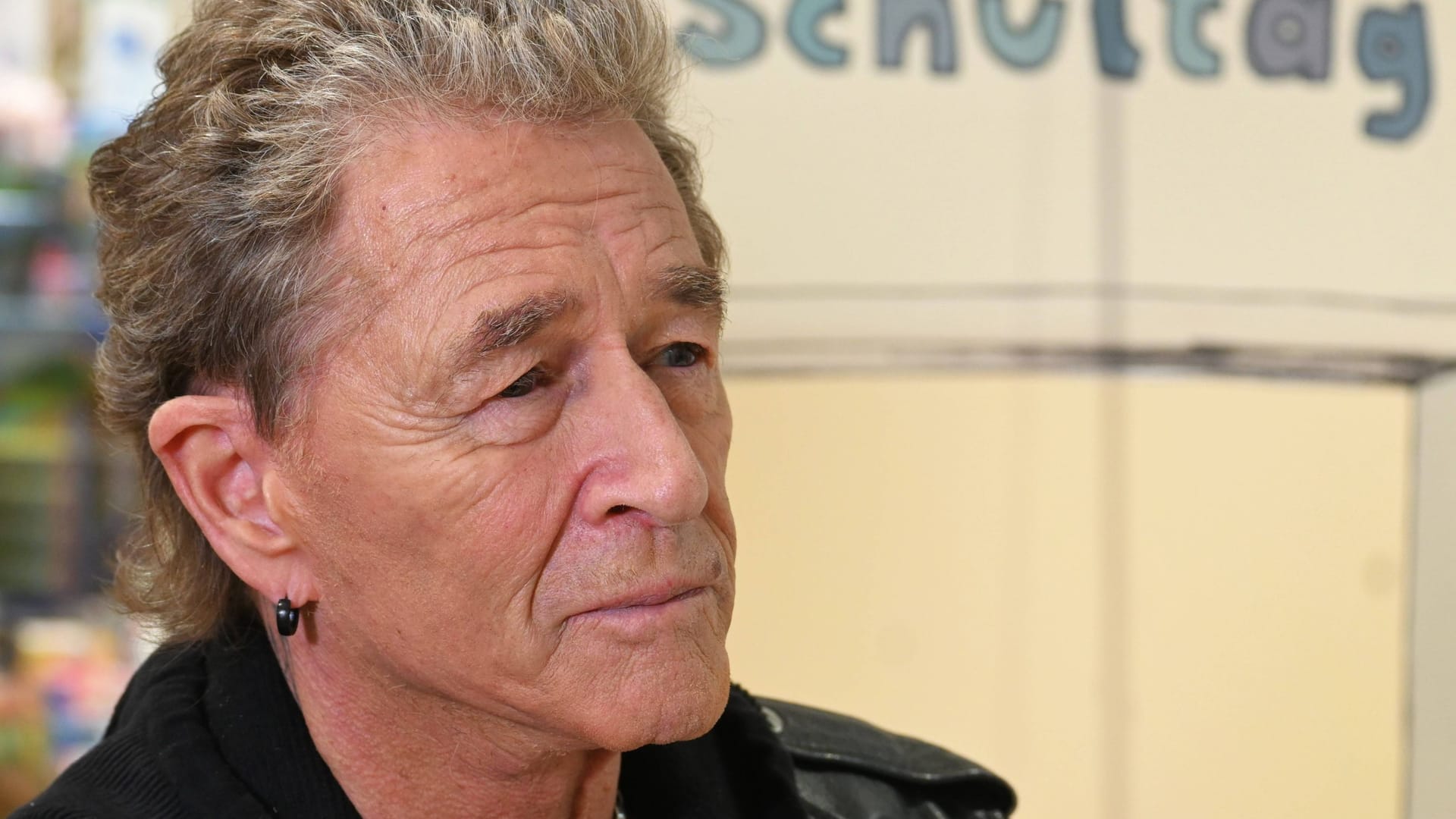Mehr als 150 Journalistinnen und Journalisten berichten rund um die Uhr für Sie über das Geschehen in Deutschland und der Welt.
Zum journalistischen Leitbild von t-online.Aufregung um Kevin Kühnert Sich selbst aufs Kreuz legen


Kevin Kühnert wünscht sich einen demokratischen Sozialismus. Politische Gegner sind empört – und erreichen so das Gegenteil von dem, was sie wollen. Mal wieder.
Der Juso-Chef Kevin Kühnert hat in einem Interview mit der "Zeit" über seine Vorstellung eines demokratischen Sozialismus gesprochen. Er hat darin nichts direkt gefordert, aber er hat auf Nachfragen erklärt, dass er die Kollektivierung von Unternehmen wie BMW richtig fände. Dabei hätte es bleiben können, aber natürlich blieb es nicht dabei.
Die Reaktionen folgten schnell und sie folgten alten Reflexen: Verkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU erkannte das "verschrobene Retro-Weltbild eines verirrten Fantasten". Der CDU-Parteivize Thomas Strobl sagte: "30 Jahre nach dem Niedergang der DDR wollen die Linken wieder den demokratischen Sozialismus". Die neue FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg sagte, die FDP werde "die Soziale Marktwirtschaft gegen solche sozialistischen Auswüchse verteidigen."
Wie man die Agenda bestimmt
Kühnert begann am späten Abend damit, auf Twitter auf Kritik zu reagieren, und, liest man seine Antworten und auch das ruhige unpolemische Interview, gewinnt man den Eindruck, dass er es vielleicht gar nicht auf diese Reaktionen angelegt hat.
Das kann man glauben oder nicht, man kann es naiv finden und man kann die Vorschläge ablehnen oder ihnen zustimmen: So oder so darf man jetzt schon prognostizieren, dass dieses Kühnert-Interview mehr politische Wirkung entfalten wird als viele SPD-Positionspapiere. Die Aufregung um den Juso-Chef macht Mechanismen der politischen Öffentlichkeit sichtbar. Sie zeigt einmal mehr, wie man es schafft, die Agenda zu bestimmen. Absichtlich oder unabsichtlich.
Je weniger konsensfähig, desto wuchtiger
Wahrscheinlich schon vorher, ganz sicher unter Angela Merkel und der schwarz-roten Mitte-Mehrheit ist das konsensfähige Gemäßigte als Standardform der Politik vorherrschend geworden. Merkel fabuliert und poltert nicht. Die SPD ihrerseits versucht seit Jahren, die Menschen mit demonstrativ vernünftigem Pragmatismus zu begeistern, der Einwände schon vorwegnimmt, die eigenen Forderungen präventiv abmildert und so versucht, für eine große Masse zustimmungsfähig zu sein.
Und doch sind es paradoxerweise gerade die radikalen, die kompromissloseren Forderungen, die besonderes Aufsehen erregen. Als Faustformel gilt: Je weniger konsensfähig eine Forderung im ersten Moment ist, desto mehr Wucht entwickelt sie.
Denn in diesem Sinne radikale Forderungen rufen Ablehnung, Empörung und Häme hervor, darauf folgen wieder Reaktionen, darüber kann man berichten. Für Medien ist es leicht, das Thema immer wieder neu aufzugreifen. Für Politiker ist es leicht, die eigenen Anhänger mit Witzen über und Kritik am Gegner zu begeistern.
Doch in der Folge bleiben genau diese Themen in der Öffentlichkeit. Auch wer sagt, dass man nicht "Enteignung" sagen solle, sagt "Enteignung". Die Gegner einer Forderung reagieren zuverlässig wie ein Judoka, der den Schwung des Gegners nutzt, aber sich selbst aufs Kreuz legt.
Rückkehr der Enteignung
Diese Form des Polit-Judos machten sich in der jüngeren Vergangenheit vor allem extreme Rechte zunutze. Im Kern ist das die Methode AfD und es ist auch die Methode Trump: radikal sein, Gegenwehr provozieren, und so erst die Grenzen des Sagbaren und damit nach und nach die Grenzen des Denkbaren zu verschieben. In den vergangenen Wochen scheint sich das zu ändern. Diskursverschiebung, zeigt sich jetzt, kann nicht nur die extreme Rechte.
Enteignungen sind vielleicht das markanteste Beispiel. Einige wenige Aktivisten in Berlin fordern in einem Volksbegehren die Vergesellschaftung des Wohnungskonzerns "Deutsche Wohnen". Diese Forderung findet zwar Unterstützung von Tausenden Berlinern und der Linken, aber es ist trotzdem völlig klar, dass sie nicht umgesetzt werden wird. Dabei könnte es bleiben. Aber dabei blieb es nicht.
Weil man plötzlich über Enteignungen sprach, wurde Grünen-Chef Robert Habeck gefragt, was er davon halte, und weil er Enteignungen nicht grundsätzlich ablehnte, war nun Thema, dass auch die Grünen Enteignungen forderten. Die Idee der Enteignung ist nach Deutschland zurückgekehrt wie der Biber oder der Wolf.
Dürfen die das?
Ähnlich funktioniert es mit Greta Thunberg und der "Fridays for Future"-Bewegung; die sind zwar in ihrer Herleitung alles andere als radikal. Sie berufen sich in ihren Protesten für effektiven Klimaschutz auf den wissenschaftlichen Konsens und auf das Pariser Klimaabkommen, auf das sich fast 200 Staaten geeinigt haben. Aber ihre Forderungen sind doch radikal, weil sie die Normalität infrage stellen. Um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, muss sich alles ändern: Verkehr, Wohnen, Ernährung, Städtebau, die Wirtschaft.
Vor allem aber ist die Form des Protests auf eine provokante Art radikal: In den ersten Wochen, nachdem die Bewegung in Deutschland gestartet war, rieben sich Konservative und Liberale vor allem daran, dass die Schüler freitags die Schule schwänzen. Während Gegner empört forderten, die Schüler sollten besser am Wochenende demonstrieren, sprach das Land erst über "Fridays for Future" und dann plötzlich mehr über Klimaschutz.
- Debatte um Enteignungen: Lenin kommt nicht wieder
- Pressestimmen: "Kühnert liegt im Schützengraben"
- Demokratischer Sozialismus: SPD-Führung distanziert sich
- Kevin Kühnert im Interview: Da kommen Kämpfe auf uns zu
Für Politiker folgt daraus: Wer Wirkung erzielen will, könnte gezwungen sein, den Korridor des Grundvernünftigen oder zumindest des Konsensfähigen ab und an zu verlassen.
Wer dagegen Forderungen des Gegners wirklich für abwegig hält, könnte gut beraten sein, reflexhafte Empörung zu unterdrücken. Andernfalls legt man sich allzu leicht selbst aufs Kreuz.