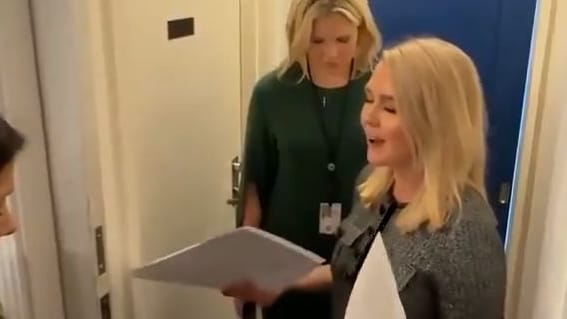Der Gesprächspartner muss auf jede unserer Fragen antworten. Anschließend bekommt er seine Antworten vorgelegt und kann sie autorisieren.
Zum journalistischen Leitbild von t-online.Welt im Umbruch "Dieser Preis war zu hoch"


Die Weltordnung befindet sich im Umbruch. Historiker Jürgen Kocka erklärt, wie sich die Bundesrepublik von der Republik von Weimar unterscheidet und wie bedrohlich die Vorgänge in den USA sind.
Deutschland wählt einen neuen Bundestag – und das unter dramatischen Vorzeichen. Die USA unter Donald Trump drohen ein unsicherer Partner zu werden, Russland könnte im Angriffskrieg gegen die Ukraine erfolgreich sein, und in Deutschland selbst erstarkt die AfD. Auch wegen letzterer Entwicklung erklingt immer wieder die Warnung vor "Weimarer Zuständen".
Wie viel "Weimar" erleben wir aber gerade in unserer Gegenwart? Welche Aufgaben müsste die kommende Bundesregierung dringend in Angriff nehmen? Und welche fundamentalen Auswirkungen hat die gegenwärtige Allianz zwischen Donald Trump und Elon Musk? Diese Fragen beantwortet der Historiker Jürgen Kocka im Gespräch.
t-online: Professor Kocka, Krise auf Krise erschüttert unsere Gegenwart, immer wieder wird vor dem "Gespenst von Weimar" gewarnt. Erleben wir gerade tatsächlich "Weimarer Verhältnisse"?
Jürgen Kocka: Nein. Heutzutage ist der größte Teil der Eliten für das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und das liberale demokratische System, für das es steht. In der Weimarer Republik standen dagegen viele Unternehmer, Kapitalisten und Grundbesitzer, Parteipolitiker und hohe Beamte, Bildungsbürger und Intellektuelle wie auch die Spitzen der Armee in skeptischer Distanz zu Republik und Demokratie. Wir haben heute einen starken systemstabilisierenden Liberalkonservatismus rechts von der Mitte, der damals fehlte. Ein entscheidender Unterschied zu "Weimarer Verhältnissen"!
Damals ging die Angst vor dem Kommunismus um, heute fordert Russland unter Wladimir Putin die liberale Weltordnung heraus, in den USA schleift Donald Trump die Demokratie. Haben wir es nun mit einer Art rechten autoritären Herausforderung zu tun?
Dies ist ein zweiter wichtiger Unterschied zwischen Weimar und heute. Damals fand der Aufstieg des Rechtsextremismus unter dem Einfluss intensivster Klassenspannungen zwischen Proletariat und Bürgertum statt. Die Demokratiefeindschaft der in Deutschland starken kommunistischen Bewegung hat die Verbreitung des antikommunistischen Nationalsozialismus erheblich gefördert. Die Angst vor der radikalen Linken im Land hat viele Deutsche damals nach rechts rücken lassen. Dies spielt heute kaum eine Rolle. Andererseits ist das heutige Russland ähnlich freiheits- und demokratiefeindlich wie die damalige Sowjetunion, aber ungleich mächtiger als diese. Und die USA entwickeln sich unter Trump gerade zu einem autoritären System, das unsere liberaldemokratische Ordnung infrage stellt, die EU zu schädigen versucht und der rechtsextremen Opposition publikumswirksam den Rücken stärkt. Die liberaldemokratische Substanz der Bundesrepublik muss heute viel stärker gegen außenpolitische Herausforderungen verteidigt werden als damals die Demokratie von Weimar. Wir sind darauf schlecht vorbereitet.
Zur Person
Jürgen Kocka, Jahrgang 1941, gehört zu den renommiertesten deutschen Sozialhistorikern und ist unter anderem Träger des Leibniz-Preises. Kocka ist Mitbegründer der "Bielefelder Schule", die die Historische Sozialforschung innerhalb der deutschen Geschichtswissenschaft etabliert hat. Bis zu Kockas Ruhestand 2009 hatte er die Professur für Geschichte der Industriellen Welt an der Freien Universität Berlin inne, zudem war der Historiker lange Jahre Präsident des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB). 2021 erschien sein Buch "Kampf um die Moderne. Das lange 19. Jahrhundert in Deutschland".
Erleben wir gerade eine Renaissance des Faschismus, wie manche Stimmen warnen?
Jedenfalls erinnert der gegenwärtige Aufstieg des Rechtsextremismus an den Aufstieg des Rechtsextremismus in den 1920er-Jahren. Rechtsextrem sind Ideen, Bewegungen und Aktionen, die sich gegen die Prinzipien der liberalen Demokratie richten, gegen universale Menschenrechte und internationale Solidarität, gegen Rechtsstaatlichkeit und die Legitimität von Vielfalt; die anders als der herkömmliche Konservatismus auf populistische, oft völkische und fast immer nationalistische Weise die Massen ansprechen, zugleich aber anti-elitär und anti-traditional auftreten. Wenn sie erfolgreich sind, führen sie zu autoritären und diktatorischen Politikformen, oder doch zu Mischformen, die nur noch halbdemokratisch sind.
So in den USA?
Am Trumpismus in den USA und an der AfD in Deutschland lässt sich das zeigen, auch am gegenwärtigen Aufstieg des Rechtsextremismus in vielen anderen Ländern, trotz vieler Unterschiede im Einzelnen. Dabei ähneln sich die rechtsextremistischen Bewegungen der 1920er- und der 2020er-Jahre, auch weil sie gewisse Ursachen gemeinsam haben.

Embed
Welche?
Im Ersten Weltkrieg, in der Revolution 1918–1920 und mit der Gründung der Weimarer Republik fanden in Deutschland rasche und erfolgreiche Schübe tiefgreifender Demokratisierung statt. Der Aufstieg rechtsextremer, populistischer Bewegungen und vor allem des Nationalsozialismus in den 1920er- und 1930er-Jahren war auch ein Protest dagegen, eine Reaktion auf den Wandel, auf die Herausforderungen und Zumutungen, die für viele mit diesen Demokratisierungsschüben verbunden gewesen waren.
Heute ist die Demokratie in Deutschland durch Jahrzehnte währende Praxis eingeübt.
Die Bundesrepublik hat wie andere Länder der westlichen Welt seit der Mitte des 20. Jahrhunderts viele Jahrzehnte der Demokratisierung und Liberalisierung wie auch der Pluralisierung und Transnationalisierung hinter sich. Damit waren tiefgreifende Veränderungen des politischen Lebens, der Arbeitsverhältnisse, der Beziehungen zwischen den Geschlechtern und Generationen, des Alltagslebens, der Kultur und der Sprache verbunden. Dazu gehörten die Globalisierung und mit ihr die massenhaften Migrationen. Und wir sind mit dem Menschheitsproblem der Umwelt- und Klimakrise konfrontiert, auf das sich Politik und Gesellschaft in verschiedenen Ländern unterschiedlich einzustellen versuchen. Damit waren und sind einerseits große Chancen, neue Angebote und zu Recht gefeierte Fortschritte, andererseits aber auch tiefe Infragestellungen, Zumutungen und Überforderungen verbunden. Gewinn und Verlust waren und sind zwischen sozialen Gruppen, kulturellen Milieus und Regionen sehr ungleich verteilt.
Ist das ein Nährboden für den Rechtsextremismus?
Soweit daraus Enttäuschung, Ressentiment und Widerständigkeit folgten, war und ist dies der Boden, auf dem rechtsextreme Bewegungen florieren, hierzulande besonders seit dem zweiten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts. Der Rechtsextremismus war und ist Reaktion. Er nährte und nährt sich, im frühen 20. wie im frühen 21. Jahrhundert, von verbreiteter Resistenz gegen nicht akzeptierte Zumutungen der Modernisierung. Von diesen Zumutungen waren und sind viele nicht oder nur unter zu hohen Kosten zu vermeiden. Andere aber waren und sind vermeidbar, und zwar durch Augenmaß, Rücksicht und kluge Politik. An der Politik gegenüber Zuwanderung lässt sich das zeigen: Im Kern ist diese notwendig und ein Gewinn, aufgrund demografischer Zwänge und humanitärer Verpflichtungen, durch die wir uns definieren; andererseits begründet sie seit 2015 eine Überlast aufgrund mangelnden Sinns für Maß und Grenzen.
Was tun?
Daran muss – und kann – ansetzen, wer Rechtsextremismus bekämpfen will: durch entschiedene Verteidigung des Kerns liberaldemokratischer Politik einerseits, aber auch durch Verzicht auf vermeidbare Überforderung Andersdenkender und Respekt für diese. In anderen Politikbereichen war und ist es ähnlich. Im Übrigen unterscheiden sich aber die historischen Ausgangslagen für die Entwicklung des Rechtsextremismus vor hundert Jahren und heute sehr.
Diese Ausgangslage bestand zu großen Teilen aus der Niederlage Deutschlands im Ersten Weltkrieg und dem als Demütigung empfundenen Versailler Vertrag.
Ja. Die Republik von Weimar wurde aus der demütigenden Niederlage im Ersten Weltkrieg geboren, das war eine schwere Hypothek. Es blieb wenig Zeit, sich an sie zu gewöhnen. Heute blickt die Bundesrepublik Deutschland auf eine Demokratiegeschichte von mehr als 75 Jahren zurück, der Großteil aller derzeit Lebenden ist in der Demokratie geboren und aufgewachsen. Und die Niederlage im Zweiten Weltkrieg wird auch – und meistens – als Ende einer selbst verschuldeten Katastrophe und als Befreiung erinnert. Solche Unterschiede fallen ins Gewicht.
Zudem wurde die Republik von Weimar von ihren Feinden von rechter und linker Seite zerrieben. Wie wichtig war das für ihr Scheitern?
Das spielte eine enorme Rolle. In Weimar waren Kommunisten und Nationalsozialisten zwar stark verfeindet, einig aber waren sie im Hass auf die liberale Demokratie. An ihrem Ende wurde die Demokratie in der Weimarer Republik dann von rechts wie von links in die Zange genommen, nachdem die Parteien der Mitte immer seltener zu den nötigen Kompromissen fanden, beispielsweise in der Sozialpolitik.
Darin liegt einer der Gründe für das spätere Ende Weimars. Sollte uns das in der Gegenwart nicht Lehre sein?
Unbedingt! Die Zerrissenheit der Demokraten damals und ihre Unfähigkeit zum Kompromiss wurden von den Systemfeinden genüsslich beobachtet. Die Bundesrepublik unterscheidet sich auch in dieser Hinsicht sehr von Weimar. Dass unsere Parteien lange sehr viel konsensfähiger waren, hängt allerdings auch damit zusammen, dass sie es nicht mit ähnlich harten Krisen zu tun hatten wie ihre Vorgängerinnen in der Weimarer Republik, die durch wirtschaftliche Einbrüche und bedrückende Kriegsfolgen viel ärger gebeutelt wurden als wir in den letzten Jahrzehnten.
Bleiben wir beim Thema Konsens. Bei Abstimmungen zur Migration hat Friedrich Merz von der Union kürzlich Stimmen der AfD in Kauf genommen, CSU-Chef Markus Söder schießt aus Bayern heraus gegen die Grünen, die nach der Bundestagswahl einen potenziellen Koalitionspartner darstellen könnten.
Das Land braucht mehr Steuerung und auch eine Begrenzung der Einwanderung, die notwendige Integration wird verhindert, wenn die Zahl der ankommenden Flüchtlinge und sonstigen Zuwanderer außer Kontrolle gerät. Von daher habe ich ein gewisses Verständnis, dass sich Friedrich Merz als Wahlkämpfer diesbezüglich so eindeutig positionierte. Aber die Kosten seines Vorpreschens waren hoch, insbesondere europapolitisch. Indem er ohne Absprache mit und Rücksicht auf Nachbarländer für harte und dauerhafte Kontrollen an den deutschen Grenzen eintrat, nahm er nicht nur die Auflösung des Schengenraums in Kauf. Er versetzte auch dem sehr gefährdeten Zusammenhalt der Europäischen Union einen weiteren Schlag. Und dies in einer Zeit, da angesichts der tektonischen Erschütterungen unserer Bündnissysteme alles auf eine weitere Einigung Europas ankommt. Dieser Preis war zu hoch.
Wie schwierig wird die demokratische Konsensfindung im neu gewählten Bundestag werden?
Die Konsensfindung ist schwieriger geworden als früher. Die Zahl der Parteien hat nicht nur zugenommen, die Parteien sind auch kleiner geworden. Ihre Bindungskraft hat nachgelassen, auch deshalb grenzen sie sich härter voneinander ab. Erschwert wird die Kompromissfindung auch durch das große Interesse der Medien an Konflikt und Kritik. Viele Medien wirken wie mächtige Schwungräder, die existierende Spannungen und Konflikte in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit rücken und damit verstärken. Dazu kommt der Strukturwandel der Öffentlichkeit durch die Digitalisierung. Die sogenannten sozialen Medien haben bekanntlich eher zu einer Zersplitterung statt zu einer Pluralisierung geführt. Dass die Kompromissfähigkeit auch in der Bundesrepublik abgenommen hat, wurde von der Ampelkoalition schmerzhaft vorgeführt.
Donald Trump und Wladimir Putin wollen über die Ukraine und ihr Schicksal bestimmen, zugleich erodiert das transatlantische Bündnis gewaltig. Haben Sie einen Ratschlag?
Beiden ist die EU ein Dorn im Auge, ganz im Gegenteil zu uns Deutschen, die ein sehr großes Interesse an ihrer Existenz haben und haben sollten. Da kann die AfD noch so viel kritisieren, die Zusammenarbeit auf europäischer Ebene durch die EU ist ein riesiger Fortschritt gegenüber den letzten Jahrhunderten in Europa, diesem traditionell so kriegerischen Kontinent. Die Bundesrepublik sollte alles vermeiden, was die Schwächung dieser EU weiter vorantreibt. Im Gegenteil, sie sollte versuchen, die politische Einigungsfähigkeit der Länder in der EU voranzutreiben. In der jetzigen Lage müssen vor allem die Mittel in die Hand genommen werden, um die militärischen Fähigkeiten zu stärken. Rasche Nachrüstung ist das dringende Gebot der Stunde. Das wird sich nicht ohne Kreditaufnahme in großem Stil machen lassen – die Schuldenbremse wird mindestens stark modifiziert werden müssen.
Wird sich die notwendige Mehrheit dafür finden lassen?
Die Verteidigung der EU gegenüber den Angriffen der beiden Großmächte geht Hand in Hand mit der Verteidigung unserer Idee von Demokratie und Freiheit. Putin verachtet das, zugleich haben wir es mit der neuen Willkür in Form des Autoritarismus von Trump zu tun. Bisher bleibt der inneramerikanische Widerstand dagegen schwach, das System der "checks and balances" greift zur Zeit nicht. Als Historiker arbeite ich viel über die Geschichte des Kapitalismus: Die Rolle von Musk und die Anbiederung der anderen großen Techunternehmer an Trump in den USA ist ein Beispiel für den großen Opportunismus, der dem Kapitalismus eigen ist.
Worauf wollen Sie hinaus?
Kapitalismus kann unter ganz unterschiedlichen politischen Bedingungen funktionieren und florieren. Er passt sich an, entscheidend ist, was ihm politisch erlaubt und vorgegeben wird. Deswegen haben wir einen anderen Kapitalismus in der Bundesrepublik und den skandinavischen Ländern, die demokratisch sind und (auch) sozialdemokratisch geprägt wurden, als im chinesischen Reich und dessen Staatskapitalismus mit autoritären und diktatorischen Elementen. Im marktradikalen Kapitalismus der USA wird derzeit vorgeführt, was passieren kann, wenn die Logik des Kapitalismus durch Politik und Kultur nicht auf den Bereich der Ökonomie beschränkt wird, sondern in die Bereiche Politik und Kultur eindringt und sie bestimmt.
Personifiziert wird diese Entwicklung durch Trump und Musk.
Trump und Musk sprengen derzeit die immer prekäre Grenze zwischen den Bereichen. Musk als führender Kapitalist und vielleicht reichster Mann der Welt wird gegen die Logik demokratischer Politik zum mächtigen politischen Akteur, während der Präsident seinen Instinkten als kapitalistischer Immobilienunternehmer folgt statt den Grundsätzen liberaldemokratischer Politik. Die Folgen sind derzeit unabsehbar.
Nicht zuletzt die SPD wollte in diesem Wahlkampf mit sozialen Themen punkten, bis die Migration beherrschend wurde. Wie steht es um den deutschen Sozialstaat, den manche von linker politischer Seite wie auch von den Wohlfahrtsverbänden immer wieder bedroht sehen?
Ein sozialer Kahlschlag hat in der Bundesrepublik nie stattgefunden. Ich habe mir die Zahlen angesehen: Wenn man die Ausgaben für soziale Sicherung einschließlich Renten, Gesundheit, Wohnen, Bildung zusammenfasst, dann sind 1950 19 Prozent des Bruttosozialprodukts dafür ausgegeben worden, 1970 waren es 25 Prozent, zwischen 1990 und 2010 gab es eine Steigerung von 27 Prozent auf 33 Prozent. In den letzten Jahren ist diese Steigerung weitergegangen. In den Neunzigerjahren und zu Beginn des neuen Jahrhunderts, also in der Phase, die wir als Hochzeit des Neoliberalismus sehen, haben wir faktisch einen Ausbau des Sozialstaats erlebt! Wir machen den Sozialstaat also manchmal schlechter, als er ist. Wir haben einen sehr leistungskräftigen Sozialstaat, trotz der von ihm nicht beseitigten Armutsgefährdung.
Nun werden in diesen unsicheren Zeiten und der notwendigen Nachrüstung der Bundeswehr erste Verteilungskämpfe skizziert. "Wir können der Ukraine nichts geben, was wir unseren Rentnern wegnehmen müssten", äußerte sich mit Matthias Miersch der Generalsekretär der SPD. Ist so eine Frontstellung zwischen Sicherheits- und Sozialpolitik sinnvoll.
Wir sollten nicht vergessen, wie wichtig der Sozialstaat für das innere Gefüge und die Demokratie Deutschlands ist. Er beugt einer Verelendung der Ärmsten vor und schwächt die Einkommensungleichheit ab. Der Sozialstaat hilft uns auch, die Gegensätze, die wir haben, insbesondere zwischen Kapital und Arbeit, zivilisiert auszutragen. Damit legitimiert sich nicht zuletzt die Demokratie. Nun müssen wir aber aufpassen: Der Sozialstaat hat bei uns ein Stadium erreicht, auf dem er die Wettbewerbsfähigkeit und die Leistungsfähigkeit des ökonomischen Systems zu schwächen beginnt, etwa durch die Reduzierung von Anreizen zur Arbeit, durch die Erhöhung der Produktionskosten, die von Investitionen abhält und zur Abwanderung von Unternehmen beiträgt, durch die selbst generierte Forderung nach immer mehr Leistungen und immer dichterer Regulierung. Aber der Sozialstaat braucht andererseits eine Hochleistungswirtschaft, um all die Erwartungen zu erfüllen, mit denen er konfrontiert ist und die in den letzten Jahrzehnten ungeheuer gewachsen sind. Er ist also dabei, seine eigenen Voraussetzungen zu beschädigen und infrage zu stellen.
Deutschland gilt mit seiner Wirtschaft erneut als der "kranke Mann Europas".
Wir sollten unsere Wirtschaft nicht schlechter machen, als sie ist. Aber wir brauchen einen Sozialstaat mit Augenmaß. Mit mehr Augenmaß als in den letzten Jahren.
Professor Kocka, vielen Dank für das Gespräch.
- Persönliches Gespräch mit Jürgen Kocka via Videokonferenz