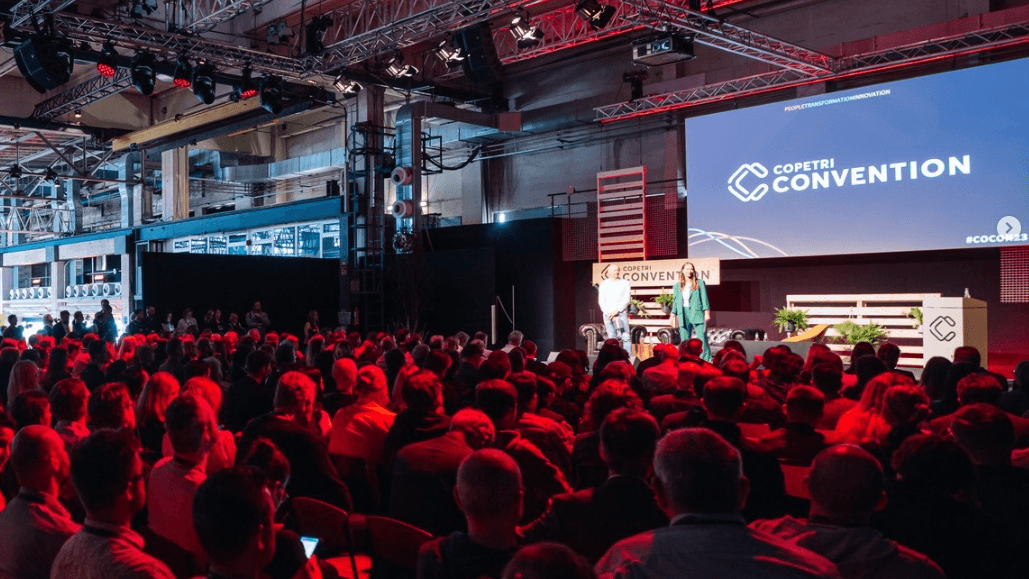Euro-Rettungsschirm endet Ex-Finanzminister Varoufakis: Griechenland ist nicht gerettet


Griechenland verlässt den Euro-Rettungsschirm. Eigentlich eine gute Nachricht. Doch viele Wirtschaftsforscher sind skeptisch. Sie erwarten neue Probleme – nicht nur in Griechenland.
Nach acht Jahren am Tropf der internationalen Geldgeber verlässt Griechenland an diesem Montag den Euro-Rettungsschirm und kehrt an die Finanzmärkte zurück. Aus Sicht seines ehemaligen Finanzministers Gianis Varoufakis ist das Land auch nach dem Auslaufen des dritten Rettungspakets noch nicht gerettet. "Griechenland steht am selben Punkt, im gleichen schwarzen Loch und es versinkt jeden Tag tiefer darin. Auch, weil die Sparvorgaben der Gläubiger Investitionen und den Konsum behindern", sagte Varoufakis der "Bild"-Zeitung.
Varoufakis war im Juli 2015 nach rund einem halben Jahr im Amt zurückgetreten, um Verhandlungen mit den Gläubigern zu erleichtern. Zuvor hatten die Griechen in einem Referendum die Sparvorgaben der internationalen Geldgeber abgelehnt.
Die Staatsschulden seien Varoufakis zufolge nicht weniger, sondern mehr geworden: "Wir haben jetzt nur mehr Zeit, um noch mehr Schulden zurückzuzahlen", sagte der Ex-Finanzminister. Der Staat sei aber noch immer pleite, die privaten Leute seien ärmer geworden, Firmen gingen noch immer bankrott und das Bruttosozialprodukt sei um 25 Prozent gesunken.
"Auf irgendeine Weise wird es explodieren"
Auch andere Experten sehen keinen Anlass für Erleichterung: "Die Griechenland-Krise ist nicht beigelegt, sie ist nur auf später vertagt worden", sagt der Wirtschaftsprofessor Charles Wyplosz. Und nicht nur Griechenland bleibt ein Sorgenkind: Auch andere Euro-Staaten beunruhigen die Experten. Allen voran Italien.
Griechenland ist durch die Euro-Partner und den Internationalen Währungsfonds (IWF) seit 2010 vor dem Staatsbankrott gerettet worden. Die Gläubiger gewährten dem Mittelmeerstaat insgesamt Kredite in Höhe von insgesamt fast 274 Milliarden Euro. Im Gegenzug musste Athen hunderte und vielfach schmerzhafte Reformen umsetzen.
Der Schuldenberg bleibt riesig
Zwar ist das Land inzwischen wieder auf Wachstumskurs und weist Haushaltsüberschüsse aus. Aber es sitzt auf einem riesigen Schuldenberg in Höhe von etwa 180 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP). Erst ab 2032 muss Athen mit der Tilgung der Schulden beginnen. Völlig unklar ist, wohin sich das Land bis dahin politisch und wirtschaftlich entwickelt.
- Griechenland-Rettung endet: Euro-Länder einigen sich auf letztes Hilfspaket
- Hilfspakete: Deutschland macht 2,9 Milliarden Euro Zinsgewinne
- Meinung: Griechenland ist noch lange nicht gerettet
"Auf irgendeine Weise wird es explodieren", prophezeit Ökonom Wyplosz, der am Genfer Institut für Internationale und Entwicklungs-Studien forscht. Griechenland werde bereits "deutlich vor 2032 wieder in der Krise stecken". Die EU habe beim Umgang mit der Griechenland-Krise einen "spektakulären Zynismus an den Tag gelegt", kritisiert Wyplosz: Sie habe so getan, als sei das Probem gelöst – nach dem Motto: "Nach mir die Sintflut."
Rettungsfonds-Chef räumt Fehler ein
Dass in der Griechenland-Krise nicht alles richtig gemacht wurde, räumte vor wenigen Tagen sogar der Chef des Euro-Rettungsfonds ESM, Klaus Regling, ein. Für diese schlimmste Krise seit der großen Depression von 1929 habe es schließlich "kein Drehbuch" gegeben, sagte er dem "Spiegel".
Zum Ende des Hilfsprogrammes mahnte Regling Griechenland. "Wir sind ein sehr geduldiger Gläubiger, aber wir wollen schon unser Geld zurück haben", sagte er der griechischen Zeitung "Ethnos". "Deshalb werden wir die Entwicklung in Griechenland sehr genau verfolgen."
Auch Anne-Laure Delatte, Vizedirektorin des französischen Wirtschaftsforschungsinstitut CEPII, sieht grundsätzliche Probleme: "Wir haben nicht das Problem der öffentlichen Verschuldung gelöst, das in Italien, Griechenland und Portugal trotz deren Anstrengungen weiterhin groß ist." Die EU-Schwergewichte Spanien und Frankreich ächzen ebenfalls unter einer hohen Schuldenlast.
Ihnen gegenüber stehen in der Eurozone diejenigen Länder, die ihre Hausaufgaben in Sachen Staatsverschuldung gemacht haben. Und zwischen diesen beiden Blöcken wachsen die Interessengegensätze: Während die Musterschüler Haushaltsdisziplin verlangen, fordern die hoch verschuldeten Staaten mehr Solidarität.
Italien "eindeutige Bedrohung"
Italien stelle eine "eindeutige Bedrohung" dar, glaubt Ökonom Wyplosz. "Wir haben da ein Land mit Schulden in Höhe von 130 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, ernsthaften inneren Problemen, einem schmutzigen Bankensystem – und jetzt wird es von Leuten gelenkt, die nicht wissen, was sie tun."
Bislang hat die erst seit Juni amtierende italienische Regierung keinen klaren wirtschaftspolitischen Kurs aufgezeigt. Nach dem Einsturz der Autobahnbrücke in Genua am 14. August stellte sie unmissverständlich klar, dass sie die europäischen Stabilitäts- und Schuldenregeln für unvereinbar mit den nötigen Investitionen in die Infrastruktur ansieht. Er wolle "die Sicherheit der Italiener an die erste Stelle stellen", sagte der rechte Innenminister Matteo Salvini.
Schlecht gewappnet für neue Krise?
Philippe Martin von der Pariser Universität Sciences Po sieht die Eurozone schlecht gewappnet für eine drohende neue Krise: Sie verfüge "nicht über angemessene Werkzeuge oder Institutionen, um mit einer ernsten italienischen Schuldenkrise fertig zu werden".
Während der Griechenland-Krise hatte die Währungsunion den Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) geschaffen sowie eine Stärkung der Bankenunion vereinbart. Aber weitergehende Reformen, etwa der von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron geforderte Eurozonen-Haushalt, scheiterten bislang an den gegensätzlichen Interessen der Mitgliedstaaten.
"Ich bin mir nicht sicher, ob es eine Einigung darüber geben wird, was der Euro sein soll", sagt Nathalie Janson von der Neoma-Wirtschaftshochschule im französischen Rouen. Der Euro sei "inzwischen zu einer chaotischen Währung mit ständigen Turbulenzen geworden – obwohl er ursprünglich für Stabilität sorgen sollte".
- AFP, dpa