
Für diesen Beitrag haben wir alle relevanten Fakten sorgfältig recherchiert. Eine Beeinflussung durch Dritte findet nicht statt.
Zum journalistischen Leitbild von t-online.Wundrose nach Hautinfektion Warum ein Erysipel nicht als ansteckend gilt
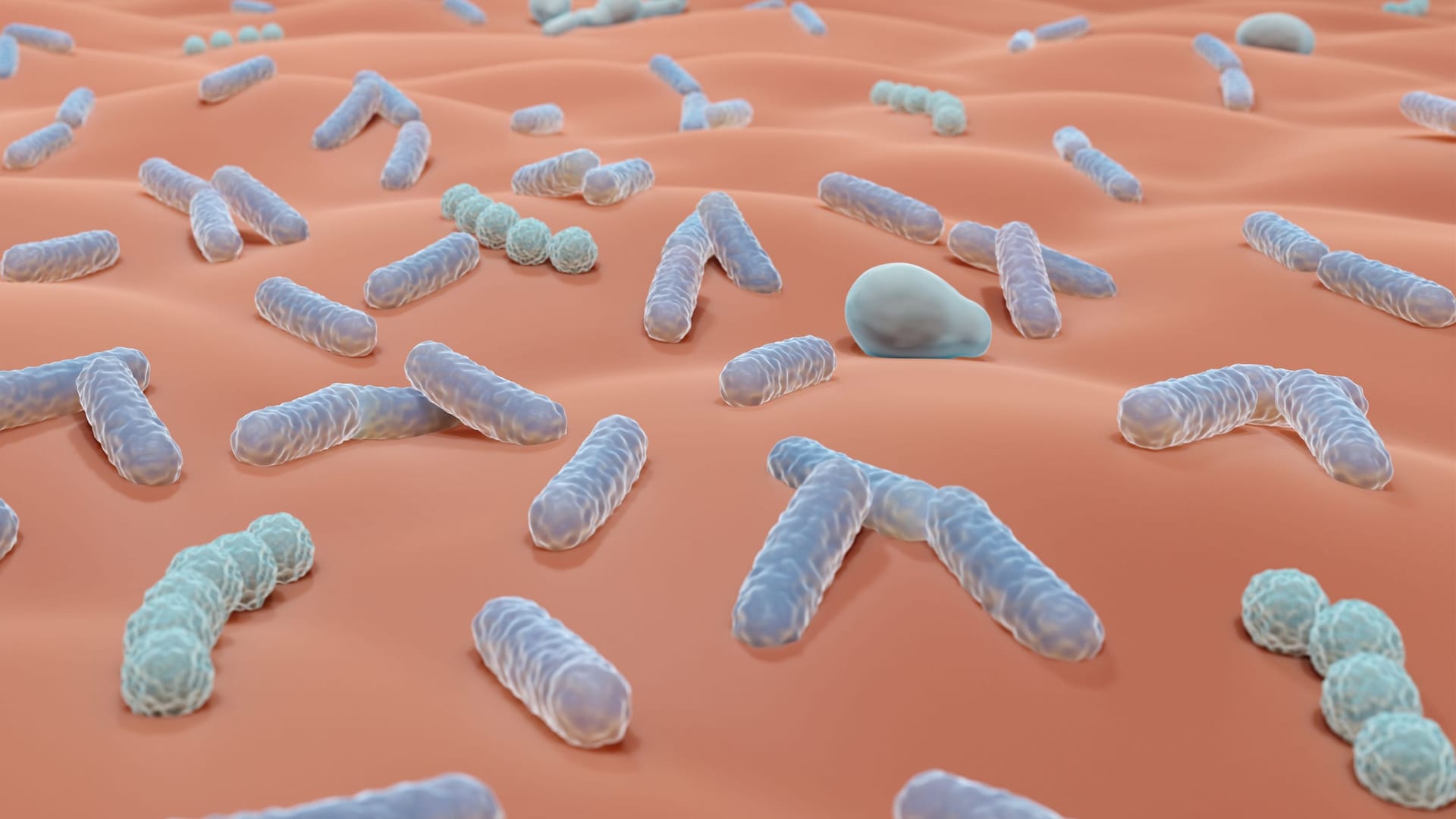

Obwohl seine Erreger übertragbar sind, soll ein Erysipel nicht ansteckend sein. Dennoch besteht mitunter ein erhöhtes Infektionsrisiko. Wie kann das sein?
Ein Erysipel (auch Wundrose genannt) ist eine akute, durch Bakterien ausgelöste Entzündung der Haut. Betroffene benötigen zeitig eine sachgemäße Therapie mit Antibiotika, da die Infektion sonst teils ernste Komplikationen verursachen und immer wiederkehren kann. (Welche Spätfolgen dann drohen, erfahren Sie hier.)
Meist sind Streptokokken die Auslöser. Diese weitverbreiteten Bakterien können neben dem Erysipel weitere Hautinfektionen (wie die ansteckende Borkenflechte) sowie andere Krankheiten (wie Rachen- und Mandelentzündungen oder Scharlach) verursachen. Streptokokken übertragen sich vorwiegend durch direkten oder indirekten Kontakt, mitunter auch über Tröpfchen – etwa beim Husten, Niesen oder Küssen.
Ein Erysipel droht nur unter bestimmten Voraussetzungen
Allerdings wirken Streptokokken nicht grundsätzlich als Krankheitserreger. Bei vielen Menschen leben sie neben unzähligen anderen Bakterien und sonstigen Mikroorganismen auf den Mund- und Nasenschleimhäuten oder auf der Haut, ohne Probleme zu bereiten. Um ein Erysipel hervorrufen zu können, müssen sie erst in die Haut eindringen.
Dazu benötigen die Bakterien bloß einen kleinen Hautschaden als Eintrittspforte – wie etwa Einrisse bei trockener Haut, aufgeweichte Zehenzwischenräume bei Fußpilz, einen wunden Naseneingang bei Schnupfen, einen Insektenstich oder eine Abschürfung durch Kratzen. Dann können sie sich womöglich unter der Hautoberfläche ausbreiten und dort eine Entzündung der Haut und Lymphgefäße auslösen: Es entsteht ein Erysipel.
Für die meisten Menschen ist ein Erysipel nicht ansteckend
Die ursächlichen Bakterien sind zwar von Mensch zu Mensch übertragbar. Doch allein für sich genommen gilt ein Erysipel nicht als ansteckend. Denn sogar wenn seine Erreger nach der Übertragung in die Haut einer anderen Person gelangen, kann deren Immunsystem die Eindringlinge oft erfolgreich bekämpfen, bevor es zu einer Entzündung kommt.
Wer gesund ist und ein gut funktionierendes Immunsystem hat, braucht daher normalerweise auch bei engem Kontakt zu Betroffenen nicht zu befürchten, selbst ein Erysipel zu entwickeln. Das Risiko einer Ansteckung (oder besser allgemeiner: einer Infektion der Haut) besteht hauptsächlich bei Menschen, die wegen einer geschwächten Immunabwehr und/oder einer Grunderkrankung anfälliger dafür sind – wie etwa bei:
- übermäßig viel Körperfett (Adipositas)
- hohem Alkoholkonsum
- unzureichend behandeltem Diabetes mellitus
- Durchblutungsstörungen
- Leberzirrhose
- Lymphödemen
- Neurodermitis (auch atopisches Ekzem genannt)
- Niereninsuffizienz
- Pilzinfektionen der Haut
- Venenschwäche mit Stauungsekzem
Zudem können bestimmte Therapiemaßnahmen die Immunabwehr schwächen und somit das Risiko für ein Erysipel erhöhen. Dazu zählen manche Krebsmedikamente, höher dosiertes Kortison, nach einer Organtransplantation verabreichte Immunsuppressiva sowie Strahlenbehandlungen.
Verschiedene Maßnahmen helfen, einem Erysipel vorzubeugen
Besonders für Menschen mit erhöhtem Infektionsrisiko ist es demnach ratsam, die Haut sorgsam zu pflegen, auf Hygiene zu achten und Risikofaktoren möglichst auszuschalten: Mit diesen Maßnahmen lässt sich einem Erysipel vorbeugen, weil ansteckende Bakterien dann kaum eine Chance haben, in die Haut zu gelangen.
So hilft regelmäßige Hautpflege mit gut verträglichen Cremes oder Lotionen, rissige und trockene Haut zu vermeiden, die eine Hautinfektion erst ermöglichen könnten. Aber Achtung: Wer es dabei übertreibt und etwa aggressive Pflegeprodukte verwendet, kann der Haut eher schaden und somit ein Erysipel begünstigen.
Auch eine angemessene Körperhygiene trägt dazu bei, Hautinfektionen wie ein Erysipel zu verhindern. Ansteckende Keime an den Händen lassen sich etwa durch regelmäßiges und gründliches Händewaschen mit Wasser und Seife deutlich verringern. Und das Tragen von Badepantoletten im Schwimmbad bietet Schutz vor einer Ansteckung mit Fußpilz.
Ebenfalls wichtig ist es, kleine Hautverletzungen immer unter fließendem Wasser zu säubern, bei Bedarf zu desinfizieren und anschließend am besten abzudecken (etwa mit einem Pflaster): Das senkt das Risiko, dass Bakterien in die Wunde gelangen und ein Erysipel hervorrufen. Wer eine Erkrankung hat, welche die Haut anfälliger für Infektionen macht, sollte diese außerdem gezielt behandeln (lassen).
- Online-Informationen des Pschyrembel: www.pschyrembel.de (Abrufdatum: 16.4.2025)
- "Hautinfektionen". Online-Informationen des Bundesinstituts für Öffentliche Gesundheit (BIÖG): www.infektionsschutz.de (Abrufdatum: 16.4.2025)
- "Streptokokken-Infektionen (S. pyogenes/GAS)". Online-Informationen von Deximed: deximed.de (Stand: 26.3.2025)
- "Bakterielle Infektionen von Haut und Weichgewebe". Online-Informationen von AMBOSS: www.amboss.com (Stand: 6.1.2025)
- Herold, G. (Hrsg.): "Herold Innere Medizin 2025". Eigenverlag, Köln 2024
- "Erysipel". Online-Informationen von Deximed: deximed.de (Stand: 19.2.2024)
- "Wundrose und Phlegmone". Online-Informationen des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen: www.gesundheitsinformation.de (Stand: 10.8.2022)
- Die Informationen ersetzen keine ärztliche Beratung und dürfen daher nicht zur Selbsttherapie verwendet werden.
Quellen anzeigen

















