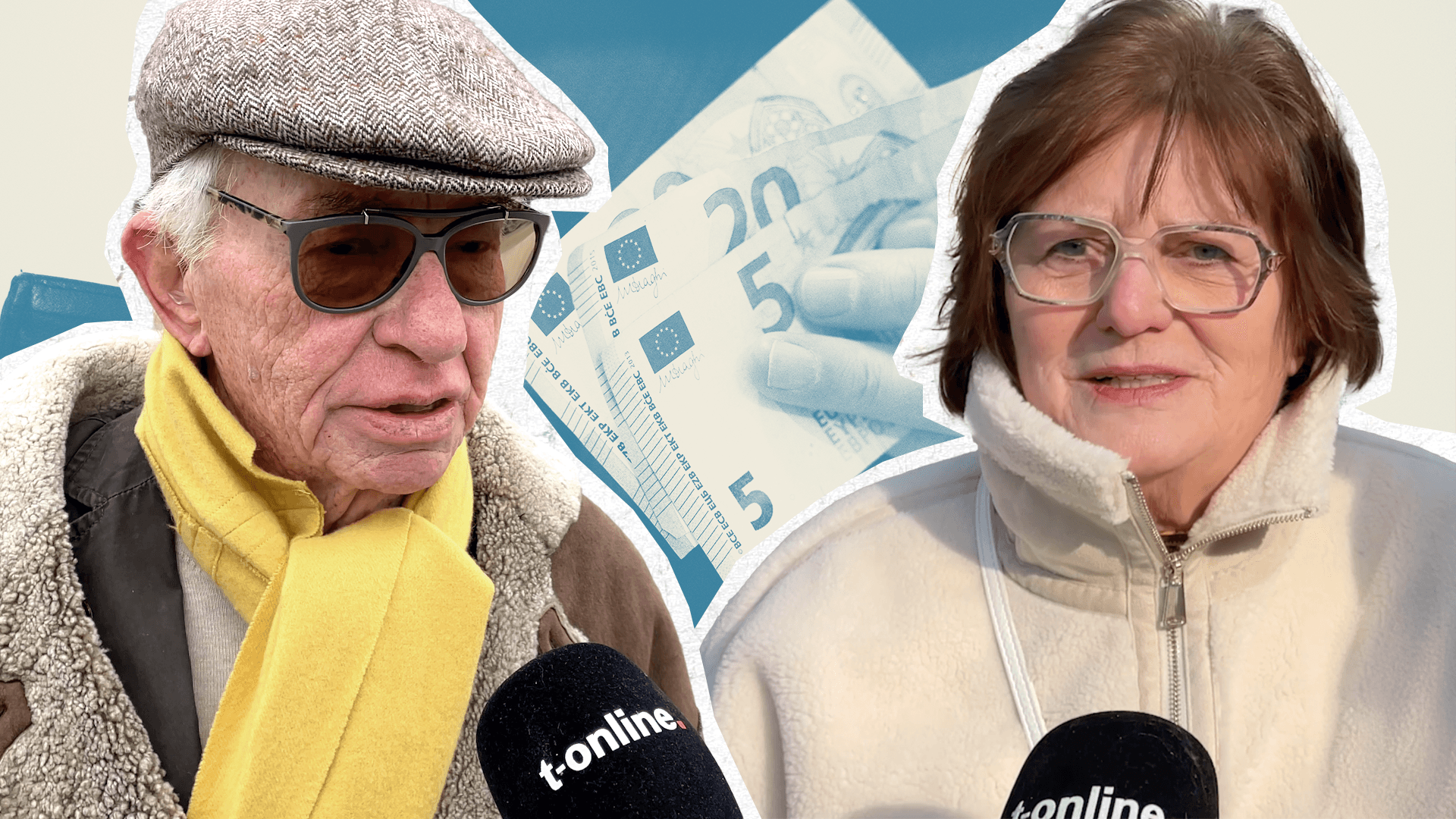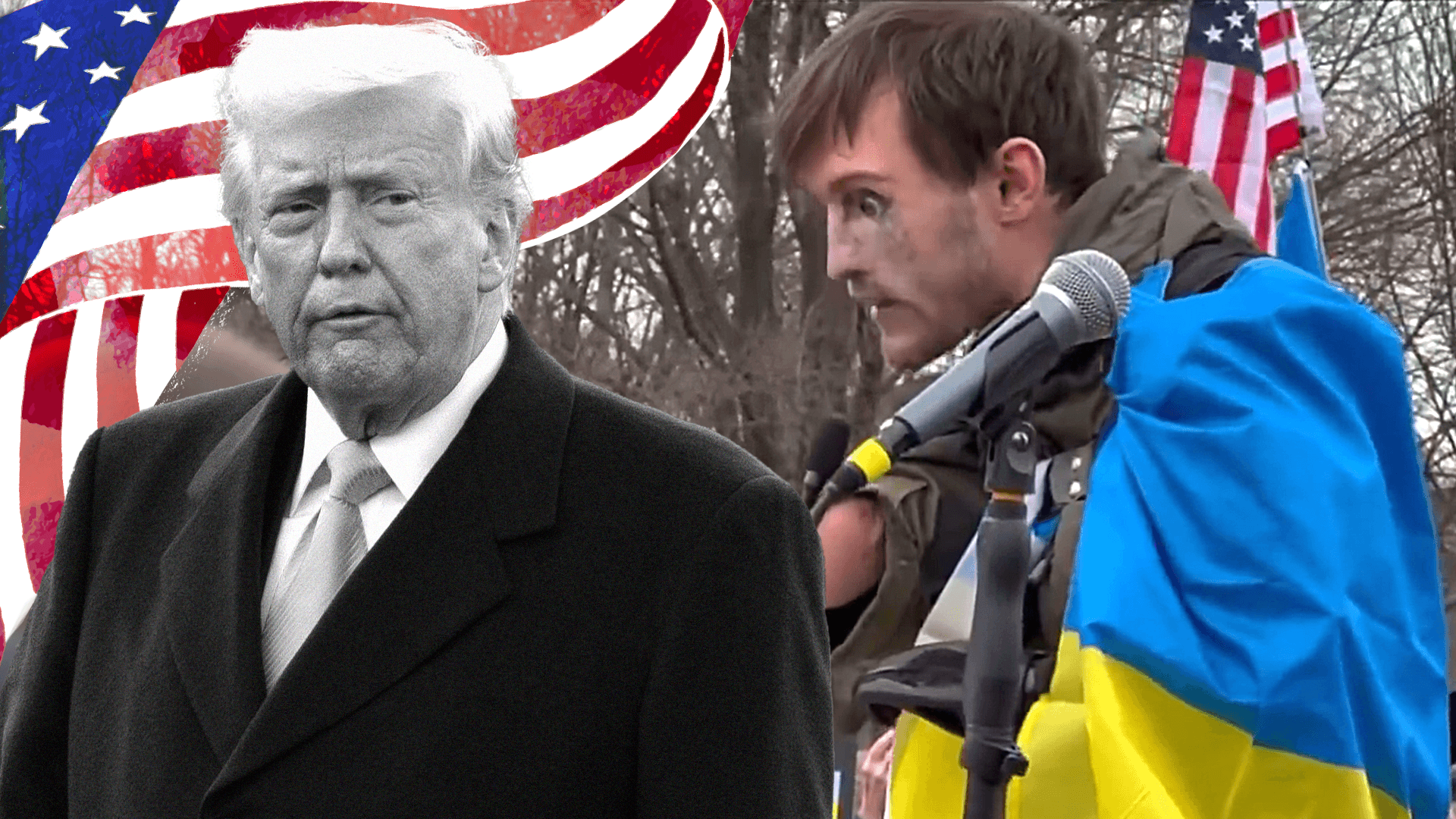Der Gesprächspartner muss auf jede unserer Fragen antworten. Anschließend bekommt er seine Antworten vorgelegt und kann sie autorisieren.
Zum journalistischen Leitbild von t-online.USA am Scheideweg "Waren nicht gerade ein Ruhmesblatt"


Kamala Harris will Donald Trump vom Weißen Haus fernhalten. Doch punkten konnte sie an entscheidender Stelle noch nicht. Historiker Ronald D. Gerste erklärt, worauf es im US-Wahlkampf ankommt.
Der Wahltermin rückt näher, der Kampf ums Weiße Haus verschärft sich – eigentlich sollte der Wechsel von Joe Biden zu Kamala Harris den Demokraten einen Vorteil verschaffen. Doch Donald Trump ist in den wichtigen Swing States weiter gut im Rennen. Was müsste Harris nun dringend tun? Worin besteht ihr größtes Handicap? Und an welchem früheren US-Präsidenten hat Donald Trump einen Narren gefressen? Diese Fragen beantwortet Ronald D. Gerste, Historiker und Autor des aktuellen Buchs "Amerikas Präsidentschaftswahlen", im Interview.
t-online: Herr Gerste, wofür steht Kamala Harris als demokratische Kandidatin fürs Weiße Haus eigentlich?
Ronald D. Gerste: Gute Frage. Zahlreiche Amerikaner stellen sie sich derzeit ebenfalls. Es ist noch gar nicht lange her, dass die "Washington Post" als ein führendes US-Medium dem damals kandidierenden Joe Biden dringend die Wahl eines neuen "Running Mate" empfohlen hat. Weil Kamala Harris als Vizepräsidentin eine ziemlich schwache Figur abgab.
Biden verzichtete aber nach seinem desaströsen Auftritt beim TV-Duell gegen Donald Trump – und die Demokraten hoben Harris auf den Schild.
Wir haben dann innerhalb kürzester Zeit einen schier unfassbaren und orchestrierten Enthusiasmus für Harris erlebt. Da haben eine Menge Spindoktors ganze Arbeit geleistet. Aber sie können auch keine Wunder vollbringen. Selbst viele Demokraten können Harris nicht einschätzen und wissen nicht, was sie erreichen will. Ja, sie ist Demokratin, ja, sie ist nicht Donald Trump. Aber ob das fürs Weiße Haus reichen wird? Harris' erste öffentliche Auftritte waren nicht gerade ein Ruhmesblatt – und sicher keine Werbung für sie. Aber immerhin hat sie sich im TV-Duell mit Trump gut geschlagen. Harris wird wohl mittlerweile relativ gut von ihrem Team vorbereitet.
Zur Person
Ronald D. Gerste, 1957 in Magdeburg geboren, ist promovierter Mediziner und Historiker. Er lebt in der Nähe der amerikanischen Hauptstadt Washington, D.C., und schreibt regelmäßig als Korrespondent für deutschsprachige Medien. Weiterhin ist Gerste Autor zahlreicher Bücher zur US-Geschichte, darunter "Amerika verstehen. Geschichte, Politik und Kultur der USA" und "Trinker, Cowboys, Sonderlinge. Die 13 seltsamsten Präsidenten der USA". Kürzlich erschien Gerstes aktuelles Buch "Amerikas Präsidentschaftswahlen. Von George Washington bis zu Donald Trump".
Wird Harris' Erfolg beim TV-Duell den Amerikanern bis zur Wahl überhaupt in Erinnerung bleiben?
Man merkt Harris die Scheu vor Interviews an, bei unangenehmen Fragen flüchtet sie sich in Politikerphrasen. Gegen Trump hat sie im direkten Aufeinandertreffen bestanden, ihm ist dann ja auch die Lust gründlich vergangen. An diesem Tag war er aber auch nicht gerade gut in Form und sah richtig schwach aus. Trump macht nun die Erfahrung, die vorher Joe Biden machen musste: Nun ist Trump der Alte, der gegen jemand jüngeres die schlechtere Figur abgibt.

Embed
In den sogenannten Swing States wie Pennsylvania wird die Wahl aller Voraussicht nach entschieden. Wie beurteilen Sie die Entwicklung dort?
Harris müsste da hingehen, wo es wehtut – und zwar in diese Staaten. Das tut sie aber viel zu wenig. Am Abend des TV-Duells hatte Trump ein paar lichte Momente: Einer davon war der Augenblick, als Harris versprach, etwas gegen die irrsinnige Inflation zu tun. Da bot sich natürlich die Bemerkung an, dass Harris seit mehr als drei Jahren als Vizepräsidentin Teil der Regierung ist. Auf diese Schwachstelle eine passende Antwort zu haben, wäre sicher von Vorteil, wenn Harris Präsidentin werden will. Und diese Antwort sollte sie besser in den Swing States geben.
Joe Bidens Bilanz als Präsident ist durchaus beachtlich – warum muss Harris gleichwohl darauf achten, nicht zu sehr mit seiner Administration in Verbindung gebracht zu werden?
Ich bin mir sicher, dass Joe Biden in der Zukunft als eine Art "letzter Gentleman" im Weißen Haus gelten wird. Er hat eine unglaublich lange und erfolgreiche Zeit als Politiker vorzuweisen, mit Fehlern, ja, aber insgesamt doch mehr als beeindruckend. Nun macht ihm einerseits Trumps Populismus zu schaffen, und in der Tat hat Biden die hohen Preise nicht in den Griff bekommen. Deswegen muss Harris Distanz suchen.
Falls Harris ins Weiße Haus als Präsidentin einziehen sollte, wäre sie paradoxerweise also eine Unbekannte. Mit "Amerikas Präsidentschaftswahlen" haben Sie ein aktuelles Buch geschrieben, das die bisher 46 Staatsoberhäupter und ihren Weg ins höchste Staatsamt beschreibt. Gibt es vergleichbare Fälle aus der Geschichte?
Jimmy Carter, der 39. Präsident, kommt mir da in den Sinn. Da wusste auch niemand so recht, wer genau da 1977 ins Weiße Haus einzog und was er vorhatte. Carter hatte als höheres politisches Amt lediglich eine Amtszeit als Gouverneur von Georgia absolviert.
Carter galt als äußerst integrer Präsident, allerdings ohne jegliche Fortune.
Das kann man wohl sagen. Zwar vermittelte der Demokrat Carter erfolgreich Frieden zwischen Israel und Ägypten, aber in den Augen der Amerikaner versagte er mehrfach völlig: So bei der Lösung des Geiseldramas von Teheran mit Dutzenden gefangen gehaltenen US-Diplomaten 1979 wie der Eindämmung der wirtschaftlichen Folgen der damaligen Ölpreiskrise. Bei der nächsten Wahl errang Ronald Reagan von den Republikanern dann einen Erdrutschsieg.
Damit reihte sich Carter wie sein späterer Nachfolger Joe Biden in die Liste der Präsidenten mit lediglich einer Amtszeit ein. In der Regel gilt dies als eine Art Versagen am Ende der politischen Karriere. Gab es aber auch Ausnahmen?
James Polk, die Nummer elf in der Liste der US-Präsidenten, ist ein Beispiel dafür. Polk hatte schon vor seiner Wahl erklärt, lediglich eine Amtszeit von 1845 bis 1849 absolvieren zu wollen. Dann hat er als Präsident stur sein Programm abgearbeitet: darunter die Regelung der Grenzen zum damals britischen Kanada, die Aufnahme von Texas in die Union und einen Krieg gegen Mexiko. Danach hat sich Polk zurückgezogen und starb wenige Monate nach seinem Ausscheiden an der Cholera.
Sie beschäftigen sich seit vielen Jahren mit der Geschichte der US-Präsidenten. Welche Biografie finden Sie besonders bemerkenswert?
Da stechen einige hervor, aber spannend ist insbesondere Richard Nixon. Ja, er war ein Lügner, er hat ohne jeden Zweifel gewaltige Schuld auf sich geladen. Aber in der Bewertung ist seine Bilanz durchaus beeindruckend. Eine amerikanische Umweltschutzorganisation listet ihn auf Platz zwei der US-Präsidenten, die am meisten für den Naturschutz getan haben. Nixon hat die Eiszeit mit China beendet, Nixon hat das erste wirkliche Begrenzungsabkommen der nuklearen Rüstung mit der Sowjetunion geschlossen. Für die amerikanischen Ureinwohner setzte sich Nixon ebenso stark ein. Es gibt so einen Satz, der Nixon ganz gut umschreibt: "When Richard Nixon lied, nobody died." ["Als Richard Nixon log, starb niemand", Anmerkung der Redaktion.] George W. Bush mit seinem Lügen über irakische Massenvernichtungswaffen Anfang der 2000er kann so etwas nicht für sich in Anspruch nehmen. Im Gegensatz zu Nixon hat Bush keine Konsequenzen tragen müssen.
Gab es US-Präsidenten, bei denen die Erwartungen niedrig waren, die dann aber überraschten?
Das trifft auf Chester A. Arthur zu, der 1881 Präsident wurde. Sein Vorgänger James Garfield war im Amt ermordet worden, Arthur rückte als sein Vize nach. Zuvor war Arthur Chef der Zollbehörde im New Yorker Hafen gewesen, die als Hort der Korruption galt. Entsprechend niedrig waren die Erwartungen. Doch Arthur überraschte sie alle, er gilt heute als einer der moralisch integersten Präsidenten überhaupt.
Bisweilen wandelt sich die Sicht auf US-Präsidenten im Laufe der Zeit. Woodrow Wilson führte die USA 1917 in den Ersten Weltkrieg, später wollte er die Welt durch den Völkerbund sicherer machen. Dabei war er ein Anhänger der Rassentrennung in den Vereinigten Staaten.
Der Demokrat Wilson war ein Rassist und Sympathisant des Ku-Klux-Klans, ja. Es ist immer noch erstaunlich, wie viele Wilson-Boulevards es auch noch in Europa gibt. Tatsächlich wandelt sich das Bild, meist lohnt der genaue Blick. Da überraschen manche US-Präsidenten plötzlich positiv, andere offenbaren durchaus Abgründe.

Embed
Donald Trump wiederum hat ein Faible für Andrew Jackson, den siebten US-Präsidenten von 1829 bis 1837. Warum?
Dieser Präsident ist Trumps absoluter Liebling. Während Trumps Amtszeit hing Jacksons Porträt im Oval Office, vielleicht fühlte sich der 45. Präsident ja mit dem 7. irgendwie seelenverwandt. Jackson war jähzornig und rachsüchtig, aufbrausend und nachtragend. Seine Untergebenen fürchteten ihn, seine Feinde – an denen er keinen Mangel hatte – sowieso.
Aus guten Gründen. Immerhin hatte Jackson einst im Duell einen Mann getötet, einen verhinderten Attentäter soll Jackson höchstpersönlich mit seinem Gehstock verprügelt haben.
Jackson war ein Haudegen, absolut, der Auseinandersetzungen nicht aus dem Weg ging. Seinen Duellanten hat er getötet, auf den gescheiterten Attentäter hat er eingeschlagen. Nebenbei bemerkt: Er war zudem der erste US-Präsident, auf den ein Anschlag verübt wurde. Daneben weist seine Biografie Aspekte auf, die ebenfalls interessant sind: Jackson war nicht nur ein Kriegsheld, der New Orleans 1812 erfolgreich gegen die Briten verteidigt hat, sondern auch der erste Präsident, der nicht aus der Elite des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges stammt.
Jackson wurde 1767 in Tennessee geboren, das erst 1796 US-Bundesstaat wurde.
Genau. Jackson war die Verkörperung des Amerikanischen Traums, er stammte aus kleinen Verhältnissen, er arbeitete sich hoch, brachte es zu großem Reichtum. Auch das findet Trump sicher an Jackson imposant. Noch weit wichtiger ist aber sicher die Tatsache, dass Jackson auch als erster Populist im Weißen Haus gilt. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern, die besagter Elite angehörten, sprach Jackson die Masse der sogenannten einfachen Leute an. Jackson war kein Intellektueller, er sprach auch nicht so. Jackson redete so, wie er wollte, und das kam durchaus gut an bei den Wählern.
1824 konnte Jackson bei seinem ersten Anlauf zwar die meisten Wählerstimmen auf sich vereinen, scheiterte aber im Kollegium der Wahlmänner. Was ist passiert?
Das ist eine weitere Verbindung zwischen Jackson und Trump. 1824 wollten drei weitere Männer ins Weiße Haus, darunter mit Henry Clay der Sprecher des Repräsentantenhauses und der bisherige Außenminister John Quincy Adams. Keiner der Kandidaten bekam die nötigen 50 Prozent plus eine Stimme im Wahlmännerkollegium zusammen. Deswegen war das Repräsentantenhaus gefragt, den Sieg dort errang Adams schließlich. Auch weil der einflussreiche frühere Gegenkandidat Clay ihn unterstützt hatte. Und dann kam es zum großen Krach.
Warum?
Zunächst war alles wunderbar, Jackson gratulierte Adams artig. Doch dann berief Adams Clay auf den Spitzenposten des Außenministers – und die Wellen der Empörung schwappten aufseiten der Unterstützer Jackson hoch.
Die Sprache war 1824 von "einer gestohlenen Wahl". Derartiges behauptet Trump der Wahrheit zum Trotz auch über seine Niederlage gegen Joe Biden 2020.
Im Falle Jacksons gab es wahrscheinlich tatsächlich Absprachen zu seinem Nachteil. Trump hingegen ist bis heute Beweise für die angeblich gestohlene Wahl 2020 schuldig geblieben. Er nutzt Jacksons Geschichte als angebliches Beispiel dafür, dass die Eliten das "einfache Volk" immer wieder betrügen würden.
Donald Trumps Geschichte ist noch offen, wofür ist Andrew Jackson bis heute bekannt?
Das Urteil über Jackson ist zwiespältig. Einerseits gilt er als Präsident der kleinen Leute, der etwa die Macht der Nationalbank geschliffen hatte. Andererseits war er ein "Indianerhasser": Während seiner Präsidentschaft dehnten sich die USA stark nach Westen aus, den Preis für diese Expansion mussten die amerikanischen Ureinwohner zahlen. Während seiner Amtszeit ließ Jackson etwa die Nationen der Cherokee, Chickasaw, Choctaw, Muskogee und Seminolen Richtung Westen deportieren, viele starben unter entsetzlichen Bedingungen. Da war Trumps Vorbild erbarmungslos.
1832 wählten die Amerikaner Jackson zum zweiten Mal ins Weiße Haus, Donald Trump strebt nun ebenfalls eine weitere Amtszeit an. Wird sich die amerikanische Demokratie als so robust erweisen, dass sie "Trump 2.0" übersteht?
Es könnte die absolute Härteprobe werden. Die USA sind die älteste Demokratie der Welt, das sollte nicht mit Donald Trump enden.
Herr Gerste, vielen Dank für das Gespräch.
- Persönliches Gespräch mit Ronald D. Gerste via Videokonferenz