Geschichte Pleiten, Pech und Schlangengift: missglückte Experimente
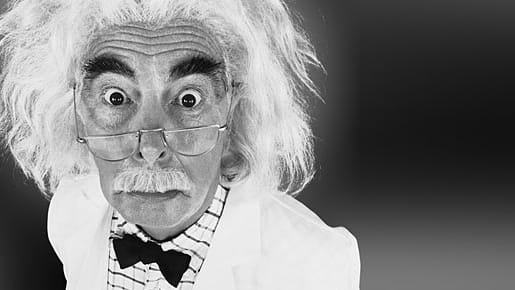

Sie spritzten sich Mambagift in die Adern oder erhängten sich beinahe - und das alles im Dienste der Wissenschaft. In Versuchen der Forscher geht eine Menge schief. Vier Beispiele für grandios gescheiterte Experimente.
Wissenschaftliche Experimente haben eine Eigenheit, die in offiziellen Publikationen gerne unterschlagen wird: Sie missraten oft. Dass Forscher nicht darüber sprechen, ist schade, denn Missgeschicke und Komplikationen gehören genauso gut zum Erkenntnisprozess der Wissenschaft wie Statistiken und belastbare Ergebnisse.
Warum aber werden die missratenen Versuche in Studien verschwiegen? Manchem Forscher sind die Pleiten und Pannen vielleicht einfach zu peinlich. Der andere hält sie vielleicht für unnütze Informationen, die von den wichtigen Erkenntnissen ablenken.
Dabei liegen unerwartete Zwischenfälle in der Natur des Experiments, denn bei ihm kollidieren nun mal Theorie und Praxis. Mit teils bizarren Folgen, wie folgende Beispiele zeigen.
Flucht aus dem Toilettenfenster
Um die Reaktionen von Menschen auf peinliche Situationen zu erforschen, musste der Psychologe Howard Garland seine Versuchspersonen in eine solche bringen. In früheren Versuchen ließ man sie an einem Schnuller saugen und vor einem Publikum ihre Gefühle beschreiben. Das war selbst den Zuschauern peinlich, und Garland suchte nach einer sanfteren Methode. Schließlich forderte er seine Probanden auf, vorm Publikum ein Lied vorzusingen. Doch ein Testteilnehmer fürchtete sich derart davor, dass er nach der Toilette fragte und dann aus dem WC-Fenster flüchtete - die Toilette lag im ersten Stock.
Die Reaktionen der Verbleibenden gingen in die erwartete Richtung: Vor Fremden war es ihnen zum Beispiel weniger peinlich zu singen als vor Freunden. Und Frauen waren weniger gehemmt vor Männern zu singen als vor anderen Frauen, wohl weil sie die Männer als schlechtere Sänger einschätzten, die ein paar falsche Töne nicht bemerken würden.
Der Kopf in der Schlinge
In seinem 238-seitigen Fachartikel "Etude sur la pendaison" ("Studie über das Erhängen") aus dem Jahr 1905 behandelte der rumänische Gerichtsmediziner Nicolas Minovici alles, was man je über diese Todesart wissen wollte - und einiges mehr. Dazu gehörte auch die Frage, wie sich das Erhängen anfühlt und was vor dem Tod genau geschieht. Um sie zu klären, sah Minovici nur eine Möglichkeit: Er musste sich selber erhängen. Mit verschiedenen Schlingen um den Hals ließ er sich von einem Assistenten hochziehen, bis seine Beine ein oder zwei Meter über dem Boden baumelten. Diese unnötige Höhe - fünf Zentimeter hätten denselben Effekt gehabt - wurde ihm beinahe zum Verhängnis. Bei einem Versuch wollte der Assistent am Seil dem ohnmächtigen Minovici zu Hilfe eilen und ihn auffangen, dabei verhedderte sich das Seil und Minovici hätte sich fast richtig erhängt.
Seine nicht ungefährlichen Versuche bescherten der Medizin jedoch wichtige neue Erkenntnisse. So korrigierte Minovici die Ansicht, dass die meisten Erhängten ersticken würden. Todesursache sei stattdessen die unterbrochene Blutzufuhr im Gehirn.
Die verhängnisvolle Mamba
Der Titel des Fachartikels war unauffällig: "Einige klinische Beobachtungen über die Wirkung von Mambagift". Doch Friedrich Eigenberger kosteten die "Beobachtungen" fast das Leben. Eigenberger war ein weitgereister Arzt in Wisconsin, USA, mit einem Hang zu ungewöhnlichen Selbstversuchen. Er hatte sich bereits mehrmals kleine Mengen Klapperschlangengift injiziert, um die Wirkung auf den Körper zu studieren. Diese Versuche waren zwar schmerzhaft, blieben aber ohne gravierende Folgen.
Ohne Zweifel erwartete er eine ähnliche Körperreaktion, als er sich 1928 zum ersten Mal das Gift einer Mamba spritzte. Was er nicht wusste: Gift von Mamba und Klapperschlange unterscheiden sich grundsätzlich. Klapperschlangengift zielt auf Blutgefäße und Blutzellen, verursacht aber oft nur schmerzhafte Schwellungen, Mambagift hingegen ist ein Nervengift, das Atmung und Herz lähmen kann. Eigenberger war bald todkrank, konnte kaum mehr reden oder schlucken und fühlte, wie Gesicht, Finger und Zehen taub wurden. Nach einer langen Nacht klangen die Vergiftungssymptome ab.
Das missratene Experiment zeigte offenbar Wirkung: Berichte über weitere Selbstversuche Eigenbergers bis zu seinem Tod im Jahr 1961 sind nicht überliefert.
Furcht und Angst im Großstadtdschungel
Dass auch Einfachheit eine Studie nicht vor Zwischenfällen bewahrt, zeigt das Warteschlangenexperiment von Stanley Milgram aus dem Jahr 1980. Milgram schickte seine Studenten in New York mit dem Auftrag los, sich in Warteschlangen vorzudrängeln und aufzuzeichnen, was passiert.
Doch die Aufgabe erwies sich tückischer als vermutet. Die Studenten stellten bald fest, wie viel Überwindung es braucht, sich ohne Grund vorzudrängeln. Einige trippelten eine halbe Stunde auf und ab, bevor sie sich trauten, anderen wurde schlecht und schwindlig. Zu den in der Publikation verschwiegenen Zwischenfällen gehört auch jener in einer Warteschlange der Hafenbehörde, wo ein Empörter eine Pistole zog, als sich Milgrams Studenten nach vorn schummeln wollten.
















