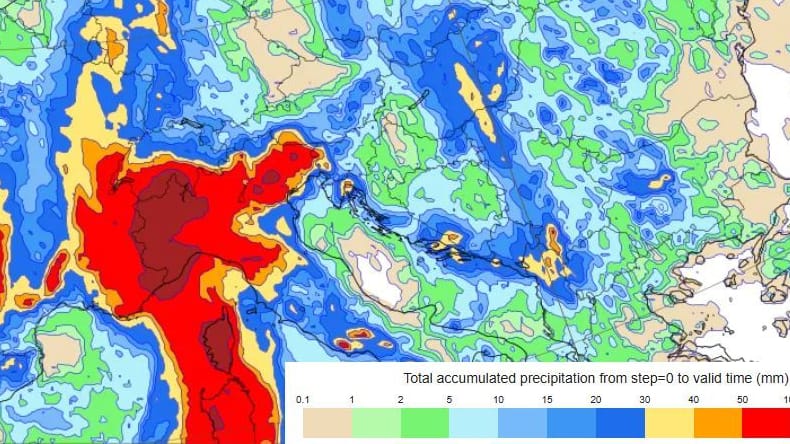Die subjektive Sicht des Autors auf das Thema. Niemand muss diese Meinung übernehmen, aber sie kann zum Nachdenken anregen.
Was Meinungen von Nachrichten unterscheidet.Als US-Korrespondent unter Trump Es war irre, faszinierend und manchmal abstoßend


Unser Korrespondent nimmt nach dreieinhalb irren Jahren Abschied von Amerika. Manches ließ ihn verzweifeln – anderes wird er in Deutschland vermissen. Am Ende überraschte ihn der US-Präsident noch einmal.
Auf den letzten Metern haben mich der US-Präsident und die First Lady noch einmal erstaunt. Als sie zum Nationalfeiertag ins Weiße Haus luden, trat da plötzlich ein neuer Joe Biden auf, oder vielmehr: war ein alter Biden zurück.
Der Präsident der vergangenen sechs Monate, der mahnende Maskenträger und das bedachte Vorbild für alle Vorsichtigen, war auf einmal Geschichte. Stattdessen kam jener Mann zum Vorschein, den ich das letzte Mal im März 2020 gesehen hatte: der Biden zum Anfassen.
Biden alberte mit seinen Amtsvorgängern herum, die sich in Form von Riesenmaskottchen ein Wettrennen auf dem Südrasen lieferten (es gewann Teddy Roosevelt). Jill Biden sprintete fast schon übermütig, jedenfalls zu unserer großen Überraschung, in die kleine Gruppe der zugelassenen Journalisten und posierte für ein Gruppenselfie. Dann gingen die beiden, jeder für sich, auf Tuchfühlung mit den Gästen: Gut tausend 'essential workers' (also etwa Krankenschwestern oder Feuerwehrleute) sowie Soldaten waren geladen.
Sogar der schwülstige Popsong "God Bless the USA", das Einmarschlied Donald Trumps bei dessen Auftritten, lief nun plötzlich auf Bidens Party.
Es war eine Wiederaneignung, eine freundliche Übernahme von Symbolen, die zuletzt mit Trump verbunden waren. Vor zwei Jahren war ich bei Trump, der am 4. Juli ein paar Panzer am Lincoln Memorial auffahren und Kampfflugzeuge über Washington donnern ließ. Es war Trumps größte Show und dies war nun die größte Veranstaltung in Bidens bisheriger Amtszeit. Entspannter, unaufgeregter und für mich ein schöner Abschied.
Ich verlasse nun Washington und steige in den Flieger nach Deutschland. Dreieinhalb Jahre war ich hier. Es war eine irre Zeit: anstrengend, atemlos, faszinierend und abstoßend, zwischenzeitlich auch etwas deprimierend. Nach den Jahren des permanenten Ausnahmezustandes verlasse ich ein Amerika, das sich nun durch die Rückkehr zur Normalität auszeichnet. So wie man sie auf Bidens Independence-Day-Feier sehen konnte.
Im Weißen Haus wird wieder gearbeitet, mit allen Problemen und Fehlern, die das Regieren so mit sich bringt, aber ohne Chaos und Zirkus. In weiten Teilen Amerikas wirkt Corona wie aus ferner Vergangenheit. Der zwischenzeitliche Abstieg von Millionen Amerikanern in die Armut ist durch den Aufschwung und viele, viele Hilfsgelder gebremst. Die Sicherheitszäune am Weißen Haus (seit dem Black-Lives-Matter-Sommer) und Kapitol (seit dem 6. Januar) werden gerade wieder abmontiert.
Doch all das spielt sich an der Oberfläche ab. Darunter ist das Land deutlich aufgewühlter. Donald Trump hat seine Partei so dressiert, dass sie seine Lügen über die Wahl nachplappert – er tourt jetzt wieder damit durchs Land. In vielen Gegenden wollen sich Amerikaner weder impfen noch durch leichte Corona-Regeln einschränken lassen, sodass auch hier das Virus immer wieder aufzuflammen droht. Auch wenn Biden am Independence Day gleich noch die "Unabhängigkeit von Covid-19" mitfeierte – sein Ziel, 70 Prozent der erwachsenen Amerikaner zu impfen, hat er verfehlt. Und die Pandemie hat die Reichen nur noch reicher gemacht, während Bidens große Sozialprogramme im Kongress blockiert werden.
Amerika steckt in vielen verschiedenen Realitäten fest. Das ist keine sonderlich neue Erkenntnis, doch mein Eindruck ist, dass diese sich immer weiter voneinander entfernen. Und auf jeder Seite arbeitet man sich mit Hingebung an der Gegenseite ab. Diese seltsame Lust begegnete mir nicht nur im Job, sondern auch im Alltag.
Ich war gerade einige Wochen bei einer Physiotherapeutin in Behandlung. Schon zu Beginn der ersten Sitzung, wir waren gerade noch beim Kennenlernen, entrüstete sie sich darüber, dass Biden senil und nur eine Marionette sei. Als ich entgegnete, dass ich diesen Eindruck im Weißen Haus nicht gewinnen würde, herrschte erst einmal eine seltsame Stille. Beim zweiten Termin raunte sie, wie Biden bei seinem Europatrip sein Land quasi verraten habe.
Und als ich andererseits am Wochenende beim Brunch meinen alten Freund David fragte, wie es ihm gehe, legte er mit dem Befund los, in einer "politisch furchteinflößenden Zeit" zu leben, und setzte sogleich zu einer großen Abhandlung über die Attacken der Republikaner auf das Wahlrecht an, über den Supreme Court, irgendwann landete er bei Lyndon B. Johnson in den Sechzigerjahren. (Ich glaube, es geht ihm gut, aber zu diesem Thema fand er in seinen Ausführungen nicht mehr zurück.)
Eine Nation im Schützengraben, Blick und Wut allzeit auf die Gegenseite gerichtet. So habe ich Amerika in diesen Jahren erlebt. Eine Nation, die sich nicht einigen kann, wie ihre Vergangenheit wirklich war, was sie ist und was sie sein will. Nicht sehr united, diese states.
Wobei David übrigens nicht einmal unrecht hat: Die Tatsache, dass eine Seite dafür kämpft, dass möglichst wenige der Mitbürger wählen dürfen, die anders aussehen als sie selbst, zeigt, wie sehr Amerikas Demokratie immer auch in der Krise ist. "Nichts an unserer Demokratie ist garantiert", sagte auch Biden in seiner Rede am 4. Juli. "Wir müssen um sie kämpfen, sie verteidigen, sie uns verdienen."
Das Thema stellte auch mich in dieser Kolumne vor eine Herausforderung: Ich wollte hier nie in ein Demokraten gut/Republikaner schlecht-Muster verfallen, schließlich ist die Realität weiß Gott komplizierter. Doch die Demokratie wird in diesen Jahren tatsächlich nur von einer Seite bedroht. Nicht allein von Trump, der nur Wahlergebnisse akzeptiert, wenn sie ihm passen, sondern von großen Teilen seiner Partei, die von der "großartigsten Demokratie auf Erden" reden, aber schon seit Langem allzu gern ihren Mitbürgern das Wahlrecht streitig machen. Es ist nur einer dieser vielen Widersprüche, die Amerika ausmachen.
Manchmal bin ich verzweifelt an diesem Amerika. Als im ersten Jahr der Pandemie niemand in der Regierung das tödliche Quacksalbern des Präsidenten aufhielt. Am grotesk teuren und oft schlechten Gesundheitssystem – kürzlich flatterten nach einer kleinen Untersuchung in der Notaufnahme zwei, drei, vier Rechnungen ein und plötzlich waren wieder 3.000 Dollar fällig. Oder wenn selbst schlaue Bekannte die angeblichen Ungeheuerlichkeiten nachplappern, die sie in den Meinungsshows im Fernsehen vorgesetzt bekommen, die aber mit der Realität nichts zu tun haben.
Ich habe sie allerdings auch geschätzt, diese Lust an der Meinung, den Mut, für seinen Standpunkt öffentlich einzustehen. Das haucht der Demokratie Leben ein. Ich mag auch, wie man hier dem Pragmatismus den Vortritt gegenüber der Prinzipienreiterei lässt (Stichwort Impfung an der Obsttheke). Und mich beeindruckt es, wie hart viele Amerikaner arbeiten und nebenbei noch bei Dingen anpacken, die anderswo der Staat erledigt.
Und dann ist da noch der American Way of Life, dem man sich irgendwann ergibt. Dass man überall mit dem Auto hinfahren kann, etwa auf Berggipfel in Nationalparks, fand ich anfangs obszön, jetzt finde ich es praktisch und gerecht: Kann halt nicht jeder kraxeln. Kürzlich habe ich es in Wyoming selbst einmal gemacht.
Vieles ist eine Einladung zur Bequemlichkeit. Bargeld habe ich das letzte Mal 2018 abgehoben, und mein Auto konnte ich binnen zehn Minuten verkaufen, die Firma holte es einfach an der Haustür ab. Mir graut schon leicht vor der Berliner Mentalität: "Kartenzahlung ham wa nicht." Ich werde wohl erst in Deutschland merken, wie sehr mich die Jahre in Amerika geprägt haben.
Besonders schön fand ich immer wieder, wie man mit einem simplen "Hi, I'm from Germany" mit allen möglichen Amerikanern ins Gespräch kommt. Die deutsch-amerikanischen Verbindungen, sei es durch Einwanderung, Familie, Militärdienst, sind enorm stark. So stark, dass ihnen auch Trumps jahrelanges Deutschland-ist-uns-was-schuldig-Gerede wenig anhaben konnte. Ist das nicht ein Trost?
Ich danke Ihnen für Ihr großes Interesse an dieser Kolumne. Mein Ziel war es, Amerika mit seinen ganzen Widersprüchen zu fassen zu bekommen und Sie Washington und die USA mit meinen Augen sehen zu lassen. Ihre Reaktionen haben mir gezeigt, dass das tatsächlich oft gelungen ist. Darüber freue ich mich wirklich sehr.
Ich nehme nach diesen intensiven Jahren nun eine Auszeit in Deutschland. Zuvor habe ich aber noch mit meinem Kollegen Marc Krüger über meine dreieinhalb Jahre mit Trump und Biden gesprochen. Sie können uns im "Tagesanbruch am Wochenende" ab Samstag dabei zuhören.
Nun freue ich mich sehr auf die Heimat. Wegen der Pandemie war ich knapp zwei Jahre nicht mehr dort. Wenn ich im Sommer in Neuengland auf Cape Cod war, habe ich den Leuten immer gesagt, dass es dort eigentlich genauso aussieht wie an der deutschen Ostsee. Jetzt überprüfe ich meine kühne Behauptung einmal vor Ort. Ostsee statt Atlantik, dann Berlin statt Washington.
Ich habe das Gefühl, dass es kein endgültiger Abschied aus Amerika ist. Es gibt keinen konkreten Plan, es ist nur ein Gefühl, aber ein ziemlich gutes.