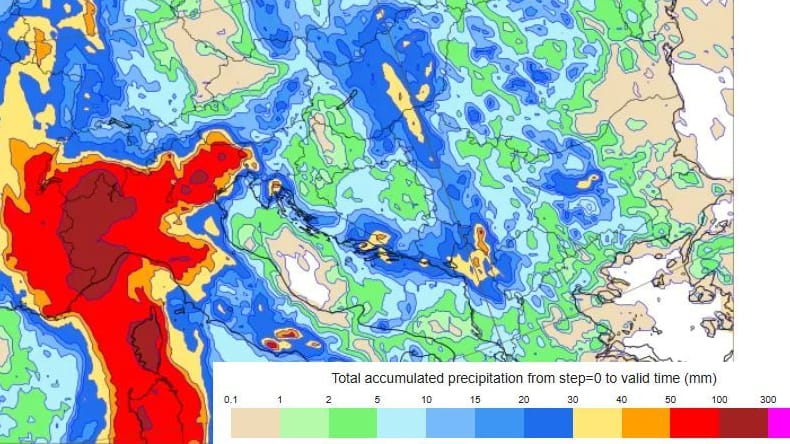Die subjektive Sicht des Autors auf das Thema. Niemand muss diese Meinung übernehmen, aber sie kann zum Nachdenken anregen.
Was Meinungen von Nachrichten unterscheidet.Post aus Washington Der Wahnsinn hat Methode


Zwei Massaker schockieren die USA. Joe Biden will eine Waffenreform durchsetzen. Doch sobald es um die Toten von Waffengewalt geht, regiert in Washington der blanke Zynismus.
Wenn diese elende Pandemie den USA etwas Gutes brachte, dann vielleicht dies: Das Jahr 2020 verging ohne das, was die Amerikaner mass shooting nennen, ein Schusswaffenmassaker.
Doch jetzt sind wir zurück in der amerikanischen Normalität. Zu der gehört, dass alle paar Monate, alle paar Wochen und manchmal eben auch alle paar Tage ein Mann mit einer Waffe gleich mehrere Mitmenschen tötet.
Erst erschoss ein junger Mann in Atlanta acht Menschen in drei Massagesalons, sechs Tage darauf tötete ein junger Mann in Boulder zehn Menschen in einem Supermarkt. Damit sind wir beim Thema, das draußen in der Welt für so viel Kopfschütteln sorgt wie kaum ein zweites: Amerika und seine Waffen.
Jetzt, so ist überall zu lesen, tobe wieder eine Waffendebatte. Doch schon dieser Begriff ist eines der vielen Missverständnisse, sobald es um Amerikas Waffenkultur geht. Es gibt keine Debatte. Es gibt zwei Seiten, die aneinander vorbeidenken und –reden. Die einen (eine Mehrheit) wollen nicht akzeptieren, dass in Amerika so viel mehr Waffen im Umlauf sind und so viel mehr Menschen durch Waffengewalt sterben als anderswo. Die anderen (eine mächtige Minderheit) sehen schon im Vorschlag, Magazine für Halbautomatikwaffen so zu verkleinern, dass man ohne Nachladen nur zehn statt dreißig Menschen erschießen kann, den Anfang vom Ende von Freiheit, Verfassung, Republik.
Wenn Präsident Joe Biden jetzt sagt, es sei an der Zeit für einen Wandel, winkt Washington nur müde ab. Keine Mehrheit in Sicht. So nüchtern bis zynisch betrachtet man das Ganze aus der Hauptstadt.
Ich bin bei dem Thema auch Realist, und doch erwischte mich die Nachricht vom Supermarkt-Amoklauf in Colorado ziemlich kalt. Ich kenne die Gegend gut, seit ich in Denver drei Monate mit einem Journalistenstipendium gelebt und gearbeitet habe. Und ich weiß, wie sehr Denver darunter leidet, so etwas wie die Amokhauptstadt Amerikas zu sein.
Sie erinnern sich an das Massaker an der Columbine High School in Littleton 1999, bei dem zwei in Schwarz gekleidete Schüler zwölf Mitschüler und einen Lehrer erschossen? Das war in einem Vorort von Denver. Wissen Sie noch, wie 2012 ein junger Mann die Spätaufführung des neuen Batman-Films stürmte und dabei zwölf Kinogänger tötete und 58 verletzte? Das war in Aurora, ebenfalls Vorort von Denver. Und jetzt die zehn Toten im Supermarkt im bunten Outdoor-Städtchen Boulder, keine halbe Stunde vom Zentrum Denvers. Und das sind nur die großen drei.
Ich bin damals in Denver für eine Langzeitreportage in Amerikas Waffenkultur eingetaucht und habe irgendwann einiges verstanden: dass man hier, am Fuße der Rocky Mountains, ohnehin mit Argwohn auf die ferne Regierung in Washington schaut und sich im Zweifelsfall lieber selbst gegen alle Feinde verteidigen will. Dass man ohnehin weiß, wie viele Pistolen, Flinten, Sturmgewehre kursieren und für sich selbst nichts lieber als Waffengleichheit herstellen will. Nur eines habe ich nicht verstanden: dass man sich weigert, über den Preis des Rechts auf Selbstverteidigung zu sprechen.
Diesen Preis erahnt man, wenn man mit Menschen wie Frank DeAngelis redet. Er war damals beim Amoklauf der Schuldirektor der Columbine High School. Jetzt ist er 66 Jahre alt und in Rente.
DeAngelis ist ein offener Typ, der gern und lange erzählt. Man tritt ihm nicht zu nahe, wenn man schreibt, dass ihn der Amoklauf nie wieder losgelassen hat.
Wenn er über die Zeit des Massakers in seiner Schule spricht, schließt er oft die Augen. DeAngelis weiß, was so eine Tat auslöst: dass sie einer ganzen Gemeinde den Boden unter den Füßen wegzieht, dass es Schuldgefühle der Überlebenden gibt, dass die Panik, das Herzrasen und die Beklemmung viele Jahre bleiben. "So etwas verändert die Gemeinschaft für alle Zeiten", sagt er.
Wir reden schon eine ganze Weile, als er die dunkleren Folgen auch in seinem eigenen Leben anspricht. Dazu zählt er, dass sich seine Frau von ihm scheiden ließ, dass ihm seine Tochter sagte, er habe sich verändert. Er sei bis heute in Therapie, sagt DeAngelis jetzt, 22 Jahre später.
Bidens Rede gleich nach dem aktuellen Massaker hat er gehört. Er fand sie nicht schlecht, aber sie klang eben genau wie damals, als er selbst mit Bill Clinton gesprochen hatte, und genau wie später, als Barack Obama nach dem Grundschulmassaker von Sandy Hook 2012 nun aber wirklich eine Waffenreform durchsetzen wollte. "Wir haben doch diese Diskussion nach jedem einzelnen Amoklauf. Wir müssen doch endlich mal einen Weg finden, dieses sinnlose Sterben aufzuhalten", sagt er und haut dabei auf seinen Schreibtisch.
Interessieren Sie sich für die US-Politik? Washington-Korrespondent Fabian Reinbold schreibt einen Newsletter über seine Eindrücke aus den USA und die Zeitenwende nach dem Ende der Trump-Präsidentschaft. die dann einmal pro Woche direkt in Ihrem Postfach landet.
Die letzten, die Anlauf nahmen, waren die Schüler der High School in Parkland, Florida, wo im Februar 2018 ein Ex-Schüler 14 Jugendliche und drei Lehrer erschossen hatte. Die jungen Aktivisten machten mächtig Druck. Organisierten Riesenproteste in Dutzenden Städten, spannten die Medien für sich ein, registrierten später Wähler, um die Kraftverhältnisse ins Wanken zu bringen. Da protestierte die Generation, die schon in der Grundschule immer wieder eine Stunde lang still unter dem Tisch ausharren musste, um das Verhalten bei einem Amoklauf zu trainieren.
Auch sie haben Amerikas Waffenpolitik nicht wenden können.
Es ist nicht so, dass es gar keine Regeln gäbe für Waffen, doch alle regeln ein bisschen und keine so richtig. Wegen zahlreicher Schlupflöcher können auch als gewalttätig oder psychisch krank aufgefallene Menschen immer wieder Waffen im Militärstil kaufen: wenn nicht im Waffenladen, dann auf einer der zahllosen, kaum kontrollierten Gun Shows.
Nach dem Parkland-Massaker wollten einige Städte im Land nicht mehr auf den Bundesstaat oder Washington warten und verboten eigenmächtig halbautomatische Sturmgewehre vom Typ AR-15. Es sind die Waffen, die meist für diese Shootings benutzt werden.
Dagegen setzte es prompt Klagen und eine Stadt musste Anfang des Monats ihr Verbot zurücknehmen. Diese Stadt heißt, vielleicht ahnen Sie es schon: Boulder, Colorado. Gut zehn Tage später marschierte dann ein 21-Jähriger mit einer ähnlichen Waffe dort in den Supermarkt.