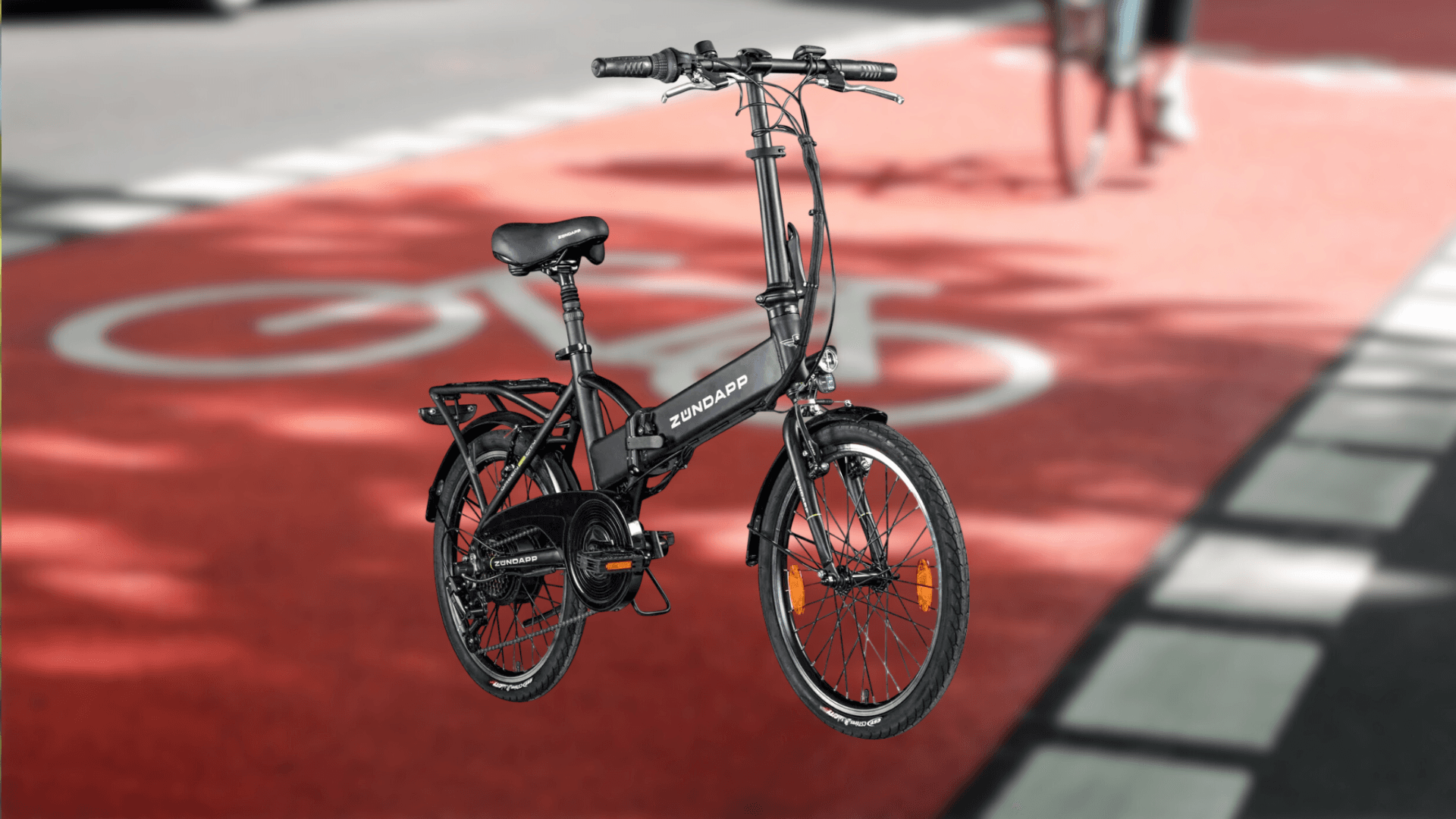Der Gesprächspartner muss auf jede unserer Fragen antworten. Anschließend bekommt er seine Antworten vorgelegt und kann sie autorisieren.
Zum journalistischen Leitbild von t-online.VdK-Präsidentin zur Rente "Das passt nicht zusammen"


Union und SPD wollen die Mütterrente ausweiten – und entfachen damit eine alte Debatte neu. Kritiker sprechen von einer teuren Wohltat, VdK-Präsidentin Verena Bentele sieht das anders – knüpft ihre Zustimmung aber an Bedingungen.
Millionen Mütter, deren Kinder vor 1992 geboren wurden, sollen künftig mehr Rente bekommen. Die sogenannte Mütterrente soll auch für diese Mütter aufgestockt werden – von derzeit 2,5 auf 3 Entgeltpunkte pro Kind (mehr dazu hier). Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbands VdK, begrüßt das. Für sie geht es um Respekt, Anerkennung und Gerechtigkeit gegenüber einer Generation, die viel geleistet habe.
Doch die Kritik ist groß: Ökonomen warnen vor Milliardenkosten, fehlender Zielgenauigkeit und verpassten Chancen für echte Reformen. Auch Studien zeigen: Die Mütterrente lindert zwar Altersarmut, löst das Problem aber nicht dauerhaft. Auch Bentele hält nicht alles an dem Vorhaben von Schwarz-Rot für klug.
Im Interview mit t-online erklärt sie, wie sie die Mütterrente finanzieren würde, wie man die Rente generell gerechter gestalten könnte – und welche Reform zusätzlich kommen muss, damit die Verbesserungen auch bei den Frauen ankommen, die sie besonders nötig haben.
t-online: Frau Bentele, Union und SPD wollen die Mütterrente ausbauen. Viele sprechen von einem teuren Wahlgeschenk, Sie halten es für längst überfällig – warum?
Verena Bentele: Weil es um einen Ausgleich jahrzehntelanger struktureller Benachteiligung geht. Frauen, die vor 1992 Kinder bekommen haben, hatten kaum Möglichkeiten, Familie und Beruf zu vereinen. Es fehlte noch mehr als heute an Betreuungsplätzen, und das Rollenbild war stark darauf ausgerichtet, dass der Mann das Geld erwirtschaftet und die Frau die Kinder erzieht. Viele dieser Frauen konnten nicht arbeiten – oder nur in Teilzeit, zu schlechten Bedingungen. Die Folgen sehen wir heute: Altersarmut ist vor allem ein "weibliches Problem". Es ist höchste Zeit, etwas zu tun.
Gegner sagen: Die Ausweitung der Mütterrente hat keine steuernde Wirkung, da sie an Menschen gezahlt wird, deren Kinder längst erwachsen sind. Wäre es nicht sinnvoller, stärker in Kitas, Ganztagsschulen und bessere Arbeitsbedingungen für Mütter zu investieren, um die Rentenlücke von Frauen zu schließen?
Wir müssen beides tun. Einerseits gilt es, heutige Mütter zu unterstützen – mit flächendeckender Kinderbetreuung, mehr Pflegeangeboten und besseren Jobbedingungen. Andererseits dürfen wir nicht vergessen: Die Rentenlücke entsteht durch Entscheidungen, die auf strukturellen Nachteilen beruhen. Wer damals nicht arbeiten konnte, soll dafür heute nicht bestraft werden.
Was ist die Mütterrente?
Die Mütterrente gibt es seit dem 1. Januar 2014. Sie ist keine eigenständige Rente, sondern erhöht die Rente von Menschen, die vor 1992 geborene Kinder erzogen haben. Das betrifft besonders Mütter, da sie historisch gesehen häufiger die Kindererziehung übernommen haben. Seit 2014 wurden bis zu zwei Jahre Erziehungszeit pro Kind anerkannt, also bis zu zwei Rentenpunkte gutgeschrieben (Mütterrente I). Zuvor war ab 1986 nur ein Rentenpunkt pro Kind drin. 2019 folgte eine zweite Verbesserung: Seitdem werden bis zu 2,5 Rentenpunkte pro Kind anerkannt (Mütterrente II). Für seit 1992 geborene Kinder gibt es schon seit 1992 bis zu drei Rentenpunkte. Die nun geplante Mütterrente III soll drei Rentenpunkte für alle bringen. Lesen Sie hier, was Rentenpunkte mit Ihrer späteren Rente zu tun haben.
Heutige Mütter bekommen drei Rentenpunkte pro Kind und Elterngeld, wenn sie nicht arbeiten. Daneben wird in Kitas und Betreuung investiert, damit die Mütter schneller wieder arbeiten. Ist diese doppelte Förderung nicht unlogisch?
Das wäre nur dann unlogisch, wenn wir in einer idealen Welt leben würden. Aber wir haben auch heute weder genügend Kitas noch ausreichend Pflegeplätze. Sorgearbeit ist nach wie vor systemrelevant. Wenn wir wollen, dass mehr Menschen arbeiten, müssen wir ihnen die Rahmenbedingungen dafür bieten. Und gleichzeitig müssen wir anerkennen, dass unbezahlte Care-Arbeit eine gesellschaftliche Leistung ist.
Sie sind dafür, die Mütterrente komplett aus Steuermitteln zu finanzieren, statt die Kosten allein den Beitragszahlern aufzubürden. Warum?
Wir fänden es grundlegend ungerecht, wenn die Mütterrente aus Beitragsmitteln der gesetzlichen Rentenversicherung gezahlt werden würde. Denn die Erziehungsleistung kommt der gesamten Gesellschaft zugute – auch Beamten, Selbstständigen und Gutverdienenden, die nicht einzahlen. Es gibt aber noch ein Problem mit den bisherigen Plänen.
Nämlich?
Die Mütterrente kommt ausgerechnet bei den Frauen nicht an, die sie am dringendsten bräuchten. Denn viele von ihnen müssen ihre kleinen Renten mit Grundsicherung aufstocken. Und dort wird die Mütterrente unter Umständen voll angerechnet. Nur wer auf mindestens 33 Beitragsjahre kommt, profitiert von einem Freibetrag bei der Grundsicherung. Das schaffen viele Frauen aber nicht. Die höhere Mütterrente würde bei ihnen also dazu führen, dass die Grundsicherung sinkt. Wer Altersarmut verhindern will, muss diesen Freibetrag ausweiten.
Freibetrag bei der Grundsicherung
Seit 2021 können Rentnerinnen und Rentner, die mindestens 33 Jahre an sogenannten Grundrentenzeiten nachweisen können, einen zusätzlichen Freibetrag bei der Grundsicherung geltend machen. Dieser liegt aktuell bei 281,50 Euro monatlich. Bis zu diesem Betrag wird die Rente nicht auf die Grundsicherung angerechnet.
Immerhin knapp zehn Millionen Renten würden durch die reformierte Mütterrente steigen – doch auch die Kosten sind mit 4,45 Milliarden Euro jährlich hoch. Ist das noch verantwortbar in Zeiten, in denen an anderen Stellen gespart werden muss?
Wenn man will, findet man Mittel. Subventionen wie etwa bei E-Autos sollten nicht für alle gleich hoch, sondern sozial gestaffelt sein. Und: Der Staat hat Spielräume – zum Beispiel durch eine gerechtere Besteuerung von Vermögen, Kapitalerträgen oder großen Erbschaften. Wir haben ausgerechnet, dass man so jährlich bis zu 100 Milliarden Euro einnehmen könnte.
Von einer Vermögensteuer hält die Union ja nun gar nichts. Glauben Sie wirklich, dass eine solche Reform politisch durchsetzbar ist?
Ehrlich gesagt: Meine Hoffnung ist begrenzt. Obwohl es unter allen CDU-Kanzlern außer Angela Merkel eine Vermögensteuer gab. Friedrich Merz wäre also in guter Gesellschaft. Stattdessen ist viel von Leistungsgesellschaft die Rede – aber statt jetzt starke Schultern, wie diejenigen mit großen Vermögen und hohen Erbschaften, mehr tragen zu lassen, soll beim Bürgergeld, und damit an Qualifizierungsmaßnahmen für Arbeitssuchende, gekürzt werden. Das passt nicht zusammen.
Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer hatte vor einiger Zeit vorgeschlagen, innerhalb der Rentenversicherung umzuverteilen – etwa indem kleinere Renten bei der jährlichen Rentenanpassung stärker steigen als hohe. Was halten Sie von der Idee?
Über solche Modelle sollten wir sprechen. In der Schweiz gibt es zum Beispiel eine Deckelung der Auszahlungen. Denkbar wäre auch, Arbeitgeberbeiträge zu erhöhen oder den Kreis der Versicherten zu erweitern. Die Einbeziehung von Selbstständigen und Beamten in die gesetzliche Rente ist überfällig. Genauso wie eine höhere Beitragsbemessungsgrenze, damit auch Gutverdienende stärker in die Pflicht genommen werden.
Ökonomen fordern immer wieder eine weitere Erhöhung des Renteneintrittsalters. Was spricht eigentlich für die heute 30- oder 40-Jährigen dagegen? Immerhin leben wir statistisch gesehen auch länger.
Für Angestellte in Bürojobs mag das stimmen – für körperlich hart arbeitende Menschen weniger. Wer in prekären Berufen tätig ist, hat oft eine geringere Lebenserwartung. Es gibt heute schon viele Menschen, die die Regelaltersgrenze aus gesundheitlichen Gründen nicht erreichen und Abstriche bei ihrer Rente machen müssen. Wer pauschal fordert, das Renteneintrittsalter zu erhöhen, fordert eine versteckte Umverteilung von unten nach oben.
- Lesen Sie auch: Welche Jahrgänge dürfen noch vor 67 in Rente gehen?
Also lieber freiwillig länger arbeiten und die steuerfreie Aktivrente der Union nutzen?
Wer freiwillig länger arbeiten möchte, soll das gerne tun. Aber ich bezweifle, dass man die Bedingungen dafür noch mal verbessern muss. Denn wir wissen genau, wem das hilft: Eher den gut verdienenden Akademikern als denen, die im Schichtbetrieb schuften. Kaum jemand will mit 75 noch die Nacht durcharbeiten.
Unklar ist, wie es mit dem Rentenniveau weitergeht. Zum 30. Juni läuft die gesetzliche Haltelinie von 48 Prozent aus. Die SPD will sie fortführen, die Union setzt auf Wirtschaftswachstum, um das Rentenniveau stabil zu halten. Wer sollte sich Ihrer Ansicht nach in den Koalitionsgesprächen durchsetzen?
Wir sind nicht dafür, das Rentenniveau vom Wirtschaftswachstum abhängig zu machen. Das birgt das Risiko eines schleichenden Kaufkraftverlustes bei den Renten. Es sollte weiter gesetzlich fixiert werden – und das nicht bloß bei 48 Prozent. Wir fordern eine Erhöhung auf 53 Prozent, damit die Rente für alltägliche Ausgaben auch bei denen reicht, die nicht privat vorsorgen konnten und keine Betriebsrente erhalten.
- Lesen Sie auch: Rentenniveau bei 48 Prozent – was bedeutet das?
Schon ein Rentenniveau von 48 Prozent könnte bis 2045 in etwa so viel kosten wie das Sondervermögen für Infrastruktur – rund 500 Milliarden Euro. Wer soll das bezahlen?
Wenn wir den Mut für gerechte Steuerreformen aufbringen würden, wäre das in wenigen Jahren finanziert. Es ist eine Frage des politischen Willens. Außerdem hat sich die Rentenversicherung trotz aller Krisen in der Vergangenheit als sehr stabil erwiesen. Die düsteren Prognosen zur Finanzlage sind dank Zuwanderung und mehr sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nicht eingetroffen.
Frau Bentele, vielen Dank für das Gespräch.
- Gespräch mit VdK-Präsidentin Verena Bentele