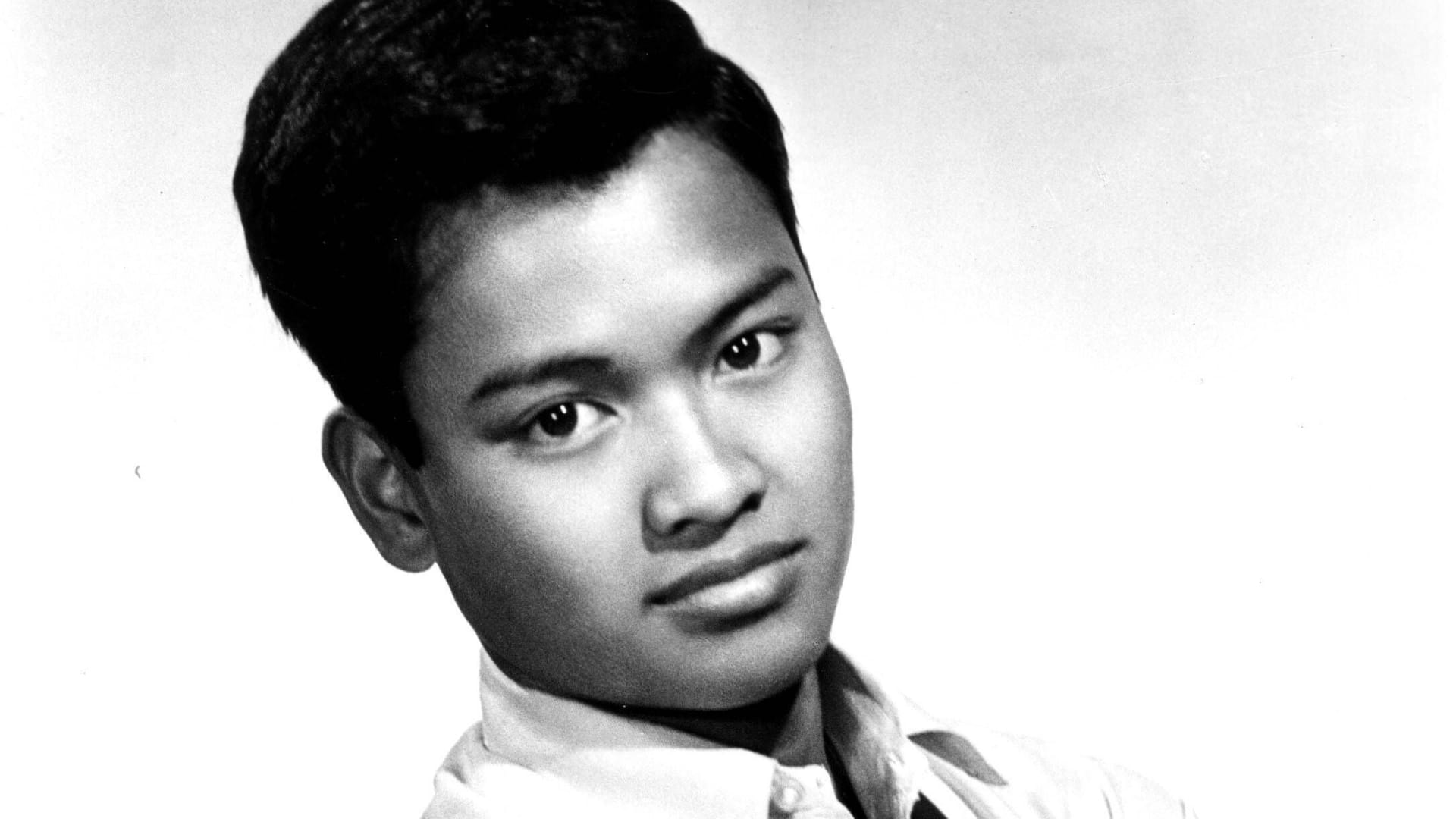Mehr als 150 Journalistinnen und Journalisten berichten rund um die Uhr für Sie über das Geschehen in Deutschland und der Welt.
Zum journalistischen Leitbild von t-online.Fifa-Präsident Infantino Er pfeift darauf


Die Fußball-WM war auch die große Show des Gianni Infantino. Dass sie in Deutschland über ihn den Kopf schütteln, juckt den Fifa-Präsidenten längst nicht mehr.
Er wollte ihn gar nicht mehr loslassen. Wer kann es ihm verübeln? Wann hat man den vielleicht besten Fußballer aller Zeiten schon so nah, so selig vor sich stehen? Gianni Infantino ließ einfach nicht ab von Lionel Messi. Auch nicht, als er seiner Aufgabe als Präsident des Fußball-Weltverbands Fifa nachgekommen war und dem Argentinier, der mit einer Leistung für die Ewigkeit sein Team zum Weltmeistertitel geführt hatte, den Pokal überreicht hatte. Er legte seinen Arm um die Schulter Messis, zog ihn zurück an seine Brust, redete auf ihn ein. Immer und immer wieder. Wohl auch, weil Infantino um die Einmaligkeit des Moments wusste: So viele Blicke werden vielleicht nie wieder auf ihn gerichtet sein, gerichtet sein müssen. Dass er Messi damit – in Zusammenarbeit mit dem keineswegs weniger aufdringlichen katarischen Emir Tamim bin Hamad Al Thani – der spontanen, naiven Freude im größten Moment seiner Karriere beraubte: geschenkt.
Es war der unrühmliche Endpunkt der großen Gianni-Infantino-Show. Einer vierwöchigen Aneinanderreihung von fragwürdigen Pressekonferenzen, gestellten Fotos und dem unablässigen Sonnen im Glanz großer Namen. Infantino, wenn man so will, hat sich in Katar auch selbst zum Weltmeister gekürt. Zum Weltmeister der Selbstdarsteller. Da stellt sich zwangsläufig die Frage: Was soll darauf noch folgen?
Infantino hat sich die Fußballelite in Katar endgültig zu seinen Gunsten zurechtgelegt. Im Golfstaat präsentierte sich der Schweizer als großer Versteher der arabischen Welt und als ihr Werber – dass er dieser Rolle durch seine sehr guten Arabischkenntnisse, die auch aus seiner Ehe mit einer Libanesin resultieren, gerecht wurde, trug nur weiter zu seiner Glaubwürdigkeit in diesen Ländern bei. Ein Image, von dem er ganz konkret profitiert.
Ein Land, eine Stimme: Auf diesem Prinzip basiert Infantinos Macht
Im kommenden Jahr stehen die nächsten Wahlen bei der Fifa an, Infantino plant seinen Verbleib im Präsidentschaftsamt – auch, weil es keinen Gegenkandidaten gibt. Dies liegt wiederum daran, dass es bei der Fifa keine Verhältniswahlen gibt, sondern jedes Land – egal wie klein und unbedeutend im Weltfußball – eine Stimme besitzt. Infantino macht seit Jahren keinen Hehl daraus, dass er auf die Anerkennung der sogenannten westlichen Staaten pfeift. Für jedes Deutschland, das sich über ihn echauffiert, findet Infantino ein Katar, das er mit seiner Aufmerksamkeit zu becircen weiß. Auch deshalb trauen sich viele mögliche Kandidaten gar nicht erst, öffentlich gegen Infantino in den Wahlkampf zu ziehen – weil sie wissen, dass sie gegen ihn nie gewinnen könnten.
Dabei ist Infantinos Kuhhandel, der ihm seine bombenfeste Machtposition sichert, recht simpel: Ländern, die ihm Geld bieten – in Form von Verträgen aller Art, sowohl persönlich als auch mit der Fifa –, schenkt er Aufmerksamkeit. Hier ein Hinweis auf die vortreffliche Entwicklung der sportinfrastrukturellen Lage, da ein Fifa-Botschafter, der für eine hohe Gage eine unbedeutende Partie verfolgt und in der VIP-Loge für Selfies bereitsteht, vielleicht auch mal ein Hinweis an einen Klubfunktionär, das kommende Wintertrainingslager vielleicht besser hier und dort statt in Malente oder Duisburg-Wedau zu verbringen. Kurzum: Infantino versteht das Einmaleins des sogenannten "Sportswashing" wie kein Zweiter.
Die mit dem Titel für Messis Argentinier beschlossene WM – die noch vor seiner ersten Amtszeit als Präsident nach Katar vergeben worden war – ist insofern Infantinos Meisterstück gewesen. Eine glänzendere, geschliffenere, kantenlosere Inszenierung als im strikt regulierten Emirat wird es wohl nie wieder geben. Wohl vor allem nicht in vier Jahren. Dann baut der Fifa-WM-Zirkus seine Zelte in gleich drei demokratischen Staaten auf: Kanada, den USA und Mexiko. Schon nur, weil die Distanz zwischen den einzelnen Spielorten so absurd gigantisch ist im Vergleich zum Turnier der kurzen Wege in Doha und Umgebung.
Die beiden 2026er-Gastgeberstädte Vancouver und Mexiko-Stadt etwa trennen rund 4.800 Kilometer Luftlinie, zwischen den beiden US-amerikanischen Metropolen Los Angeles und New York liegen 4.500 Kilometer. Diese Dimensionen machen es Infantino ziemlich sicher unmöglich, bei jedem WM-Spiel persönlich im Stadion anwesend zu sein, wie es in Katar der Fall war. Dadurch sinkt sein direkter Zugriff auf die Inszenierung des Events und seines Egos dramatisch.
Bleibt es wirklich nur bei drei Amtszeiten?
Und auch politisch dürfte Infantino nicht eine solche Rückendeckung erfahren wie die vergangenen vier Wochen in Katar. In Nord- und Mittelamerika werden ihm – aller Voraussicht nach – keine Autokraten den roten Teppich ausrollen, sondern es werden sich kritische Stimmen in den VIP-Logen und Hotellobbys zu Wort melden, die konfrontative Diskussionen statt kuscheligem Smalltalk suchen dürften.
Ob diese Aussichten Infantino bereits in Schwitzen geraten lassen? Vermutlich nicht. Dafür ist sich der Schweizer seiner selbst einfach zu sicher. Seine Macht dürfte nämlich auch 2026 bombenfest sein, dafür sorgte er erst kürzlich mit einer durchgepeitschten Änderung der Fifa-Richtlinien: Seine erste Amtszeit (2016 bis 2019) wird künftig nicht als solche gezählt, da er de facto nur die seines Vorgängers Sepp Blatter "vervollständigt" hat. Damit sicherte sich Infantino die Möglichkeit, den Weltverband bis 2031 zu führen – dem Ende einer, nach seiner eigenen und nun offiziellen Fifa-Rechnung, dritten Amtszeit. Zudem verschafft er sich damit drei Jahre mehr Zeit, neue Statutenänderungen zu erarbeiten, die ihm auch eine vierte, fünfte, vielleicht ja sogar sechste Periode als Präsident zusichern.
Was für viele Fußballfans hierzulande wie ein Horrorszenario klingen mag, dürfte für Infantino durchaus seinen Reiz haben. Auf Zuspruch aus Deutschland würde er ohnehin nicht viel geben. Er hat schließlich seine Freunde in Katar und Co.