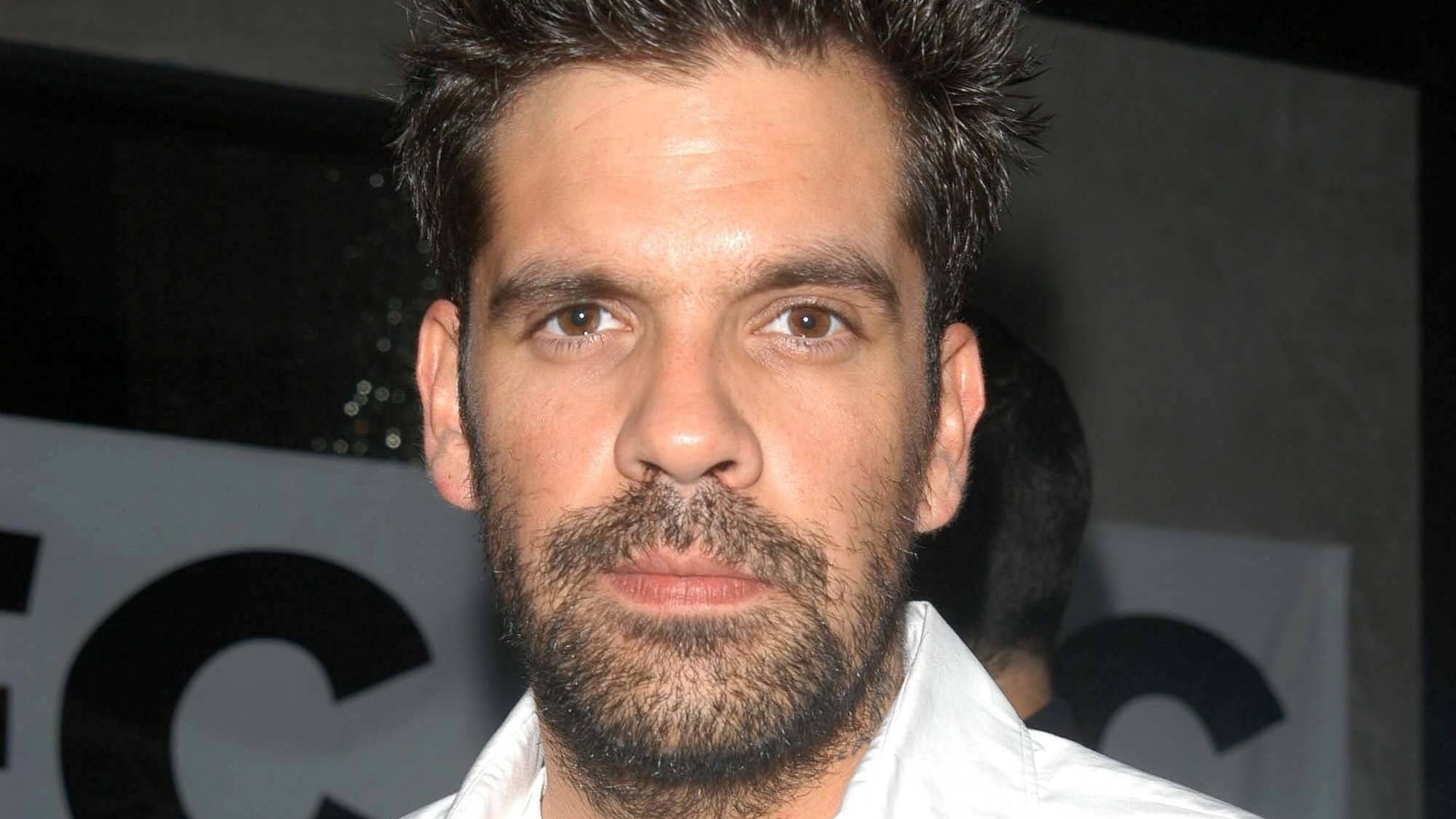Energiewende Höchstspannung: A-Nord soll Windstrom in Süden bringen


In Deutschland werden in den nächsten Jahren für viele Milliarden neue Stromtrassen gebaut. Mal in der Erde, mal an Masten. Sie sollen vor allem Grünstrom transportieren. Wer bezahlt das eigentlich?
Was braucht es, um grünen Windstrom aus der Nordsee nach Baden-Württemberg zu bringen? Vor allem lange, dicke Leitungen. Die werden gerade gebaut und zwar im sogenannten A-Korridor ziemlich weit im Westen Deutschlands. Der nördliche Teil wird A-Nord genannt, der südliche Ultranet - der Strom ist der gleiche.
Die Leitungen nicht. A-Nord (305 Kilometer) wird als oberschenkeldickes Erdkabel verlegt, Ultranet (340 Kilometer) als Freileitung über bestehende Masten geführt. Federführend ist der Übertragungsnetzbetreiber Amprion, in Baden-Württemberg mischt auch TransnetBW mit. Ultranet (Kosten: rund eine Milliarde Euro) soll 2026 fertig werden, A-Nord 2027 (Kosten: rund drei Milliarden Euro).
Zwischen A-Nord und Ultranet steht eine Riesen-Steckdose
Als eine Art Steckdose, damit auch Nordrhein-Westfalen etwas von dem Gleichstrom abbekommt, dient eine Konverterstation in Meerbusch bei Düsseldorf. Sie bildet gleichzeitig die Schnittstelle der beiden Leitungsprojekte. Es soll übrigens nicht nur Windstrom in den Süden fließen: Ultranet soll auch Sonnenstrom aus Baden-Württemberg nach Nordrhein-Westfalen bringen.
Die Arbeiten sind in vollem Gange. "Korridor A wird der erste deutschlandweite Windstrom-Korridor", erklärt eine Projektsprecherin. Und der soll ordentlich was können: "A-Nord kann eine Leistung von zwei Gigawatt übertragen. Das entspricht in Summe etwa dem Bedarf von zwei Millionen Menschen", heißt es in einer Projektbroschüre.
Seit einigen Wochen wird für A-Nord auch in Nordrhein-Westfalen gebuddelt. Grund genug für Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU), am Freitag im münsterländischen Rhede einen symbolischen Spatenstich zu setzen.
Kabelschutzrohre liegen zwei Meter tief in der Erde
Ansonsten kommt vor allem schweres Gerät zum Einsatz - ein Erdkabel verlegt man nicht mal eben so. Nach einer jahrelangen Planung werden eines Tages im Abstand von einigen Metern zwei parallele Kabelgräben ausgehoben, jeder rund fünfeinhalb Meter breit. In sie werden dann jeweils drei leere Kabelschutzrohre gelegt, etwa zwei Meter tief. Jedes Rohr mit einem Durchmesser von rund 25 Zentimetern. Die eigentlichen Kabel werden erst später in die Leerrohre eingezogen.
Gebaut wird an vielen Stellen gleichzeitig: So wird beispielsweise in Niedersachsen gerade an der Ems-Unterquerung gearbeitet. Am Niederrhein arbeitet man schon an der Rhein-Querung. Dort soll das Kabel allerdings nicht unter dem Fluss entlanglaufen, sondern in einen Kabelgraben im Flussbett gelegt werden.
Doch was hat ein Hightech-Erdkabel im Münsterland mit wirklich jedem Stromverbraucher in Deutschland zu tun? Mehr als man denkt. Denn über die Stromrechnung werden alle neue Kabel und alle anderen Kosten des Strom-Überlandtransports von allen Verbraucherinnen und Verbrauchern bezahlt.
"Netzentgelte" auf der Stromrechnung: Was sich dahinter verbirgt
Neben den Kosten für die sogenannten Stromautobahnen, die das Höchstspannungs-Übertragungsnetz bilden, landen auch die Gebühren für das Verteilnetz, also alle anderen Spannungsebenen, auf der Rechnung - zusammengefasst unter dem Posten "Netzentgelte".
Von dem Preis für jede Kilowattstunde entfällt derzeit ein gutes Viertel (27,5 Prozent) auf diese Gebühren, die für Netz-Erhalt, -Ausbau und Stabilität erhoben werden. 2015 lag der Anteil noch bei 21,3 Prozent.
Im März zahlten die Haushalte in Deutschland laut Energiewirtschaftsverband BDEW für Strom im Schnitt 39,80 Cent je Kilowattstunde. 10,96 Cent davon waren für die Netze. Laut Umweltbundesamt gehen davon rund 70 Prozent an den jeweiligen Verteilnetzbetreiber, die übrigen rund 30 Prozent an den Übertragungsnetzbetreiber.
In Deutschland gibt es davon vier: 50Hertz ist für die Leitungen in Ostdeutschland zuständig, Amprion für Westdeutschland und einen Teil Bayerns, TransnetBW für Baden-Württemberg und Tennet für alle übrigen Bundesländer von Schleswig-Holstein über Niedersachsen und Hessen bis Bayern.
Eon ist größter Verteilnetzbetreiber
Knapp 870 Unternehmen betreiben Verteilnetze. Größter Betreiber ist der Energiekonzern Eon, der über seine Tochtergesellschaften für knapp ein Drittel aller Verteilnetz-Leitungen in Deutschland zuständig ist.
Damit Deutschland eines Tages klimaneutral werden kann, muss das Stromnetz kräftig ausgebaut werden. Die Netzkosten sind bereits gestiegen, auch durch Maßnahmen zur Netzstabilisierung bei zu viel Wind- und Sonneneinspeisung. Am Ende landen momentan alle Kosten bei den Verbrauchern.
Koalition will Netzentgelte senken und setzt auf Freileitungen
Die neue Regierungskoalition will jedoch für Entlastungen beim Strompreis sorgen. Eine Maßnahme soll dabei auch eine Reduktion der Netzentgelte sein. Außerdem wollen Union und SPD die Netzentgelte dauerhaft deckeln, "um Planungssicherheit zu schaffen", heißt es im Koalitionsvertrag. Wie das alles aussehen soll und wann es kommt, wurde allerdings noch nicht bekannt.
Die Kosten hat die Koalition auch an anderer Stelle im Blick: Union und SPD haben sich in ihrem Koalitionsvertrag darauf verständigt, Ausbau und Modernisierung der Netze "kosteneffizient" voranzubringen. Hintergrund ist, dass Gleichstrom-Erdkabel teurer sind als Gleichstrom-Freileitungen. Neu zu planende Hochspannungs-Gleichstrom-Leitungen sollen daher, "wo möglich, als Freileitungen umgesetzt werden", heißt es. Dabei werde man besonders belastete Regionen berücksichtigen.
Überhaupt soll die Ausbauplanung nochmal auf den Prüfstand: "Den nach einer Bestandsaufnahme notwendigen verbleibenden Ausbau wollen wir weiter beschleunigen", heißt es weiter. Der Erdkabelvorrang war Ende 2015 gesetzlich verankert worden. Vorher hatten Freileitungen den Vorrang.
- Nachrichtenagentur dpa