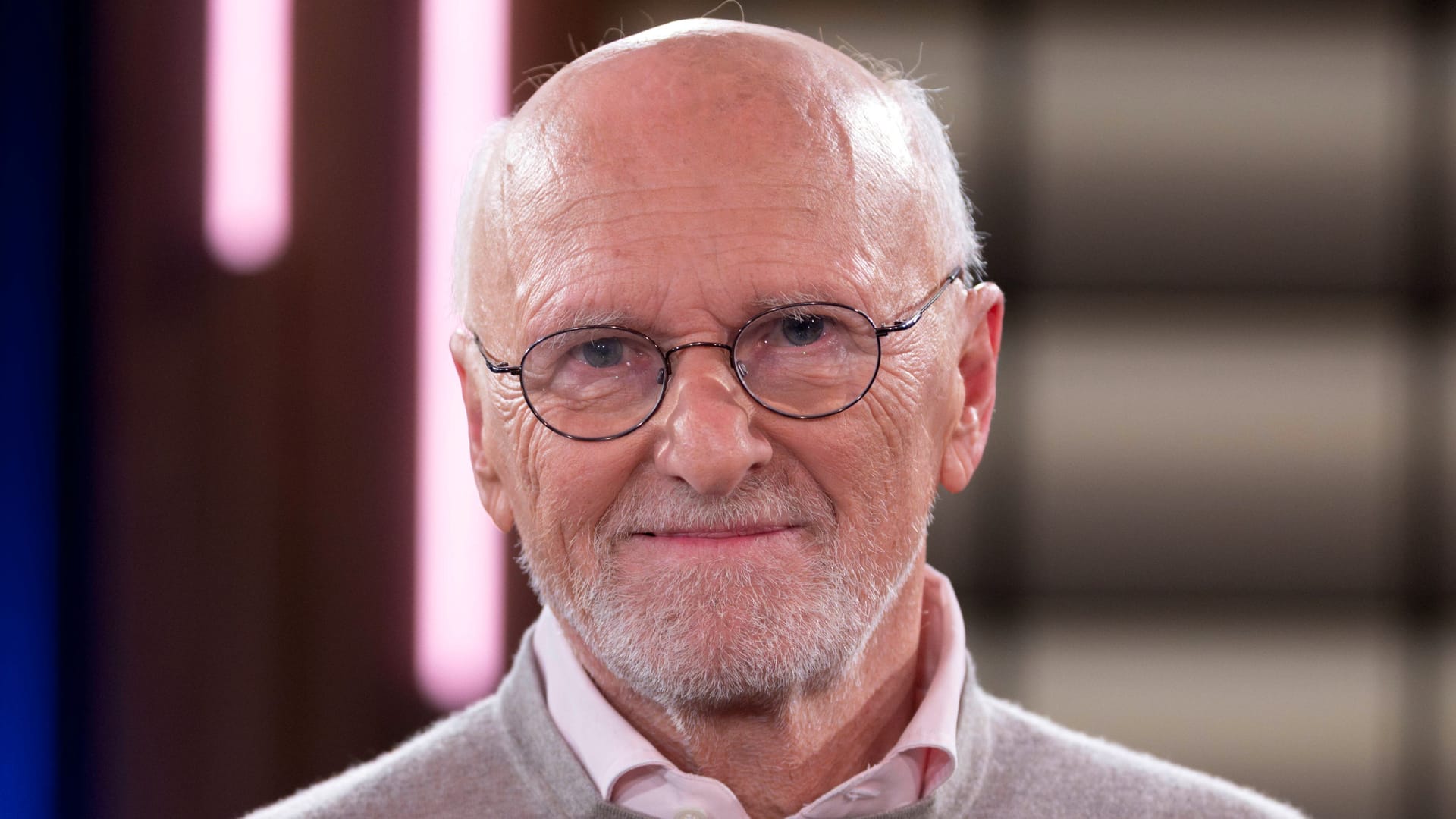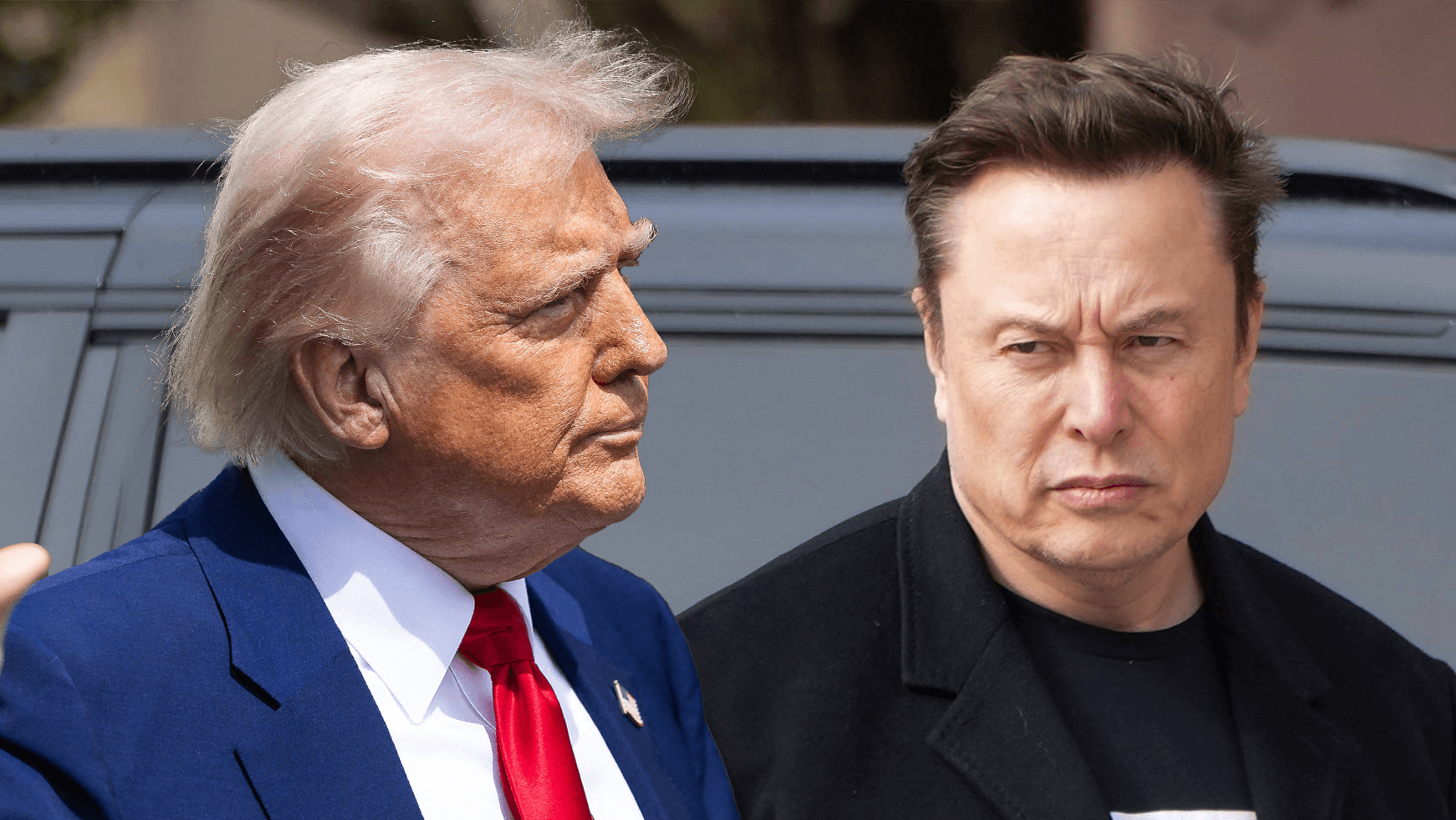Mehr als 150 Journalistinnen und Journalisten berichten rund um die Uhr für Sie über das Geschehen in Deutschland und der Welt.
Zum journalistischen Leitbild von t-online.Debatte nach Silvesterkrawallen Was läuft da eigentlich schief?


Seit den Silvesterkrawallen diskutiert Deutschland über Integration. Mal wieder. Denn in der Vergangenheit wurde oft viel geredet – und wenig gehandelt. Dabei geht es besser.
Cordula Heckmann würde das natürlich nie so sagen, dafür ist sie viel zu bescheiden. "Nein, so sehe ich das überhaupt nicht", antwortet die 64-Jährige auf die Frage, ob sie eine der erfolgreichsten Schulleiterinnen Deutschlands ist. "Wir machen unsere Arbeit hier gut, aber es könnte immer noch besser laufen."
Dabei spricht eine Menge dafür, dass Heckmann keine Rektorin wie viele andere ist. Denn sie leitet die Rütli-Schule im Berliner Bezirk Neukölln.
2006 machte die "Problemschule" als Beispiel für gescheiterte Integration in ganz Deutschland Schlagzeilen. Die Stimmung in einigen Klassen sei geprägt von "Aggressivität, Respektlosigkeit und Ignoranz uns Erwachsenen gegenüber", hieß es damals in einem Brandbrief. "Einige Kollegen/innen gehen nur noch mit dem Handy in bestimmte Klassen, damit sie über Funk Hilfe holen können."
Was die Lehrerinnen und Lehrer vor 15 Jahren berichteten, war im Kern ähnlich wie das, was Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte aus der jüngsten Silvesternacht beklagen. Doch die Rütli-Schule hat sich inzwischen zu einer Vorzeigeeinrichtung gemausert. Es gibt mehr Anmeldungen als Plätze. 1.000 Schüler werden auf einem großzügigen, freundlichen Campus unterrichtet. Man begegnet sich respektvoll, Gewalt ist kaum noch ein Thema.
Heckmann und ihre Kolleginnen und Kollegen haben längst die Wende geschafft, von der nach den Silvesterkrawallen wieder so viel die Rede ist.
Wer die Schulleiterin in ihrem schlichten Büro nach den Gründen für das Wunder von Neukölln fragt, dem erklärt sie erst einmal, woran die aktuelle Debatte krankt: "Es wird sehr stark über härtere Strafen diskutiert." Das sei aber zu simpel. "Was passiert denn sonst? Was wird zur Prävention unternommen?", fragt sie. Auf diesem Gebiet geschehe oft wenig, vor allem wenig Nachhaltiges. "Für die Jugendlichen fühlt es sich so an: Sie sind nur Thema, wenn es knallt."
Der Schock sitzt tief
Geknallt hat es zum Jahreswechsel auch in Neukölln. Und zwar nicht zu knapp: Jugendliche und junge Männer randalierten und griffen mit Böllern, Raketen und Schreckschusspistolen gezielt Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr an. Zum Teil errichteten sie Barrikaden und lockten Einsatzkräfte in Hinterhalte. Von einem Ausmaß nie dagewesener Gewalt, einer völlig neuen Dimension sprechen Feuerwehr, Polizei und Politik. Der Schock sitzt tief.
Aber Neukölln war eben nur einer von vielen Schauplätzen. In Sachsen randalierten Rechtsextreme, auch in eher beschaulichen Städten wie Hannover oder Essen gab es Gewalt. Wo was passierte, soll weitgehend transparent aufgearbeitet werden. Denn die Devise fast aller Politiker lautet "Bloß nichts unter den Tisch kehren". Niemand will sich vorwerfen lassen, Probleme aus Gründen der politischen Korrektheit zu verschweigen.
Deswegen führt Deutschland zu Beginn des Jahres die große Integrationsdebatte: Warum fühlen sich so viele Menschen nicht zugehörig? Warum hassen sie den Staat und seine Vertreter? Und natürlich machen auch wieder allerlei Vorschläge die Runde: Sie reichen von "Mehr Sozialarbeiter" bis zu "Mehr Abschiebungen".
Es ist ein wenig so wie Anfang 2016, nach der Kölner Silvesternacht. Denn sich im Kreis zu drehen, ist durchaus typisch für Integrationsdebatten in Deutschland. Genauso beliebt ist die Methode, alle Gewalttäter zusammenzurühren – von den Rechtsextremen, deren Urgroßeltern noch das Deutsche Reich erlebten über die Kinder, deren Eltern schon nach Deutschland eingewandert sind, bis hin zu den Flüchtlingen, die 2015 oder erst vor wenigen Monaten hierherkamen.
Für solche Vereinfachungen sind die Probleme zu vielfältig und die Ursachen zu komplex. Entsprechend existiert bei einem so vielschichtigen Thema wie der Frage nach einer erfolgreicheren Integration auch nicht die eine Patentlösung. Es braucht unzählige Ansätze, von den Schulen und Kitas bis zur Justiz.
"Das Gefühl, dass wir an sie glauben"
Aber das Beispiel der Rütli-Schule zeigt auch, dass sich Dinge ändern können – und zwar zum Besseren. Man darf eben nicht nur reden, sondern muss auch handeln. Was also kann man tun?
Fragt man Heckmann nach ihrem Geheimrezept, antwortet die Schulleiterin erst einmal mit einem Leitsatz der Rütli-Philosophie: "Nicht auf die Defizite schauen, sondern auf die Potenziale. Die Schüler brauchen das Gefühl, dass wir an sie glauben." Außerdem sei die Umstellung hin zur Ganztagsschule zentral gewesen – nur die schaffe den Raum, über den ohnehin dicht getakteten Lehrplan hinaus Werte zu vermitteln.
"Soziales Lernen" und "Glauben und Zweifeln" heißen die Kurse, die an der Rütli-Schule nachmittags angeboten werden. Es gibt Sprachkurse für Arabisch und Türkisch, in denen ausschließlich Muttersprachler lernen und Zertifikate erwerben können. Externe Träger laden zu Projekten gegen Antisemitismus, Reisen nach Israel und zur frühzeitigen Vernetzung für den Berufsstart ein. Eine Angestellte, die drei der zentralen Fremdsprachen spricht, kümmert sich nur um die Kommunikation mit den Eltern. Heckmann nennt sie "Brückenbauerin", in sprachlicher wie kultureller Sicht.
Ein Gebäude ist zu marode, um es zu nutzen
Was nach einem Brennpunkt-Paradies klingt, ist allerdings hart und mit viel Eigeninitiative der Lehrkräfte erarbeitet – und kämpft mit den gleichen Problemen wie andere Schulen auch: Es fehlt an Lehrern, es fehlt an Platz. Ein Hauptgebäude ist so marode, dass es nicht benutzt werden darf. Die Schüler wurden verteilt, nun ist es in den anderen Gebäuden noch enger.
Die Berufswerkstatt, die bereits seit 2006 als zentraler Teil des Rütli-Campus geplant ist, hat aus der Politik erst gerade wieder eine Absage erhalten – vorerst sind keine Mittel da. Für Heckmann liegt hier das Grundproblem: "Oft sagen Politiker in solchen Debatten: Die Schulen müssen es regeln." Zwar sieht sie das ähnlich, schließlich sei die Schule neben dem Gefängnis der einzige Ort, an dem man verpflichtend erscheinen müsse. "Damit Schulen diesen Auftrag erfüllen können, muss die Politik die Schulen und die Jugendsozialarbeit aber auch entsprechend stärken", sagt Heckmann.
Und was auch dazu gehört: Die Politik darf die Schulen nicht für Erfolge bestrafen. Das erlebt Heckmann erst gerade wieder: Weil die Rütli-Schule ihren Ruf so sehr verbessert hat, schicken immer mehr gutsituierte Eltern ihre Kinder dorthin. Eigentlich ein gutes Zeichen, ein Signal besserer Durchmischung – für Heckmann aber hat die ausgeglichenere Sozialstruktur einen Nachteil: Ihre Schule bekommt weniger Gelder vom Senat. So kann die wichtige Position der "Brückenbauerin", die mit den Eltern engen Kontakt hält, vermutlich nicht nachbesetzt werden, wenn die derzeitige Kraft demnächst in Rente geht.
Ohne bessere Schulen geht es nicht. Aber sie allein lösen das Problem nicht. Denn die Jugendlichen haben natürlich auch noch Freizeit. Und häufig wissen sie dabei nicht allzu viel mit sich anzufangen, nehmen Angebote aber dankbar an.
Wer nachts in der Halle kickt, hat keine Energie mehr für Krawall
Zum Jugendtreff "The Corner" in Neukölln kommen täglich zwischen 40 und 70 junge Menschen, viele mit palästinensischen Wurzeln. Die Leiterin Heike Hirth arbeitet seit mehr als 20 Jahren hier – und das heißt vor allem: Sie ist für die Jugendlichen einfach da, wenn sie aus der Schule kommen. Mit einigen macht die Sozialpädagogin Hausaufgaben, für andere sucht sie nach Praktikumsplätzen oder schreibt mit ihnen Bewerbungen. Und manchmal machen sie Wanderungen.
In den Wintermonaten ist es besonders schwierig. Zu wenig Platz im kleinen Jugendtreff, zu viel Energie bei den jungen Männern. Hirth kämpft dann mit ähnlichen Problemen wie die Rütli-Schule früher.
Deshalb gibt es seit ein paar Jahren Mitternachtssport im Jugendtreff. Ab 21.30 Uhr wird regelmäßig in einer Sporthalle gegeneinander Fußball gespielt. Manchmal als kleines Turnier. Hirths Überlegung: Wer sich nachts in der Halle verausgabt, hat keine Energie mehr für Krawall auf der Straße. Und das Kalkül geht immer öfter auf: "Wir merken, wie viele Jugendliche richtig dankbar für dieses Angebot sind."
"Wir hoffen immer, dass kein blöder Spruch kommt"
Gute Erlebnisse schaffen, aber vor allem nicht langweilen – das ist das implizite Motto des Treffs. Denn: "Manche Jugendliche hängen zwischen Schule und Berufseinstieg in der Luft. Und wenn sie erst mal ein Jahr aus der Schule sind, kriegt man sie kaum noch in die Ausbildung", sagt Hirth. Und: "Jugendliche mit multipler Problemlage brauchen einen 'Kick'. Den ermöglichen wir ihnen auf positive Art und Weise."
Allerdings ist das gar nicht immer so einfach. Denn die Ausgrenzung ist überall spürbar. Fahren die Mitarbeiter mit den Jugendlichen an einen See, werden häufig alle angestarrt. Das brenne sich bei den Teenagern ein. "Wir hoffen immer schon, dass kein blöder Spruch kommt", so Hirth.
Es ist bei den Reaktionen der anderen Menschen also nicht anders als bei den Verhaltensänderungen der Jugendlichen: Man ist häufig schon mit wenig Verbesserung zufrieden. Und manchmal auch damit, dass nichts schiefläuft, also zumindest nicht schlimmer wird.
Seit Jahrzehnten gebe es dasselbe Gerede, heißt es aus der Justiz
Attraktive Jugendtreffs, bessere Schulen – dagegen hat natürlich niemand etwas. Aber ab und zu reicht es eben nicht, dann ist selbst ein minimaler Fortschritt nicht erkennbar. Zumindest könnte so das Fazit lauten, wenn man sich in Berlin mit Jugendrichtern unterhält.
Man hört dann ebenfalls Kritik an der Politik. Seit Jahrzehnten gebe es bei Vorfällen das immer gleiche Gerede, so gehe es nicht weiter. Aber es ändere sich meistens wenig bis nichts. Die Justiz bleibe überlastet, die Polizei sei noch immer schlecht ausgestattet. Es ist der gleiche Sound, den auch die Schulleiterin Heckmann angestimmt hat und der auch bei der Sozialpädagogin Hirth durchklingt: Nur wenn man bestimmte Bereiche tatsächlich finanziell und personell auf Dauer stärkt, kann sich auch etwas ändern.
Manch einer, der seit Langem im Namen des Volkes Recht spricht, findet die derzeitigen politischen Debatten zwar vergleichsweise unverkrampft. Aber die Frage sei eben, was aus der Erkenntnis folge, dass auch Jugendliche existierten, die in einer männlichkeitsorientierten, gewaltbereiten Kultur sozialisiert worden seien.
Härter sein gegen die, die dem Staat auf der Nase herumtanzen
Das gilt unterm Strich nur für wenige, aber diese wenigen sorgen eben immer wieder für einen beträchtlichen Teil des Ärgers. Und für manch einen können die Angebote eben noch so wunderbar und umfangreich sein, aber man erreicht ihn nicht.
Ein Beispiel? Es war noch nie so leicht, einen Ausbildungsplatz zu bekommen, weil praktisch jeder Betrieb Nachwuchs sucht. Aber es gibt eben junge Menschen, die diese Möglichkeiten partout nicht nutzen wollen. Zum Beispiel, weil sie etwa durch Drogenhandel längst ganz ordentlich verdienen.
Tja, und dann steht wieder die Frage im Raum: Was tun? Eine Antwort aus der Praxis lautet: Gegen die Menschen, die den Staat ablehnen, ihm nur auf der Nase herumtanzen, ihn teils sogar als Beute betrachten, härter vorgehen. Konkret würde dies eine konsequentere Abschiebepraxis bedeuten. Einerseits. Und andererseits die notorisch kriminellen Jugendlichen, die deutsche Staatsbürger sind oder schon länger hier leben, entschlossener für ihre Taten zu bestrafen. Was vor allem bedeutet: schneller.
Denn auch das, hört man, sind Erfahrungen aus der Justiz: Wer als Jugendlicher erst spät für eine Tat bestraft wird, erkennt oft den direkten Zusammenhang nicht mehr. Das Urteil verpufft. Und manch einer, der nicht frühzeitig klare Grenzen aufgezeigt bekommt, setzt seine Karriere fort. Der Erziehungsgedanke steht allerdings nur im Jugendstrafrecht im Vordergrund. Aber eben nicht mehr bei Erwachsenen.
Sich um die Jugendlichen kümmern, in der Schule und danach. Und diejenigen, die notorisch Ärger machen, deutlicher in die Schranken weisen. Das sind vielversprechende Ansätze.
Ein Anruf bei dem Mann, bei dem die Stränge zusammenlaufen. Dessen Bezirk gerade mal wieder der Inbegriff für all das ist, was in diesem Land schiefläuft. Martin Hikel ist Bezirksbürgermeister von Neukölln. Der 2,08 Meter große Mann sitzt seit knapp fünf Jahren im Rathaus.
Er hat also schon einiges erlebt. Trotzdem klingt er noch angefasst, wenn er über die Silvesternacht spricht: "Neu war das Ausmaß von Gewalt, dass bewusst Rettungskräfte in einen Hinterhalt gelockt wurden. Diejenigen, die das dann filmen und ins Netz stellen, feiern sich, je krasser die Aktion ist und je mehr Klicks es bringt."
Doch ganz aussichtslos sei die Lage nicht, sagt der 36-Jährige. Er hofft, dass die jüngste Eskalation tatsächlich etwas zum Positiven verändert. Seiner Meinung nach mangelt es nicht grundsätzlich an Geld für soziale Einrichtungen. Und der Bezirk bemüht sich unter anderem, mehr Turnhallen abends offenzuhalten, damit die Jugendlichen sich dort austoben können. Der Jugendclub "The Corner" macht also längst Schule.
Doch der Staat kann es nach Überzeugung von Hikel eben auch nicht allein richten. Er setzt darauf, dass die aktuelle Diskussion dahingehend etwas bewegt, dass nun "auch private Eigentümer und Wohnungsbaugesellschaften die Notwendigkeit sehen", an soziale Einrichtungen zu vermieten. Und dann sagt Hikel noch: "Und dass wir so für etwas mehr Ruhe in den einzelnen Vierteln sorgen können.“
- Interview vor Ort in der Rütli-Schule mit Cordula Heckmann
- Telefonische Interviews mit Amtsrichtern in Berlin
- Telefonisches Interview mit Martin Hikel
- Eigene Recherche
Quellen anzeigen