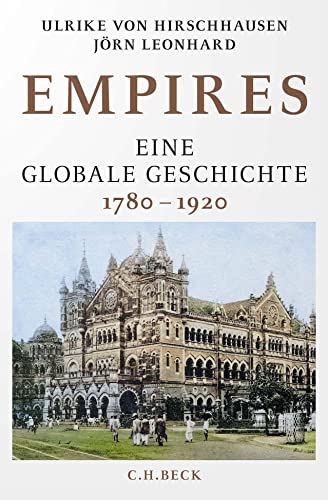Historiker Leonhard über Putin "Das haben viele Beobachter im Westen unterschätzt"

Der Gesprächspartner muss auf jede unserer Fragen antworten. Anschließend bekommt er seine Antworten vorgelegt und kann sie autorisieren.
Zum journalistischen Leitbild von t-online.

Mit Gewalt will Russland sein einstiges Imperium restaurieren, doch woher stammt dieser Wahn? Historiker Jörn Leonhard über imperialen Phantomschmerz.
Imperien existierten über Jahrhunderte, dann waren sie irgendwann "Geschichte". Oder doch nicht? Unter Wladimir Putin führt Russland gegenwärtig Krieg gegen die Ukraine, das Empire soll mit Gewalt restauriert werden. Wie aber konnte der Westen diese Gefahr unterschätzen? Was macht überhaupt ein Empire aus? Und inwiefern erinnert Russlands aktueller Krieg an den Ersten Weltkrieg? Jörn Leonhard, einer der angesehensten Historiker Deutschlands und Autor eines Buches über Empires, beantwortet diese Fragen im Gespräch.
t-online: Professor Leonhard, Begriffe wie "Empire" oder "Imperialismus" waren blasse Erinnerungen aus dem Geschichtsunterricht. Nun haben wir es in Russland erneut mit einem aggressiven Imperialismus zu tun, der sich in einem Expansionsstreben zeigt. Wie konnte es dazu kommen?
Jörn Leonhard: Empires scheinen tatsächlich in unsere Welt zurückgekehrt zu sein. Als Historiker registriert man vor allem verwundert, wie mächtig die Kraft geschichtlicher Suggestion sein kann. In Russland hat das geschichtspolitische Konstrukt seine eigene Realität hervorgebracht, eine Wahrnehmung, die von der Erzählung der einstigen Größe des russischen Empires lebt – und von den Demütigungen, die es angeblich oder tatsächlich erlitten hat.
Hier lässt sich erkennen, wie sich Imperialität, also das Denken vom Empire her, auch nach dem Ende der Sowjetunion fortsetzte und in den letzten Jahren eine ganz eigene Handlungsdynamik entwickelte – bis hin zum neoimperial begründeten Krieg gegen die Ukraine. Und ohne Meinungsfreiheit fehlen in der russischen Gesellschaft die Gegenkräfte, um dieser Geschichtspolitik zu widersprechen.
Nicht nur das russische Empire scheint zurückgekehrt, sondern es herrscht auch wieder Krieg in Europa. Ein Zustand, den kaum jemand vor dem russischen Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 für wahrscheinlich gehalten hatte.
Alle Kriege konfrontieren uns mit Atavismen, mit Erfahrungen, die wir für längst überwunden gehalten haben. In solchen Situationen ist der Blick in die Vergangenheit besonders aufschlussreich: Vor 1914 äußerten zahlreiche Publizisten die Ansicht, dass Kriege eine Sache von Agrargesellschaften seien, dass moderne Industriegesellschaften keine Kriege mehr gegeneinander führen würden, weil sie angesichts wirtschaftlicher Verflechtungen viel zu viel zu verlieren hatten. Noch im Sommer 1914 waren die Staatsanleihen, gewissermaßen das Fieberthermometer der internationalen Beziehungen, unauffällig.
Jörn Leonhard, Jahrgang 1967, lehrt Neuere und Neueste Geschichte an der Universität Freiburg. Mit "Die Büchse der Pandora" veröffentlichte er 2014 ein Standardwerk zur Geschichte des Ersten Weltkriegs. Seine 2018 erschienene Publikation "Der überforderte Frieden. Versailles und die Welt 1918–1923" beschreibt und analysiert die Entstehung der globalen Nachkriegsordnung von 1918 bis 1923. Gerade ist sein neues Buch (mit Ulrike von Hirschhausen) "Empires. Eine globale Geschichte 1780–1920" erschienen.
Ab August 1914 bekämpften sich die europäischen Mächte dann im Ersten Weltkrieg. Im aktuellen Konflikt Russlands gegen die Ukraine erinnern vor allem die Schützengräben an diesen Konflikt vor mehr als 100 Jahren.
Die meisten Kriege enthalten alte und neue Elemente, so auch jetzt. Wir sehen Schützengräben und Panzer, aber auch Drohnen, den Einsatz von Fake News und vor allem einen modernen Wirtschaftskrieg. Häufig greifen dabei Tradiertes und Neueres ineinander, manchmal existieren sie nebeneinander.
Zumindest die strategischen Ziele der Kriegsführung erscheinen zeitlos: Die ukrainische Armee versucht in ihrer gegenwärtigen Offensive, den Stellungskrieg zu überwinden und die russischen Linien zu durchbrechen.
In einem territorial festgefahrenen Krieg ruhen auf Offensiven immer enorme Hoffnungen, weil man von ihnen ein möglichst schnelles Ende des Krieges erwartet. Wenn es dann trotz hoher Verluste zu keinen Durchbrüchen kommt, stellt sich schnell Enttäuschung ein – das erinnert an die großen Materialschlachten 1916 vor Verdun und an der Somme. Für die kriegführenden Gesellschaften, die diese enormen Opfer tragen müssen, ist ein solcher Krieg eine enorme Belastung. Wie lange Gesellschaften und politische Systeme solche Belastungen aushalten können, ist für das Ende von Kriegen oft eine entscheidende Frage.
Nun führte der Erste Weltkrieg zum Zerfall einst mächtiger Imperien. Neben dem Osmanischen Reich und der Habsburgermonarchie endete auch die Herrschaft der Zaren über Russland. Was aber macht ein Imperium überhaupt aus? Mit "Empires. Eine globale Geschichte 1780–1920" haben Sie gerade ein Buch dazu veröffentlicht.
Wir sprechen in unserem Buch bewusst von "Empires", um die Rezeptionsgeschichte von Imperien seit der Antike aufzubrechen und den Fokus auf das 19. und frühe 20. Jahrhundert zu legen. Was zeichnet aber ein Empire aus? Zunächst eine enorme räumliche Ausdehnung und damit zusammenhängend zweitens ein hoher Grad an ethnischer Vielfalt, etwa im Blick auf Sprache, Religion und Recht.
Drittens zeichnet sich ein Empire im Gegensatz zu Nationalstaaten durch weiche und bewegliche Grenzen aus. Ein Beispiel dafür waren die USA, die die Siedlungsgrenze immer weiter von Ost nach West verschoben haben. Viertens bilden sich in Empires besondere Machthierarchien aus, wobei die Beziehungen zwischen Zentrum und Peripherie nie statisch waren.
Putin fabuliert von einer "Russischen Welt", deren Grenzen der Kreml je nach Bedarf weit über das eigentliche Territorium der Russischen Föderation hinaus erweitert. In der aktuellen Situation vor allem zum Schaden der Ukraine.
Hier verknüpfen sich imperialer Anspruch und Propaganda. Zudem wird deutlich, wie schwierig der Umgang mit Empires und ihren Hinterlassenschaften nach dem formalen Ende sein kann. In Russland zeigt sich exemplarisch ein letztes Kennzeichen von Empires, nämlich die Vorstellung einer langen Dauer von Herrschaft, ergänzt um die Vorstellung, in einer über Jahrhunderte reichenden Abfolge imperialer Ordnungen zu stehen.
Im Kontext der kolonialen Expansion im 19. Jahrhundert kamen zivilisatorische Missions- und rassistische Überlegenheitsvorstellungen hinzu, mit denen sich Eroberung und Unterwerfung auch unter Anwendung enthemmter Gewalt rechtfertigen ließen. In diesem Sinne stellt Putin die russische Politik in die lange Tradition des russischen Zarenreichs und der Sowjetunion als Empire.
Viele Imperien waren mit bestimmten Herrscherdynastien verbunden. Die Romanows zum Beispiel beherrschten Russland rund 300 Jahre lang.
Wir sprechen ja nicht zufällig vom Osmanischen Reich, der Habsburgermonarchie, dem Zarenreich – das verweist schon in der Bezeichnung auf die enorme Bedeutung der Dynastien, die als personale Klammer die ethnische Vielfalt integrieren sollten. Aber gerade seit dem Ende des 19. Jahrhunderts stellten sich Zeitgenossen die Frage, ob diese tradierte Form der Herrschaft den Empires noch eine Zukunft garantieren konnte. In jedem Fall gehört zu den Empires auch der langfristige Rhythmus von Aufstieg, Niedergang und Zerfall oder Ablösung durch neue Empires.
So wie das Amerikanische Empire im 20. Jahrhundert das Britische Empire abgelöst hat.
Und in der Gegenwart erleben wir, wie China ganz offen den Machtanspruch der USA herausfordert – auch das eine mögliche "translatio imperii".
Nun scheint es eine weitere Eigenschaft von Imperien zu sein, alles andere als sang- und klanglos zu verschwinden. Nicht nur in Russland herrscht ein imperialer Phantomschmerz, auch China beharrt auf seinem Anspruch auf Taiwan.
Empires hinterlassen ein Erbe, das weit über ihr formales Ende hinausweist und das sich häufig als eine Art von Phantomschmerz, manchmal auch als historische Nostalgie und Erinnerung äußert, die sich politisch instrumentalisieren lässt – eine Variante des Imperialismus nach dem Empire. Schon lange vor dem russischen Überfall auf die Ukraine verwiesen Mitglieder der russischen Politikelite immer wieder auf die imperiale Vergangenheit Russlands als Maßstab für die künftige Politik. Putin weiß das geschickt einzusetzen, und in zahllosen Geschichtsparks, Museen und in den Medien wird dieses Geschichtsbild seit vielen Jahren popularisiert. Darauf können staatliche Indoktrination und Propaganda aufbauen.
Diese Form der Langlebigkeit von Empires haben wir im Westen lange Zeit unterschätzt.
Imperiale Phantomschmerzen vergehen tatsächlich sehr langsam, und das haben viele Beobachter im Westen unterschätzt. Gerade in der Phase des Kalten Krieges nahmen wir an, dass die Sowjetunion ein homogener Block sei, in dem es keine ethnischen Gruppen mehr gab, sondern nur noch den "Homo sovieticus". Tatsächlich war auch die Sowjetunion ein multiethnisches Empire, und es ging nicht zuletzt an den daraus resultierenden Konflikten zugrunde – im Baltikum genauso wie im Kaukasus und Mittelasien. Dass die Sezession der Ukraine den Zerfall der Sowjetunion nach 1989/90 wesentlich beschleunigte, spielt dabei eine wichtige Rolle. Das Grundproblem, wie man territoriale Größe und ethnische Vielfalt in eine stabile Herrschaft übersetzen sollte, zeichnete aber nicht allein die späte Sowjetunion aus, sondern alle historischen Empires.
Das Vielvölkerreich der Habsburger wandelte sich 1867 nach der Niederlage gegen Preußen im Deutschen Krieg in die Doppelmonarchie Österreich-Ungarn, um das Reich zu erhalten.
Seit 1848 und erst recht angesichts der erfolgreichen Bildung neuer Nationalstaaten in Italien und Deutschland, die ja als Modell der Homogenität galten, geriet zumal die Habsburgermonarchie unter Druck. Reformen waren eine Antwort auf diese Konstellation: etwa mit der 1867 festgeschriebenen Autonomie der Ungarn innerhalb der Monarchie, mit dem Fokus auf die Sichtbarkeit der Dynastie als imperialem Symbol oder der gemeinsamen Verwaltung, dem Recht oder der Armee. In dieser gab es dann schließlich verschiedene Regimentssprachen, um den unterschiedlichen Ethnien Rechnung zu tragen. Viele der Reformideen vor 1914, bis hin zu einer Föderalisierung der Monarchie, sollten die eigene Zukunftsfähigkeit demonstrieren.
Weil niemand enden wollte wie das Osmanische Reich, das seit dem 19. Jahrhundert als der "kranke Mann am Bosporus" tituliert worden ist?
Der Ausdruck stand für den Verlust von Souveränität – weil die Eliten in Konstantinopel den Verlust der eigenen Gebiete in Südosteuropa und Nordafrika vor 1914 nicht aufhalten konnten. Diese Verlustgeschichte erklärte auch die Reaktion Wiens auf die Ermordung des Thronfolgers Franz Ferdinand Ende Juni 1914 durch serbische Nationalisten in Sarajewo. Denn mit Unterstützung des verbündeten Deutschen Reichs glaubte die Regierung Österreich-Ungarns demonstrieren zu müssen, dass die Monarchie eben kein bloßes Objekt der Politik anderer Mächte war.
Es war allerdings der erste Schritt auf dem langen Weg in den Abgrund.
Jedenfalls kann man die Probleme der Gegenwart kaum ohne die Geschichte der Empires verstehen. Von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer, von Nordafrika bis in den Nahen und Mittleren Osten, von Mittelasien und Indien bis nach China und Japan: In allen Zonen, mit denen wir uns gerade mit Konflikten konfrontiert sehen, spielten Empires und ihr Zerfall eine entscheidende Rolle. Viele Konflikte der Gegenwart haben lange Vorläufe, in die imperiale Vergangenheiten eingeflochten sind.
Lassen sich nicht auch weitere Erkenntnisse aus der Geschichte der Empires ziehen? Waren sie nicht vor allem dann stark, wenn ihr Zugriff auf die Beherrschten eher schwach gewesen ist?
Sicherlich war die Situation fern von den Ministerien und politischen Kanzleien der Hauptstädte eine ganz andere als von den imperialen Eliten erdacht. Vor Ort entwickelte sich oft eine Art von imperialer Routine, weil die Repräsentanten der Empires vor Ort gar nicht über die notwendigen Ressourcen verfügten, um "durchregieren" zu können. Immer wieder waren sie auf Kooperation angewiesen, was den Kolonisierten eigene Handlungsmöglichkeiten gab: also Loyalität zum Empire einerseits, flexible Herrschaft vor Ort andererseits. Großbritannien verfügte über ein globales maritimes Empire, errichtet und stabilisiert durch den Einsatz von Gewalt, aber auch immer wieder durch Pragmatismus und flexible Instrumente vor Ort. Weit entfernt von London musste man etwa in Indien Rücksicht auf Interessen und Bedürfnisse der einheimischen Akteure nehmen. Ansonsten wäre das System kollabiert.
An den Rand des Zusammenbruchs sollten sich das Russische Reich, die Habsburgermonarchie und das Osmanische Reich vor 1914 manövrieren, als sie damit begannen, die Nationalstaaten zu kopieren. Etwa durch Volkszählungen und die Einführung der Wehrpflicht.
Das Modell des Nationalstaates setzte die Empires unter Druck. Daraus entstanden vor 1914 Vorstellungen, die Empires homogener zu machen, sie gewissermaßen zu nationalisieren. Doch Russifizierung, das Gewicht deutscher Eliten in der Habsburgermonarchie und der türkische Nationalismus provozierten dann vielerorts erst die Entstehung neuer nationaler Widerstände – was sich dann im Ersten Weltkrieg weiter zuspitzte.
Kommen wir zum Schluss noch einmal auf Russland zu sprechen. Es scheint, als habe der Neoimperialismus à la Putin sich die Restauration Russlands in seinen alten Grenzen zum Ziel gesetzt. Der Westen hingegen wirkt wenig beseelt von seiner Mission, Liberalismus und Demokratie zu verteidigen.
Wir haben imperiale Handlungsmuster lange Zeit eher als historisch überwunden angesehen, zumal in der Hochphase der europäischen Integration. Jetzt sind wir damit konfrontiert, dass daraus handlungsleitende Realitäten und offene Aggression werden können. Der Krieg ist aber für den Westen auch eine Chance, sich zu vergegenwärtigen, unter welchen Opfern wir imperiale Erbschaften hinter uns gelassen haben und den Weg hin zu Demokratie und Rechtsstaat gegangen sind.
Im Westen ruhen die Hoffnungen auf einen Erfolg der ukrainischen Offensive – und ein baldiges Kriegsende. Russland wird aber aller Voraussicht nach auch in diesem Fall ein auf Revanche sinnendes Imperium bleiben. Droht die Wiederholung alter Fehler?
Selbst mit einer erfolgreichen Offensive der Ukrainer dürfte der Konflikt noch lange nicht vorbei sein. Dieser Glaube an den Erfolg einer letzten großen Offensive sagt vor allem viel über die abnehmende Resilienz in den direkt oder indirekt betroffenen Gesellschaften aus. Unübersehbar geht der Krieg aber schon jetzt über den regionalen Konflikt hinaus. Vor allem im Blick auf China haben wir es mit einem traditionellen Empire zu tun. Die Schwäche, die China im 19. Jahrhundert und bis nach 1945 zum Spielball imperialistischer Mächte hat werden lassen, ist für Peking eine historische Anomalie, während man die jetzige Stärke in die Tradition früherer imperialer Macht stellt.
Wie der Erste Weltkrieg hat sich auch der Krieg in der Ukraine zu einem Abnutzungskrieg gewandelt. Welche Rolle spielt neben Waffen und Ausrüstung die Moral?
In der Endphase des Ersten Weltkriegs hielt der französische Premierminister Georges Clemenceau eine bemerkenswerte Rede. Nicht allein die materiellen Ressourcen würden demnach den Ausgang des Krieges entscheiden. Clemenceau brachte es so auf den Punkt: "Der Sieger ist derjenige, der es schafft, eine Viertelstunde länger als der Gegner zu glauben, dass er nicht besiegt wurde." Hoffen wir, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer diesen Glauben nicht verlieren.
Professor Leonhard, vielen Dank für das Gespräch.
- Persönliches Gespräch mit Jörn Leonhard via Telefon







 News folgen
News folgen